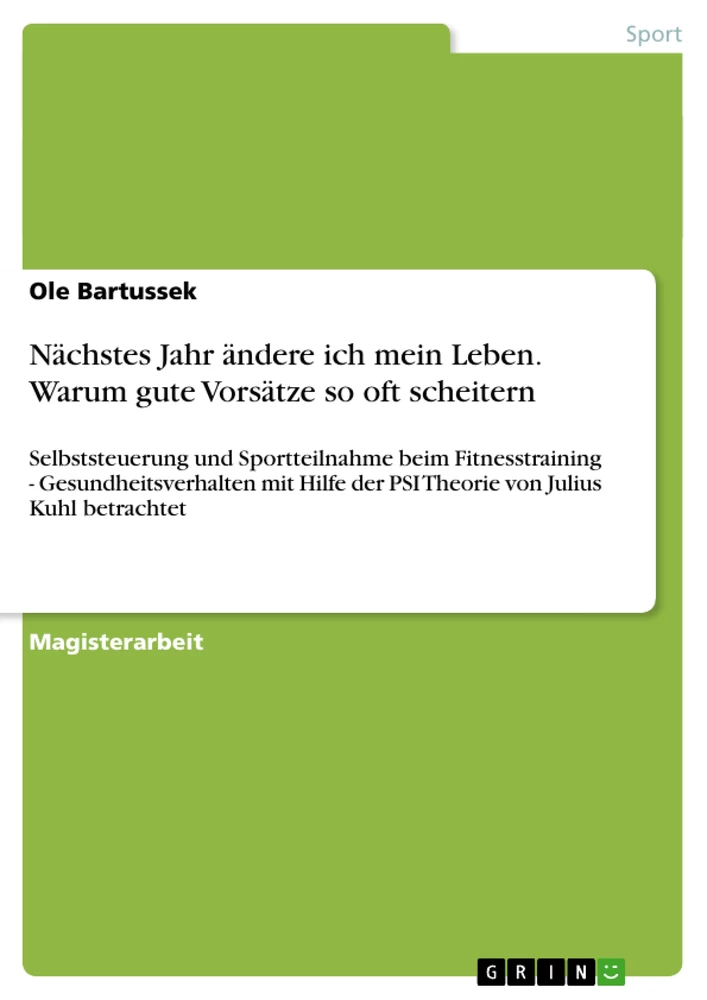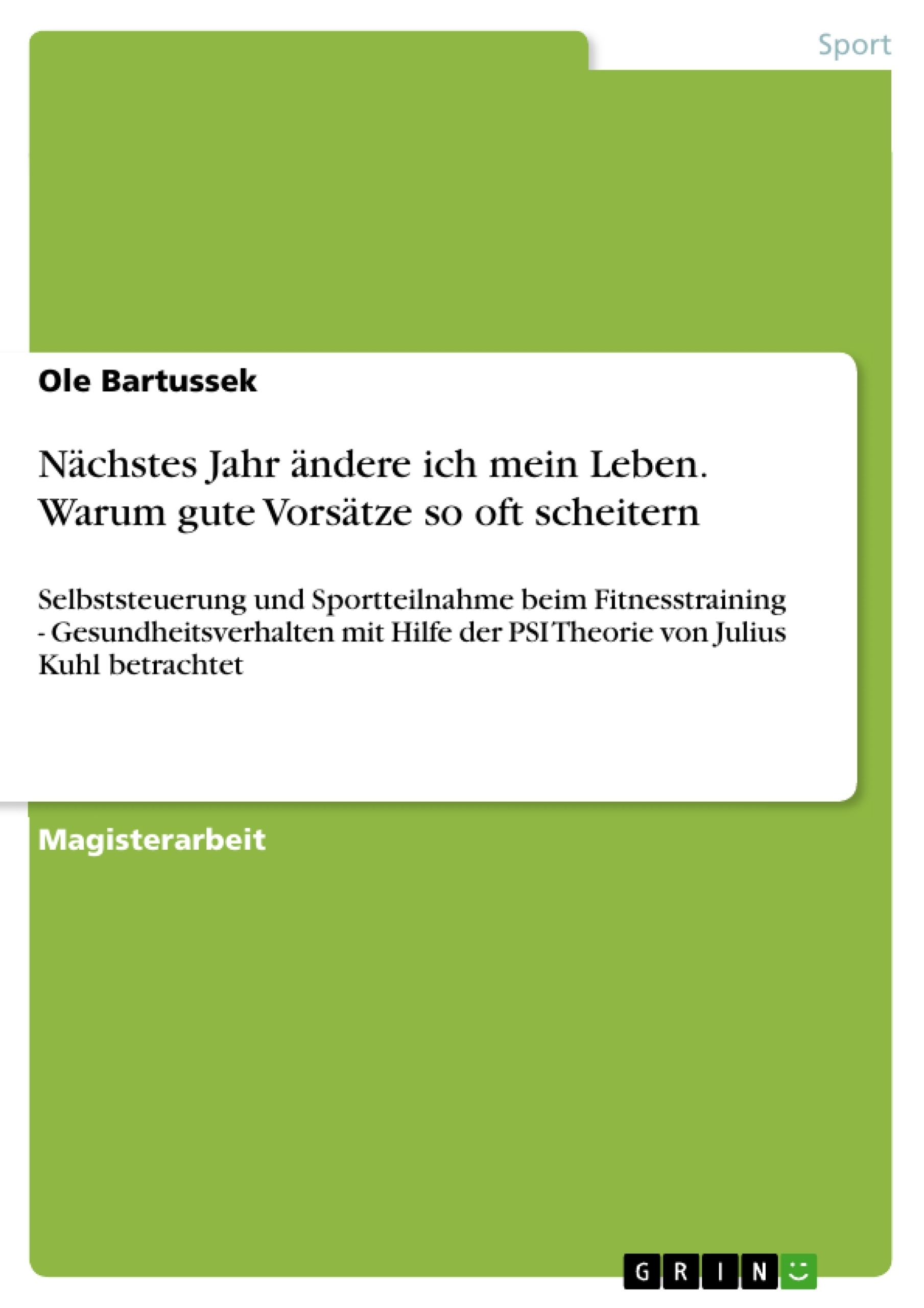Die positiven Wirkungen von Bewegung und Sport, wie die Verringerung von Erkrankungs- und Verletzungsrisiken sowie Verbesserung des psychischen Wohlbefindens, sind bekannt und werden als eines der kostenwirksamsten Mittel zur Förderung der öffentlichen Gesundheit angesehen (Thiex, 2006; WHO, 2005).
Durch körperliche Inaktivität verursachte Erkrankungen des Bewegungsapparats und des Herz-Kreislaufsystems sind ein gesamtgesellschaftliches Problem, das neben Einschränkungen in der Lebensqualität der Betroffenen hohe Kosten für das Gesundheitssystem und die Volkswirtschaft verursacht.
Gleichzeitig sind sich nach Auffassung von Thiex Menschen in Deutschland durchaus bewusst, dass sie ihren Gesundheitszustand durch sportliche Aktivität verbessern können (Thiex, 2006). Auch stellt er fest, dass ihnen ein breites sportliches Angebot von kommerziellen Anbietern und Sportvereinen zur Verfügung steht. Das ungenügende Bewegungsverhalten großer Teile der Bevölkerung liegt demnach an fehlender oder unzureichender Motivation oder an dem Scheitern bereits unternommener Sportteilnahmsversuche.
Der Erfolg von möglichen Therapien, Ansätzen zu gesundheitsbewusstem Verhalten oder von Rehabilitationsmaßnahmen hängt jedoch von der Mitarbeit und der Motivation der Teilnehmer entscheidend ab. Damit eine dauerhafte Verbesserung des Gesundheitszustandes und der Leistungsfähigkeit von Menschen erreicht werden kann, ist es unerlässlich, dass durch Sportkurse oder Therapien erlernte Übungen in den Alltag integriert werden und die Sportteilnahme zur Gewohnheit wird.
Prävention und dauerhafte positive Gesundheitseffekte lassen sich nur durch eine Regelmäßigkeit des Verhaltens, wie z. B. wöchentliches Kraft- oder Ausdauertraining erreichen (Thiel et. al,
2008).
Doch gerade die längerfristige Aufrechterhaltung von körperlicher Aktivität oder von anderem gesundheitsbewussten Verhalten scheint vielen schwer zu fallen. Nach Achtziger & Gollwitzer tun sich selbst hoch motivierte Personen häufig schwer, ein bestimmtes Vorhaben auch wirklich in die Tat umzusetzen (Achtziger & Gollwitzer,2006). Einmal gebildete Vorsätze, wie z. B. das Rauchen aufzugeben oder regelmäßig
Sport zu treiben, werden von vielen Menschen nach wenigen Wochen oder Monaten wieder aufgegeben. Sogenannte gute Vorsätze zum neuen Jahr, z. B. mehr Sport zu treiben, scheitern zu 80%, davon 23% in der ersten Woche (FAZ, 2007).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theorie
- 2. 1 Motivation und Volition
- 2. 1. 1 Motivation
- 2. 1. 2 Volition
- 2. 2 Motivationale Modelle zur Erklärung von Gesundheitsverhalten
- 2.2. 1 Health Belief - Modell
- 2.2. 2 Selbstwirksamkeitstheorie
- 2.2. 3 Selbstbestimmungstheorie
- 2. 3 Volitionale Modelle zur Erklärung von Gesundheitsverhalten
- 2. 3. 1 Rubikon - Modell
- 2. 3. 2 Health Action Process Approach
- 2.4 Die PSI – Theorie
- 2. 4. 1 Willensbahnung und Selbstwachstum
- 2. 4. 2 Affektregulation
- 2. 4. 3 Selbstregulation und Selbstkontrolle
- 2.5 Fazit und Forschungsfrage
- 3. Methode
- 3.1 Hypothesen
- 3.1.1 Hypothesenblock A: Selbststeuerung und Erleben
- 3.1.2 Hypothesenblock B: Selbststeuerung und Verhalten
- 3.1.3 Hypothesenblock C: Selbststeuerung
- 3. 2 Allgemeiner Versuchsplan
- 3.3 Stichprobenbeschreibung
- 3.4 Aufbau der Fragebögen
- 3. 4. 1 Erleben des Sports
- 3. 4. 2 Sportverhalten
- 3. 4. 3 Selbststeuerung beim Sport
- 3.5 Untersuchungsdurchführung
- 3. 6 Verfahren der Datenauswertung
- 4. Ergebnisse
- 4. 1 Vorbereitende Analysen
- 4.2 Hypothesenprüfung
- 4.2.1 Selbststeuerung und Erleben
- 4.2.2 Selbststeuerung und Verhalten
- 4.2.3 Selbststeuerung
- 5. Diskussion der Ergebnisse
- 5.1 Kritische Betrachtung der Untersuchung
- 5.2 Diskussion der Ergebnisse
- 5. 3 Ausblick für die weitere Erforschung der Sportteilnahme
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Rolle der Selbststeuerung im Zusammenhang mit Sportteilnahme im Kontext von Fitnesstraining. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse von motivationalen und volitionalen Prozessen, die die Sportteilnahme beeinflussen.
- Motivationale und volitionale Prozesse im Zusammenhang mit Sportteilnahme
- Einfluss von Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung auf Sportmotivation
- Analyse verschiedener theoretischer Modelle zur Erklärung von Gesundheitsverhalten
- Die Rolle der PSI-Theorie im Hinblick auf Selbstregulation und Selbstkontrolle
- Empirische Untersuchung der Beziehung zwischen Selbststeuerung, Erleben und Verhalten im Fitnesstraining
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Forschungsgegenstand einführt und die Forschungsfrage formuliert. Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Selbststeuerung und Sportteilnahme. Hier werden verschiedene motivationale und volitionale Modelle vorgestellt, die das Gesundheitsverhalten erklären, wie das Health Belief Modell, die Selbstwirksamkeitstheorie und die Selbstbestimmungstheorie. Des Weiteren wird die PSI-Theorie vorgestellt, die die Bedeutung von Willensbahnung, Affektregulation und Selbstkontrolle für die Sportteilnahme hervorhebt.
Kapitel 3 beschreibt die Methode der Untersuchung, einschließlich der Hypothesenformulierung, des Versuchsplans, der Stichprobenbeschreibung und der Datenanalyse. Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die Hypothesen interpretiert und diskutiert.
Kapitel 5 diskutiert die Ergebnisse der Untersuchung kritisch und beleuchtet die Stärken und Schwächen der Studie. Die Diskussion beinhaltet auch einen Ausblick auf zukünftige Forschungsrichtungen im Bereich der Sportteilnahme.
Schlüsselwörter
Selbststeuerung, Sportteilnahme, Fitnesstraining, Motivation, Volition, Gesundheitsverhalten, Health Belief Modell, Selbstwirksamkeitstheorie, Selbstbestimmungstheorie, PSI-Theorie, Willensbahnung, Affektregulation, Selbstkontrolle, empirische Forschung
- Quote paper
- Ole Bartussek (Author), 2009, Nächstes Jahr ändere ich mein Leben. Warum gute Vorsätze so oft scheitern, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/160488