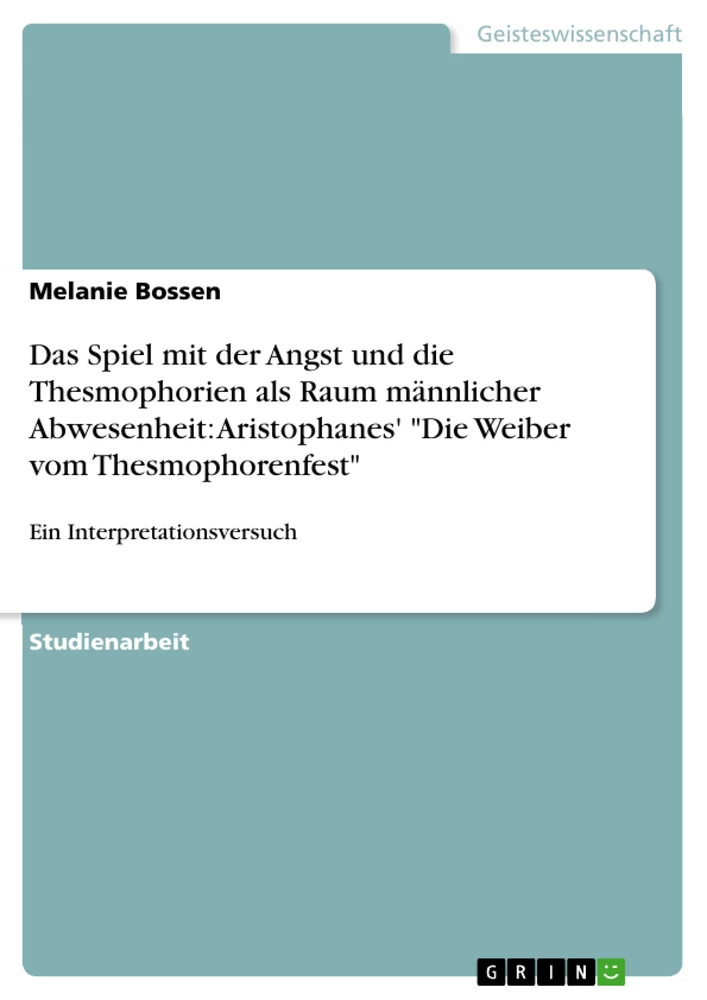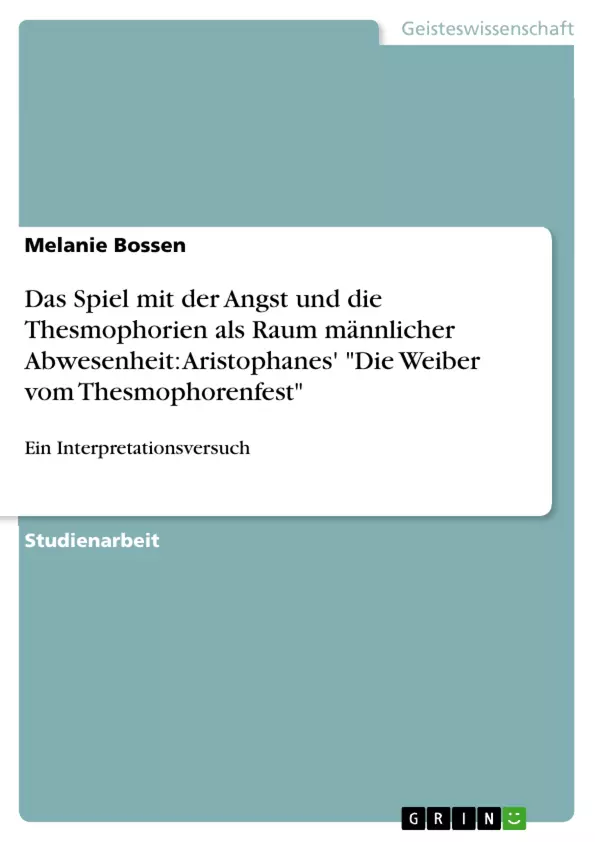„[...] the Thesmophoriazousae is a for more complex and better integrated play than it might appear at first. It is located at the intersection of several relations: between male and female, between tragedy and comedy, between theater (tragedy and comedy) and festival (the Dionysiac, which provides the occasion for its performance and determines its comic essence), and finally between bounded forms (myth, ritual and drama) and the more fluid ‚realities‘ of everyday life. All these relations are unstable and reversible: they cross boundaries and invade each other’s territories, erase and reinstate hierarchical distances, reflecting ironically upon each other and themselves.“ , schreibt Zeitlin in ihrer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Aristophanes’ "Die Weiber am Thesmophorenfest" und führt gleich mehrere interessante Punkte auf, mit denen man sich bei einer Interpretation dieser Komödie beschäftigen könnte.
Mich interessierte das Frauenbild, welches Aristophanes in seinem Stück vermittelte - im Kontext von Vorstellungen einer ehrbaren Bürgerin im antiken Athen. Auch schien mir der Handlungsort dieser Komödie, das Thesmophorenfest der Frauen Athens, ein spannender Interpretationspunkt zu sein – immer in Hinblick darauf, dass der Verfasser von Die Weiber am Thesmophorenfest männlich ist und er für ein überwiegend männliches Publikum schrieb.
Im ersten Teil der Arbeit gebe ich zunächst einen kurzen Überblick über die Alte Komödie und deren Aufführungspraxis während der Dionysien in Athen. Danach gehe ich kurz auf das Leben des Dichters Aristophanes ein und gebe eine Zusammenfassung seines Stückes Die Weiber am Thesmophorenfest. Im zweiten Teil der Arbeit widme ich mich der Textinterpretation. Anschließend folgt ein kurzes Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemein
- Dionysien
- Die Alte Komödie
- Textinterpretation
- Das Spiel mit der Angst oder: Ist meine Frau ehrbar?
- Die Thesmophorien als Ort männlicher Abwesenheit
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit Aristophanes' Komödie "Die Weiber am Thesmophorenfest" und analysiert das Frauenbild, das in diesem Stück dargestellt wird, im Kontext der Vorstellung von einer ehrbaren Bürgerin im antiken Athen. Der Fokus liegt dabei auf dem Thesmophorenfest, dem Ort des Geschehens, und auf den spezifischen Machtstrukturen, die im Spiel zwischen Mann und Frau, sowie zwischen Theater und Fest zum Ausdruck kommen.
- Das Frauenbild in Aristophanes' "Die Weiber am Thesmophorenfest"
- Das Thesmophorenfest als Raum männlicher Abwesenheit
- Das Verhältnis von Theater, Geschlecht und Politik im antiken Griechenland
- Die Funktion von Komödie als Medium der Kritik und Satire
- Die Rolle von Mythen, Ritualen und Alltag im antiken Theater
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Einleitung in die Thematik, Vorstellung der Forschungsfrage und des methodischen Vorgehens.
- Allgemein:
- Dionysien: Beschreibung des antiken Fests der Großen Dionysien, ihrer Bedeutung und der Rolle der Komödie in diesem Kontext.
- Die Alte Komödie: Definition und Einordnung der Alten Komödie, ihrer Merkmale, Vertreter und deren Beziehung zur Politik und zum gesellschaftlichen Leben im antiken Athen.
- Textinterpretation:
- Das Spiel mit der Angst oder: Ist meine Frau ehrbar?: Analyse der Komödie "Die Weiber am Thesmophorenfest" in Bezug auf die Darstellung von Angst und Verwirrung, die von der Frage der Ehrbarkeit einer Frau ausgelöst wird.
- Die Thesmophorien als Ort männlicher Abwesenheit: Interpretation des Thesmophorenfests als Ort weiblicher Macht und männlicher Exklusion, sowie der damit verbundenen Konflikte und Machtverhältnisse.
Schlüsselwörter
Alte Komödie, Aristophanes, Die Weiber am Thesmophorenfest, Dionysien, Thesmophorien, Frauenbild, Geschlecht, Politik, Theater, Ehrbarkeit, Bürgerin, antikes Athen, Machtverhältnisse, Mythen, Rituale, Alltag.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Aristophanes' "Die Weiber am Thesmophorenfest"?
Die Komödie thematisiert das Frauenbild im antiken Athen und nutzt das Thesmophorenfest als Schauplatz für Geschlechterkonflikte.
Was war das Thesmophorenfest?
Es war ein religiöses Fest in Athen, das ausschließlich Frauen vorbehalten war und somit einen Raum männlicher Abwesenheit darstellte.
Welche Rolle spielt die "Alte Komödie" in diesem Kontext?
Die Alte Komödie diente im antiken Athen als Medium für politische Kritik, Satire und die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Normen.
An welches Publikum richtete sich das Stück ursprünglich?
Obwohl es um Frauen geht, wurde das Stück von einem Mann (Aristophanes) für ein überwiegend männliches Publikum geschrieben.
Welche zentralen Themen werden in der Textinterpretation analysiert?
Zentrale Themen sind die weibliche Macht, die männliche Exklusion sowie die Frage nach der "Ehrbarkeit" der Bürgerinnen.
- Quote paper
- Melanie Bossen (Author), 2009, Das Spiel mit der Angst und die Thesmophorien als Raum männlicher Abwesenheit: Aristophanes' "Die Weiber vom Thesmophorenfest", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/160262