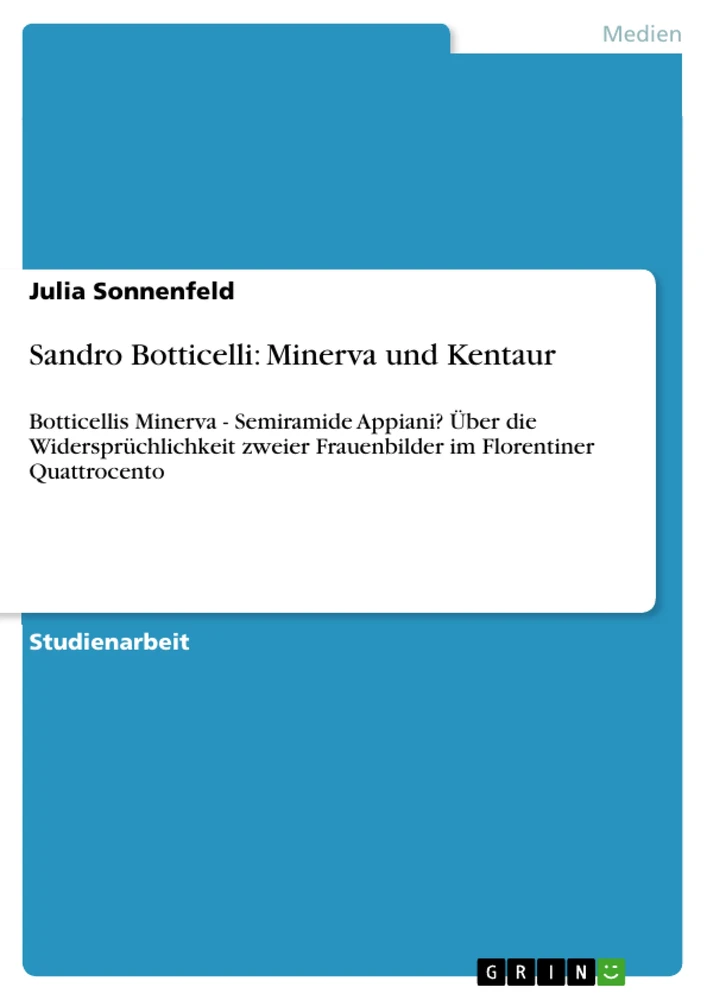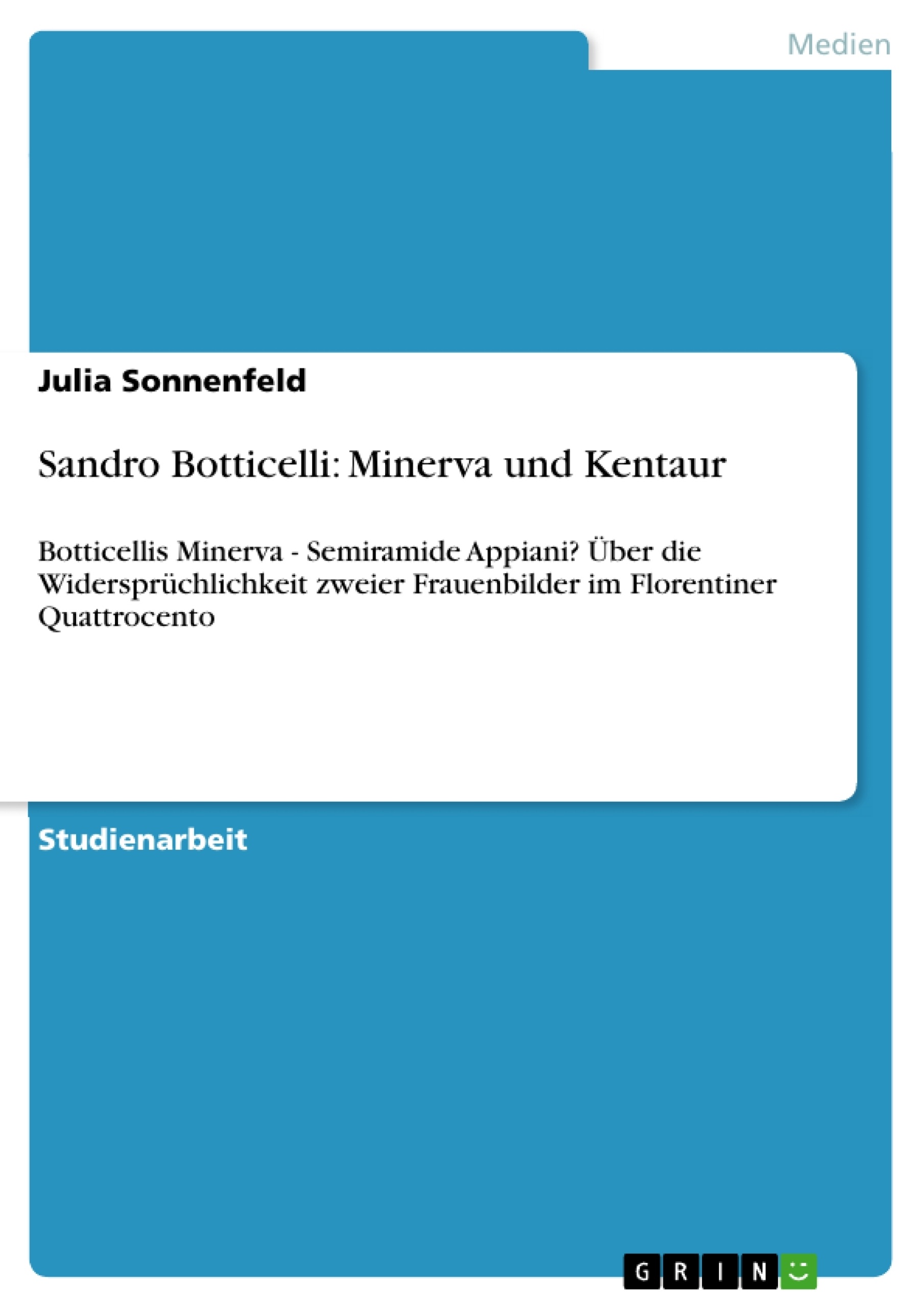Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht Botticellis Gemälde Minerva und Kentaur, das im Umfeld der Medici in den 1480er Jahren des Florentiner Quattrocento entstanden ist. Damit fügt es sich in einen Kontext ein, der so komplex ist mit den vielfältigen politischen, ökonomischen und kulturellen Dimensionen der Zeit, dass es die Kunstgeschichte bis heute zu einer enormen Fülle an Literatur und Interpretationsvorschlägen zu diesem Werk gebracht hat. Politisches Kalkül, intrafamiliärer Affront und moralisch-philosophische Intentionen werden in Botticellis Minerva und Kentaur zugleich entdeckt.
Seit 1975 weiß man, dass das mythologische Werk in die Spalliere-Dekoration eines mediceischen Brautzimmers integriert war. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit einem Interpretationsansatz, der seitdem Botticellis Minerva als Identifikationsfigur für die Braut Semiramide Appiani, Gattin des Lorenzo di Pierfrancesco de‘ Medici, betrachtet. Diesen Ansatz gilt es kritisch auf die Frage zu untersuchen, ob und inwiefern es überhaupt möglich war, Parallelen zwischen Botticellis Minerva und der Ehefrau Semiramide zu ziehen. Gab es nicht vielmehr zwei autonome, völlig unterschiedliche und unvereinbare Rollen der Frau im Florentiner Quattro-cento? Zum einen entstand im Kontext der mediceischen Turniere das Bild der keuschen Nymphe, die in der Lage war, die niederen männlichen Triebe zu zähmen. Zum anderen existierte daneben ein Geschlechterverhältnis, in dem die Frau hinter dem Mann zurücktrat, sich unterzuordnen hatte, fruchtbar und nicht keusch, zurückhaltend und nicht erotisch sein sollte.
Die Arbeit schafft im ersten Teil die Grundlage der Argumentation, indem das Gemälde beschrieben und erste ikonografische Fragen geklärt werden. Das Werk wird in den Kontext der Hochzeit eingeordnet und der Interpretationsansatz, den es zu hinterfragen gilt, wird in seinen Entwicklungsstufen nachgezeichnet. Im zweiten Teil wird die fiktive Rolle der Frau als keusche Nymphe thematisiert. Es erfolgt eine kurze Einführung in die Tradition der mediceischen Feste, anschließend wird das weibliche Ideal aus Angelo Polizianos "Stanze per la giostra" abgeleitet und gezeigt, inwiefern Botticellis Minerva dem Mythos folgt. Im Gegenzug kreist der folgende Teil um die Realität der Florentiner Ehefrau und arbeitet die Diskrepanzen heraus, die sich im Vergleich von Botticellis Minerva mit der Rolle der Ehefrau ergeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Botticellis Minerva und Kentaur
- Beschreibung und Einordnung
- Ein Bild der Medici: Politik, moralische Allegorie oder Lob der Ehefrau?
- Weiblichkeit im Florenz des 15. Jahrhunderts: Die Frau in zwei Rollen
- Der Mythos der keuschen Jungfrau und die Bezähmung der Lust
- Die giostra Giulianos
- Angelo Poliziano: Stanze per la giostra
- Botticellis Minerva: Keusche Liebe und Dominanz
- Die Florentiner Ehefrau Semiramide Appiani
- Liebe und Dominanz
- Keuschheit und sexuelle Attraktivität
- Der Mythos der keuschen Jungfrau und die Bezähmung der Lust
- Fazit: Botticellis Minerva - Semiramide Appiani?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Botticellis Gemälde "Minerva und Kentaur" im Kontext der Florentiner Kunst und Gesellschaft des 15. Jahrhunderts. Sie untersucht die möglichen Bedeutungen des Werks, insbesondere im Hinblick auf die Identifizierung der weiblichen Figur mit Semiramide Appiani, der Ehefrau von Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici.
- Die Rezeption von Botticellis "Minerva und Kentaur" im Kontext der mediceischen Kultur
- Die Rolle der Frau im Florentiner Quattrocento zwischen keuschem Ideal und gesellschaftlicher Realität
- Die Darstellung von Weiblichkeit in Botticellis "Minerva und Kentaur" im Vergleich zu anderen zeitgenössischen Kunstwerken
- Die Frage nach der Möglichkeit einer eindeutigen Interpretation des Gemäldes im Hinblick auf seine politische und gesellschaftliche Bedeutung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Gemälde "Minerva und Kentaur" wird vorgestellt und in den Kontext der Florentiner Kunst des 15. Jahrhunderts eingeordnet. Die Arbeit stellt die Problematik des Werks dar und die Frage nach einer möglichen Identifizierung der weiblichen Figur mit Semiramide Appiani.
- Botticellis Minerva und Kentaur: Das Gemälde wird detailliert beschrieben und ikonografisch analysiert. Der Interpretationsansatz, der Minerva mit Semiramide Appiani identifiziert, wird vorgestellt und seine Entwicklungsstufen nachgezeichnet.
- Weiblichkeit im Florenz des 15. Jahrhunderts: Die Frau in zwei Rollen: Die beiden gegensätzlichen Rollenbilder der Frau in der Florentiner Gesellschaft werden beleuchtet. Zum einen der Mythos der keuschen Jungfrau, der im Kontext der mediceischen Turniere und in Angelo Polizianos "Stanze per la giostra" zum Ausdruck kommt. Zum anderen die gesellschaftliche Realität der Florentiner Ehefrau, die sich dem Mann unterordnen musste.
Schlüsselwörter
Botticelli, Minerva und Kentaur, Florenz, Quattrocento, Medici, Semiramide Appiani, Weiblichkeit, Keuschheit, Ehefrau, Kunstgeschichte, Ikonographie, Interpretationsansatz, Identifizierung, Mythos, Realität.
- Quote paper
- Julia Sonnenfeld (Author), 2010, Sandro Botticelli: Minerva und Kentaur, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/160207