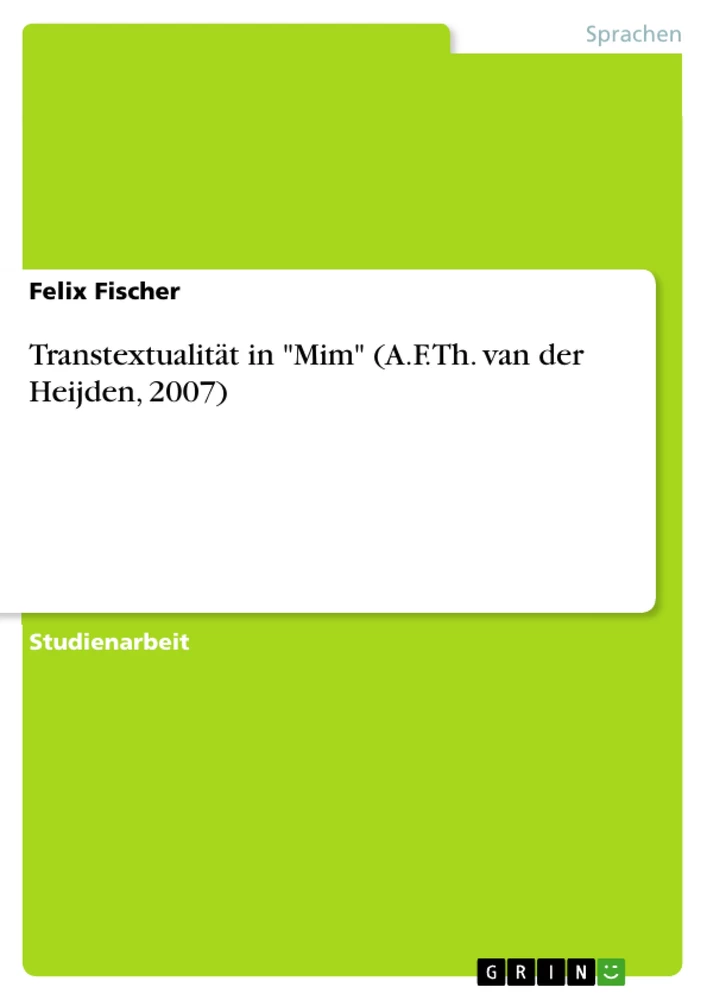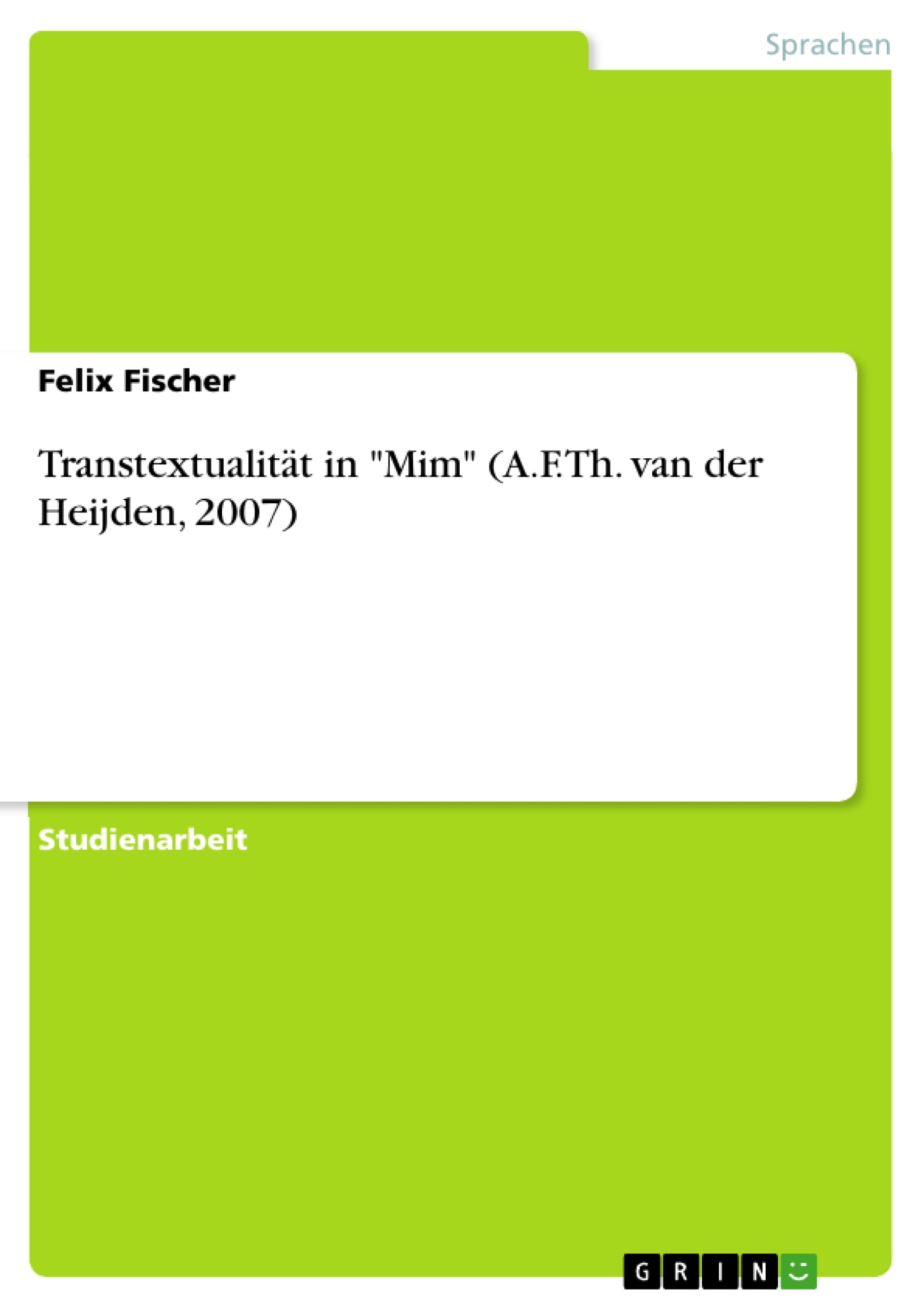A.F.Th. van der Heijdens Roman MIM, OF DE DOORSTOKEN GLOBE (2007), der in der Reihe HOMO DUPLEX erschien, wurde und wird immer wieder mit Sophokles’ antiker Tragödie ÖDIPUS DER TYRANN (ca. 429-425 v. Chr.; verwendet in der Übersetzung von Friedrich Hölderlin, 1957) in Verbin- dung gebracht oder sogar direkt als modernisierte Fassung bezeichnet (z.B. in Stoffelsen 2007; Fortuin 2007). Wenn man das Buch daraufhin mit entsprechender Vorkenntnis liest, kommt man tatsächlich nicht umhin, einige Parallelen zum mehr als 2400 Jahre älteren Werk zu erkennen. So scheinen zum Beispiel die beiden verfeindeten Fußball-Fanclubs „De Pit“ und „De Kern“ gleichsam metonymisch für die griechischen Städte Theben und Korinth zu stehen, deren Herrscher von den Vorsitzenden dieser Clubs und ihren Angehörigen verkörpert werden. Movo indes widerfährt ein in den wichtigsten Punkten vergleichbares Schicksal wie seinem vermeintlichen Vorbild Ödipus, denn beide werden nach ihrer Geburt von den Eltern verstoßen, gelangen auf die Gegenseite, töten ihren leiblichen Vater und nehmen die eigene Mutter zur Frau.
Gleichzeitig stößt man jedoch auf gewaltige Unterschiede zwischen beiden Texten, die die Ähnlichkeit stark abschwächen. So gibt es, abgesehen von den grundlegendsten Gegebenheiten, kaum Übereinstimmungen, aber viele Gegensätze. Inhaltlich fällt zuerst auf, dass das Geschehen in die Jetztzeit verlegt wurde und in einem völlig anderen Kontext spielt: Orten, Namen und Tätigkeiten unterscheiden sich, Details des Handlungsverlaufs wurden variiert. Äußerlich wurde aus einem klassischen Theaterstück mit stringenter Struktur ein postmoderner Roman mit nichtlinearer und subjektiv geprägter Erzählweise.
Es scheint ganz so, als habe sich van der Heijden zwar von Sophokles inspirieren lassen, aber ansonsten versucht, diesen Zusammenhang zu verbergen. Angesichts der vielen Abweichungen und des Alters der Vorlage kann man jedoch kaum von einem Plagiat sprechen. Hierzu bedarf es anderer Begriffe, die das zwischentextliche Verhältnis genauer beschreiben. Ziel dieser Arbeit soll es deshalb sein, diese Begriffe zu finden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Transtextualität
- Intertextualität
- Hypertextualität
- Hypertextualität bei MIM
- Transposition
- formale Transposition
- thematische Transposition
- diegetische Transposition
- pragmatische Transposition
- semantische Transformation
- Umwertung
- sonstige Transpositionshinweise
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die transtextuellen Beziehungen zwischen A.F.Th. van der Heijdens Roman "MIM, OF DE DOORSTOKEN GLOBE" (2007) und Sophokles' "Ödipus der Tyrann". Ziel ist es, geeignete Begriffe zu finden, um das zwischentextuelle Verhältnis beider Werke präzise zu beschreiben, da eine simple Charakterisierung als "modernisierte Fassung" unzureichend erscheint.
- Analyse der transtextuellen Bezüge zwischen MIM und Ödipus der Tyrann.
- Untersuchung verschiedener Konzepte der Intertextualität und ihrer Anwendbarkeit.
- Klärung der Frage nach dem Grad der Ähnlichkeit und der Unterschiede zwischen beiden Werken.
- Differenzierung zwischen Inspiration und Plagiat im Kontext literarischer Werke.
- Anwendung geeigneter Begriffe zur Beschreibung des zwischentextuellen Verhältnisses.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Verbindung zwischen A.F.Th. van der Heijdens Roman MIM und Sophokles' Ödipus der Tyrann fest, die in der Literatur bereits gezogen wurde. Es werden zwar Parallelen in den Grundzügen der Handlung zwischen den Protagonisten beider Werke aufgezeigt – Verstoßung, Tötung des leiblichen Vaters, Heirat mit der Mutter – aber auch erhebliche Unterschiede in Kontext, Erzählweise und Details betont. Diese Diskrepanz motiviert die Arbeit, die sich zum Ziel setzt, das zwischentextuelle Verhältnis beider Texte mit geeigneten Begriffen zu beschreiben, anstatt es einfach als Modernisierung zu betrachten. Die Einleitung legt somit den Grundstein für die anschließende Untersuchung der transtextuellen Beziehungen.
Transtextualität: Dieses Kapitel beleuchtet das Phänomen der Transtextualität, also die impliziten und expliziten Bezüge von Texten aufeinander. Es wird betont, dass diese Bezüge ein grundlegendes Element der Textualität darstellen. Die Weite des Begriffs „Text“ und „Bezug“ beeinflusst die Interpretation der Interdependenz von Texten maßgeblich. Das Kapitel bereitet den Boden für die detailliertere Auseinandersetzung mit Intertextualität und der Anwendung spezifischer Konzepte auf die Analyse des Verhältnisses zwischen MIM und Ödipus der Tyrann.
Intertextualität: Dieses Kapitel fokussiert auf Julia Kristevas weite Auffassung von Intertextualität, welche jeden Text als ein Mosaik von Zitaten und Transformationen anderer Texte versteht. Kristevas Konzept wird als texttheoretisch und allumfassend beschrieben, was zwar einen breiten Blickwinkel erlaubt, aber auch die analytische Präzision für spezifische intertextuelle Bezüge einschränken kann. Dieses Kapitel stellt somit eine wichtige theoretische Grundlage für die Analyse des Verhältnisses zwischen MIM und Ödipus dar, indem es die verschiedenen Möglichkeiten der Betrachtung intertextueller Beziehungen aufzeigt.
Schlüsselwörter
Transtextualität, Intertextualität, A.F.Th. van der Heijden, MIM, Sophokles, Ödipus der Tyrann, modernisierte Fassung, postmoderner Roman, nichtlineare Erzählweise, zwischentextuelle Beziehungen, Plagiat, Inspiration.
Häufig gestellte Fragen zu "MIM, OF DE DOORSTOKEN GLOBE" und Ödipus der Tyrann
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit untersucht die transtextuellen Beziehungen zwischen A.F.Th. van der Heijdens Roman "MIM, OF DE DOORSTOKEN GLOBE" (2007) und Sophokles' "Ödipus der Tyrann". Sie geht über eine einfache Charakterisierung als "modernisierte Fassung" hinaus und analysiert die komplexen intertextuellen Verknüpfungen beider Werke.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, geeignete Begriffe zu finden, um das zwischentextuelle Verhältnis der beiden Werke präzise zu beschreiben. Sie analysiert die transtextuellen Bezüge, untersucht verschiedene Intertextualitätskonzepte und klärt den Grad der Ähnlichkeit und Unterschiede zwischen MIM und Ödipus der Tyrann. Ein weiterer Fokus liegt auf der Differenzierung zwischen Inspiration und Plagiat im literarischen Kontext.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Konzepte der Transtextualität und Intertextualität, wobei Julia Kristevas weite Auffassung von Intertextualität im Mittelpunkt steht. Sie analysiert verschiedene Arten der Transposition (formale, thematische, diegetische, pragmatische, semantische Transformation) und untersucht die Umwertung von Motiven und Elementen. Zusätzlich werden spezifische Aspekte des Romans MIM im Kontext der Hypertextualität betrachtet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Transtextualität, Intertextualität, Hypertextualität (inkl. Hypertextualität bei MIM), Transposition (mit Unterkapiteln zu verschiedenen Transpositionstypen), Umwertung, sonstige Transpositionshinweise und Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel liefert eine detaillierte Analyse der jeweiligen Aspekte im Bezug auf die Beziehung zwischen MIM und Ödipus der Tyrann.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Transtextualität, Intertextualität, A.F.Th. van der Heijden, MIM, Sophokles, Ödipus der Tyrann, modernisierte Fassung, postmoderner Roman, nichtlineare Erzählweise, zwischentextuelle Beziehungen, Plagiat, Inspiration.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird gegeben?
Die Zusammenfassung der Kapitel beschreibt die Einleitung als Ausgangspunkt, der Parallelen und Unterschiede zwischen MIM und Ödipus der Tyrann aufzeigt. Das Kapitel zur Transtextualität beleuchtet den breiten Begriff und seine Bedeutung für die Textanalyse. Das Kapitel zur Intertextualität fokussiert auf Kristevas Konzept und seine Anwendung auf die Fallstudie. Weitere Kapitel befassen sich detailliert mit Transpositionsarten und der Analyse der Beziehung zwischen den beiden Werken.
- Arbeit zitieren
- Felix Fischer (Autor:in), 2010, Transtextualität in "Mim" (A.F.Th. van der Heijden, 2007), München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/159926