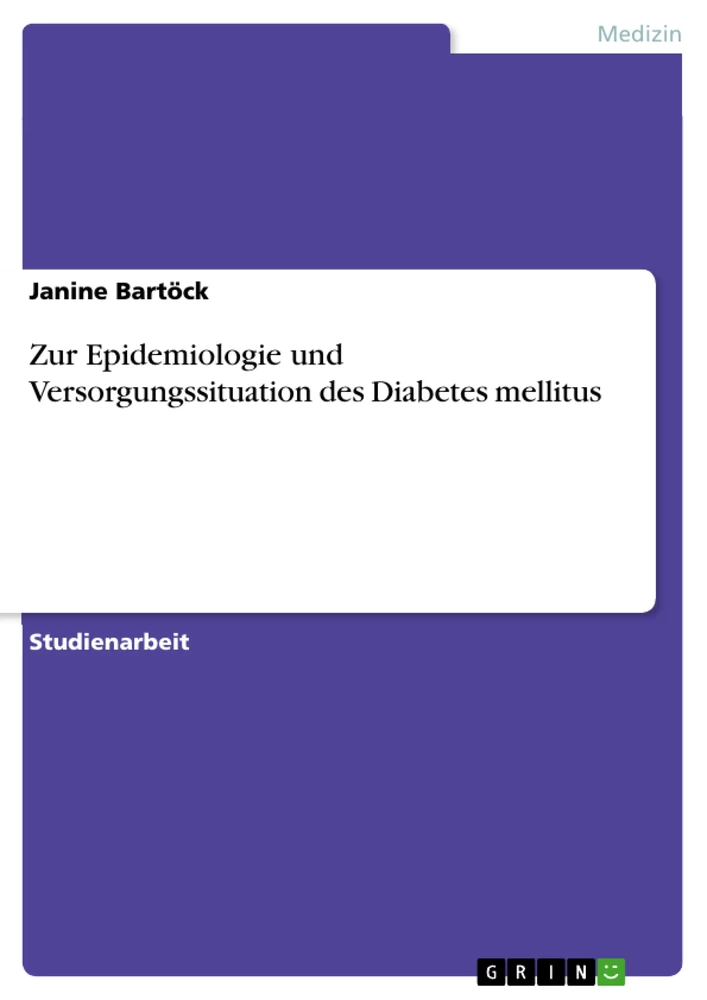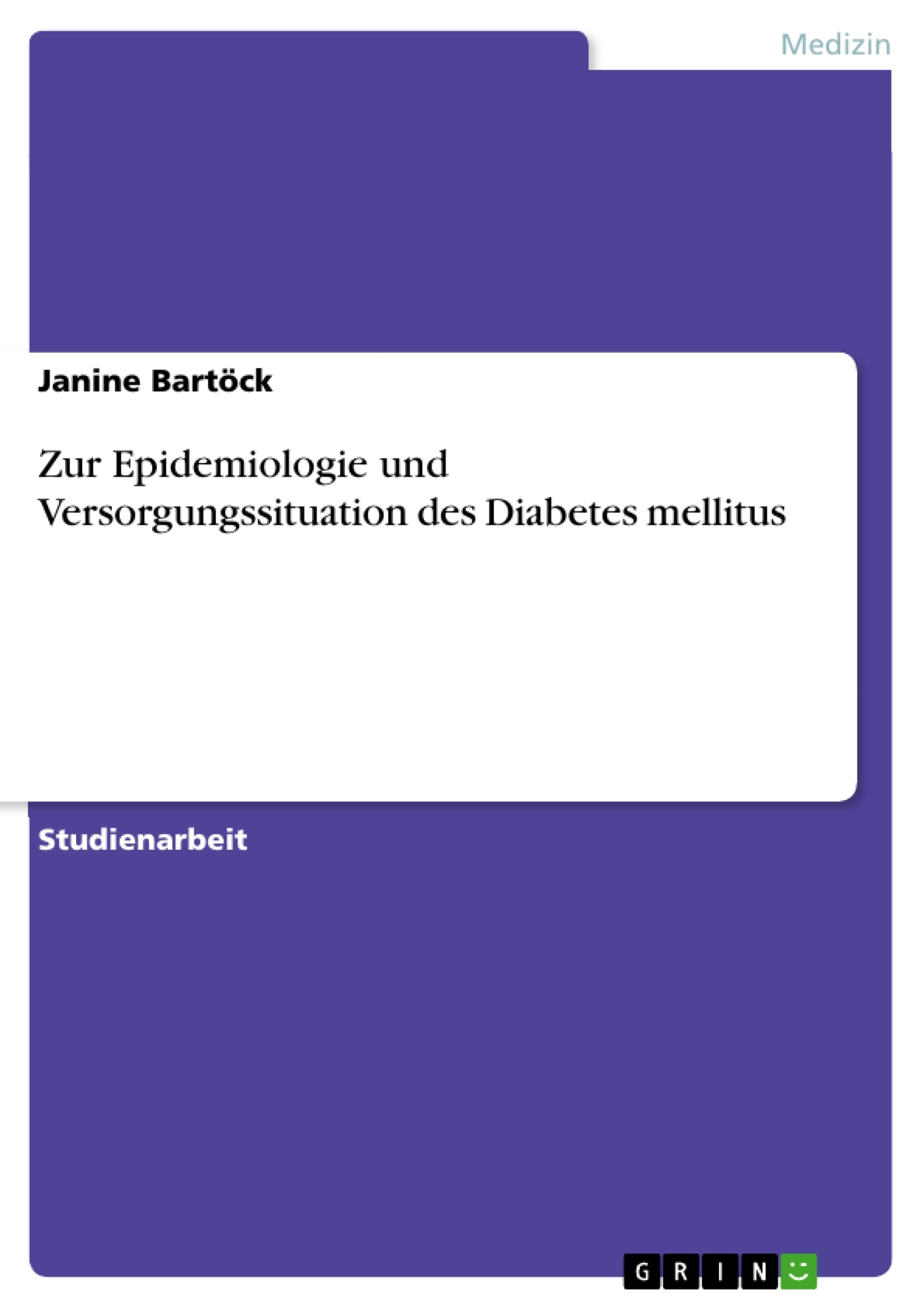Diabetes mellitus - die große Epidemie des 21. Jahrhunderts!
Mit weltweit rasch steigenden Erkrankungszahlen hat sich der Diabetes mellitus zu einer globalen Massenerkrankung ausgebreitet.
Die International Diabetes Federation (IDF) ging bereits im Jahr 2006 von mondial 246 Millionen Diabetikern aus, was einem Anteil von ca. 6 % der Weltbevölkerung entspricht.
Speziell in Deutschland liegen die Schätzungen bei 8 Millionen an Diabetes mellitus Typ 2 erkrankten Menschen, wobei eine hohe Dunkelziffer nicht auszuschließen ist.
Zudem beläuft sich die Zahl der an Diabetes mellitus Typ 1 Erkrankten auf 550.000 Menschen. (vgl. Mirza 2010: 1)
Aufgrund des hohen Stellenwertes des Diabetes mellitus als eine mit epidemischen Ausmaß entwickelte Volkskrankheit (vgl. Korb et al. 2008: 1), setzt sich die vorliegende Arbeit mit eben dieser Erkrankung auseinander.
In einem ersten Teil wird die wissenschaftliche Disziplin Epidemiologie definiert und in ihren Aufgaben und Methoden dargestellt.
Anschließend erfolgt eine detaillierte Auseinandersetzung mit den Hauptausprägungen des Diabetes mellitus.
Diese werden in ihren Ursachen, Risiken, Diagnostik, Symptomen, Komplikationen und letztlich der Behandlung oberflächlich erläutert.
Um das tatsächliche Ausmaß der Erkrankung zu verdeutlichen, wird die Epidemiologie des Diabetes mellitus in seiner Prävalenz, Inzidenz und der überaus wichtigen Prävention erörtert.
Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt jedoch in den Versorgungskonzepten der gesundheitsökonomisch so bedeutungsvollen Erkrankung:
Zunächst werden Schulungen vorgestellt, welche die Basis für eine gute Blutzuckereinstellung bilden.
Daran anschließend erfolgt eine Erläuterung der seit einigen Jahren bestehenden Disease-Management-Programme.
Ein besonderer Bereich ist jedoch die Telemedizin, die durch verschiedene Konzepte Eingang in die Versorgungsstrukturen gefunden hat.
Zwei Konzepte der telemedizinischen Versorgung werden detaillierter dargestellt.
Der abschließende Teil fasst die Inhalte der Arbeit noch einmal zusammen und gibt einen Ausblick auf die Zukunft der Krankheit Diabetes mellitus.
Inhaltsverzeichnis
- Aufbau und Ziele der Arbeit
- Epidemiologie - Definition, Aufgaben, Methoden
- Diabetes mellitus
- Ätiologische Klassifizierung
- Diabetes mellitus Typ 1
- Diabetes mellitus Typ 2
- Epidemiologie des Diabetes mellitus
- Prävalenz
- Inzidenz
- Prävention
- Versorgungsstrukturen und -konzepte des Diabetes mellitus
- Schulungen
- Disease-Management-Programme
- Telemedizin
- Telemonitoring-Programm DiabetivaⓇ
- ,,homecare. diabetes System"
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Diabetes mellitus, einer Volkskrankheit mit epidemischen Ausmaß, und untersucht die epidemiologische Situation sowie die Versorgungsstrukturen dieser Erkrankung. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die epidemiologischen Grundlagen des Diabetes mellitus aufzuzeigen und ein umfassendes Bild der aktuellen Versorgungslandschaft zu vermitteln. Die Arbeit konzentriert sich insbesondere auf die Bedeutung von Prävention, Schulungen, Disease-Management-Programmen und Telemedizin in der Diabetesversorgung.
- Epidemiologie des Diabetes mellitus: Prävalenz, Inzidenz und Präventionsansätze
- Versorgungsstrukturen für Menschen mit Diabetes mellitus: Schulungen, Disease-Management-Programme und Telemedizin
- Telemedizinische Konzepte in der Diabetesversorgung: Telemonitoring-Programme und „homecare. diabetes System“
- Zukünftige Herausforderungen und Perspektiven in der Diabetesversorgung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel erläutert den Aufbau und die Ziele der Arbeit und hebt die Bedeutung des Diabetes mellitus als globale Massenerkrankung hervor. Das zweite Kapitel definiert die Disziplin der Epidemiologie und beschreibt ihre Aufgaben und Methoden. Kapitel drei gibt eine detaillierte Beschreibung des Diabetes mellitus, einschließlich seiner ätiologischen Klassifizierung, der Typen 1 und 2 sowie der Ursachen, Risiken, Diagnostik, Symptome, Komplikationen und Behandlungsmöglichkeiten. Kapitel vier betrachtet die Epidemiologie des Diabetes mellitus, insbesondere die Prävalenz, Inzidenz und die zentrale Rolle der Prävention. Kapitel fünf widmet sich den Versorgungsstrukturen und -konzepten des Diabetes mellitus, darunter Schulungen, Disease-Management-Programme und Telemedizin, mit einer genaueren Betrachtung von Telemonitoring-Programmen und dem „homecare. diabetes System“.
Schlüsselwörter
Diabetes mellitus, Epidemiologie, Prävalenz, Inzidenz, Prävention, Schulungen, Disease-Management-Programme, Telemedizin, Telemonitoring, „homecare. diabetes System“, Versorgungsstrukturen, Gesundheitsökonomie, Volkskrankheit.
- Arbeit zitieren
- Janine Bartöck (Autor:in), 2010, Zur Epidemiologie und Versorgungssituation des Diabetes mellitus, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/159478