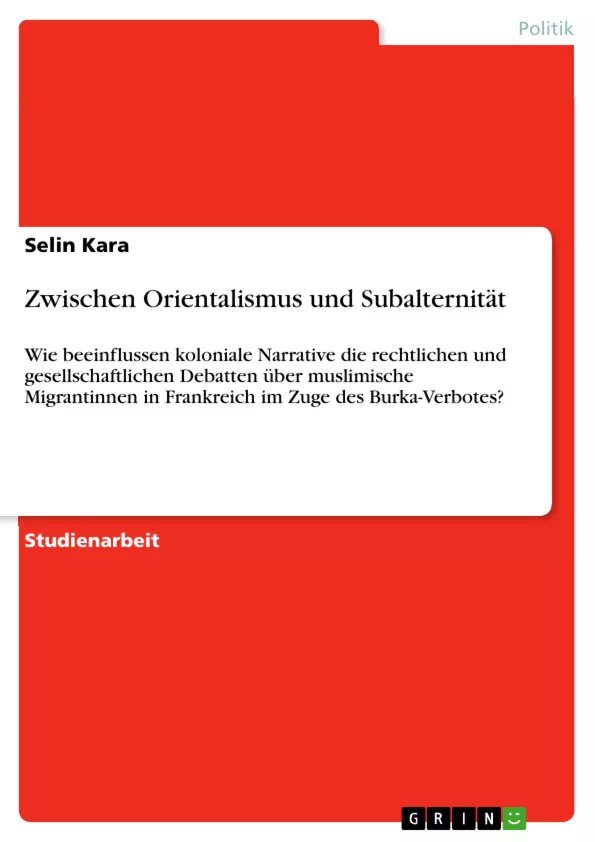Im Folgenden wird ein Forschungsdesign zum Thema Stigmatisierung von muslimischen Migrantinnen, die in Frankreich leben, ausgearbeitet. Der Fokus liegt hierbei auf migrantischen Musliminnen, die ein Kopftuch tragen und so sichtbar als muslimisch gelesen werden können. Die postkolonialen Konzepte des Orientalismus von Edward Said und der Subalternität von Gayatri Spivak werden als theoretische Basis verwendet, um zu untersuchen, wie koloniale Narrative, Machstrukturen und Ideologien in der heutigen Zeit weiterhin einen Einfluss nehmen und gesellschaftliche, politische und rechtliche Debatten über muslimische Migrantinnen prägen. Die Forschung zielt darauf ab, die tief verwurzelten kolonialen Strukturen offenzulegen, die zur Marginalisierung und Stigmatisierung muslimischer Frauen mit Migrationshintergrund beitragen, und gleichzeitig die Stimmen und Perspektiven der betroffenen Frauen in den Vordergrund stellen. Hierfür werden in Form eines Mixed-Methods-Vorgehens sowohl die Diskursanalyse als auch das Leitfadeninterview als geeignete Forschungsmethoden vorgeschlagen. Die Arbeit sieht vor, zu einem besseren Verständnis der komplexen Verflechtungen von Kolonialgeschichte, Religion und Geschlecht in europäischen Gesellschaften beizutragen, um eine inklusive und gerechte Debatte rund um Wahrnehmungen und rechtlichen Rahmenbedingungen zu fördern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand
- Theorie
- Subalternität nach Gayatri Spivak
- Orientalismus nach Edward Said
- Methodik
- Design der Erhebung
- Fall- und Materialauswahl
- Datenerhebung
- Arbeitsschritte und Plan
- Skizzierung möglicher Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Forschungsarbeit untersucht die Stigmatisierung muslimischer Migrantinnen in Frankreich, insbesondere im Kontext des Burka-Verbotes. Die Arbeit analysiert den Einfluss kolonialer Narrative auf gesellschaftliche, politische und rechtliche Debatten über diese Frauen. Das Ziel ist es, die tief verwurzelten kolonialen Strukturen aufzudecken, die zur Marginalisierung beitragen, und gleichzeitig die Perspektiven der betroffenen Frauen hervorzuheben.
- Einfluss kolonialer Narrative auf Debatten über muslimische Migrantinnen
- Analyse des Burka-Verbotes in Frankreich unter postkolonialen Gesichtspunkten
- Stigmatisierung muslimischer Frauen und deren Marginalisierung
- Anwendung postkolonialer Theorien (Orientalismus und Subalternität)
- Verwendung eines Mixed-Methods-Ansatzes (Diskursanalyse und Leitfadeninterviews)
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Forschung, ausgehend von der Debatte um das Kopftuchverbot für französische Athletinnen bei den Olympischen Spielen 2024. Sie veranschaulicht, wie das Kopftuch und der Islam ein zentrales Thema gesellschaftlicher und politischer Diskurse in Europa darstellen und wie diese Debatten tief mit kolonialem Gedankengut verwurzelt sind. Der Fokus liegt auf muslimischen Frauen nicht-autochthoner europäischer Abstammung. Die Forschungsfrage wird formuliert: Wie beeinflussen koloniale Narrative die rechtlichen und gesellschaftlichen Debatten über muslimische Migrantinnen in Frankreich im Zuge des Burka-Verbots? Ein Mixed-Methods-Design mit Diskursanalyse und Experteninterviews wird vorgestellt.
Forschungsstand: Dieses Kapitel präsentiert einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand. Es werden Arbeiten aus der Rechtswissenschaft zitiert, wie die Monographie von Raphael Cohen-Almagor, die den vielschichtigen Ansatz betont, der nötig ist, um das Burka-Verbot zu verstehen. Weiterhin werden Studien von Zempi (2019) und Valdez (2016) erwähnt, die die verschiedenen Perspektiven muslimischer Frauen auf das Verbot beleuchten. Die Arbeiten von Franklin (2013) und Fredette (2015) werden genannt, die die Verknüpfung der Debatten mit Einwanderung, Multikulturalismus und nationaler Identität thematisieren. Schließlich werden französische Diskursanalysen erwähnt, die die Medien und die Darstellung von Laizität untersuchen.
Schlüsselwörter
Muslimische Migrantinnen, Frankreich, Burka-Verbot, Kopftuch, Orientalismus, Subalternität, Kolonialismus, Postkolonialismus, Diskursanalyse, Leitfadeninterview, Stigmatisierung, Marginalisierung, Integration, Religionsfreiheit, Säkularismus, Identität, Mixed-Methods.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Forschungsarbeit?
Diese Forschungsarbeit untersucht die Stigmatisierung muslimischer Migrantinnen in Frankreich, insbesondere im Kontext des Burka-Verbotes. Die Arbeit analysiert den Einfluss kolonialer Narrative auf gesellschaftliche, politische und rechtliche Debatten über diese Frauen. Das Ziel ist es, die tief verwurzelten kolonialen Strukturen aufzudecken, die zur Marginalisierung beitragen, und gleichzeitig die Perspektiven der betroffenen Frauen hervorzuheben.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Themenschwerpunkte umfassen den Einfluss kolonialer Narrative auf Debatten über muslimische Migrantinnen, die Analyse des Burka-Verbotes in Frankreich unter postkolonialen Gesichtspunkten, die Stigmatisierung muslimischer Frauen und deren Marginalisierung, die Anwendung postkolonialer Theorien (Orientalismus und Subalternität) sowie die Verwendung eines Mixed-Methods-Ansatzes (Diskursanalyse und Leitfadeninterviews).
Welche postkolonialen Theorien werden angewendet?
Die Forschungsarbeit wird sich mit den Theorien des Orientalismus nach Edward Said und der Subalternität nach Gayatri Spivak auseinandersetzen.
Welche Methodik wird verwendet?
Es wird ein Mixed-Methods-Ansatz verwendet, der Diskursanalyse und Leitfadeninterviews kombiniert. Das Design der Erhebung, die Fall- und Materialauswahl sowie die Datenerhebung werden detailliert beschrieben.
Welche Kapitel sind in der Arbeit enthalten?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Forschungsstand, Theorie (Subalternität nach Gayatri Spivak, Orientalismus nach Edward Said), Methodik (Design der Erhebung, Fall- und Materialauswahl, Datenerhebung), Arbeitsschritte und Plan, Skizzierung möglicher Ergebnisse.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung beschreibt den Kontext der Forschung, ausgehend von der Debatte um das Kopftuchverbot für französische Athletinnen bei den Olympischen Spielen 2024. Sie veranschaulicht, wie das Kopftuch und der Islam ein zentrales Thema gesellschaftlicher und politischer Diskurse in Europa darstellen und wie diese Debatten tief mit kolonialem Gedankengut verwurzelt sind. Der Fokus liegt auf muslimischen Frauen nicht-autochthoner europäischer Abstammung. Die Forschungsfrage wird formuliert: Wie beeinflussen koloniale Narrative die rechtlichen und gesellschaftlichen Debatten über muslimische Migrantinnen in Frankreich im Zuge des Burka-Verbots? Ein Mixed-Methods-Design mit Diskursanalyse und Experteninterviews wird vorgestellt.
Welche Studien werden im Kapitel zum Forschungsstand erwähnt?
Im Kapitel zum Forschungsstand werden Arbeiten aus der Rechtswissenschaft, wie die Monographie von Raphael Cohen-Almagor, sowie Studien von Zempi (2019) und Valdez (2016) erwähnt, die verschiedene Perspektiven muslimischer Frauen auf das Burka-Verbot beleuchten. Weiterhin werden die Arbeiten von Franklin (2013) und Fredette (2015) genannt, die die Verknüpfung der Debatten mit Einwanderung, Multikulturalismus und nationaler Identität thematisieren. Schließlich werden französische Diskursanalysen erwähnt, die die Medien und die Darstellung von Laizität untersuchen.
Welche Schlüsselwörter sind mit dieser Forschungsarbeit verbunden?
Zu den Schlüsselwörtern gehören: Muslimische Migrantinnen, Frankreich, Burka-Verbot, Kopftuch, Orientalismus, Subalternität, Kolonialismus, Postkolonialismus, Diskursanalyse, Leitfadeninterview, Stigmatisierung, Marginalisierung, Integration, Religionsfreiheit, Säkularismus, Identität, Mixed-Methods.
- Quote paper
- Selin Kara (Author), 2024, Zwischen Orientalismus und Subalternität, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1594631