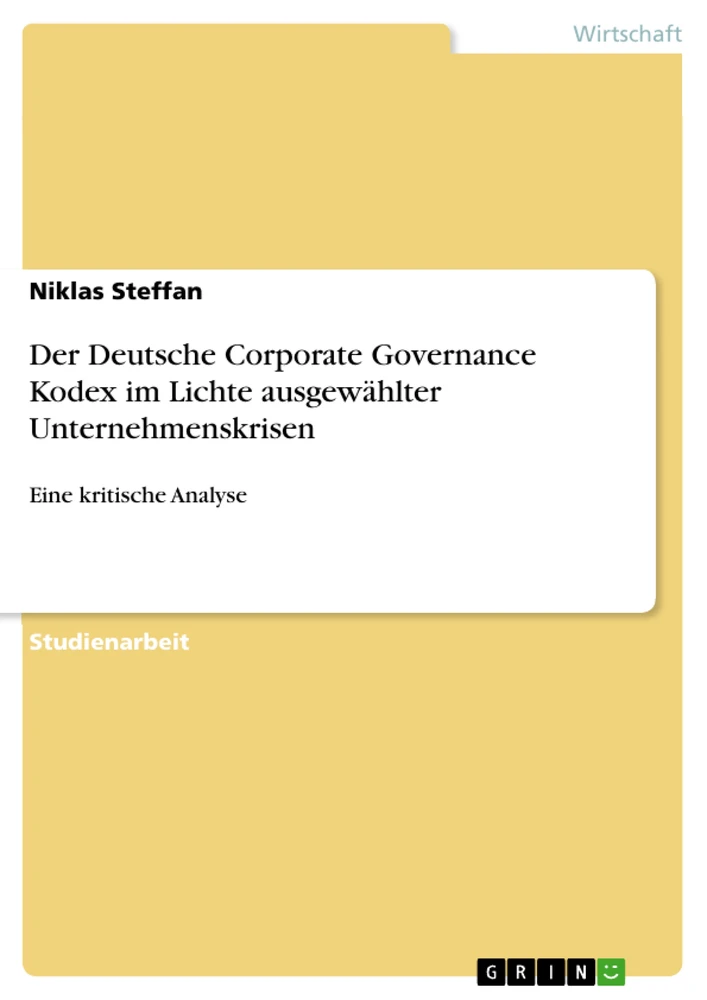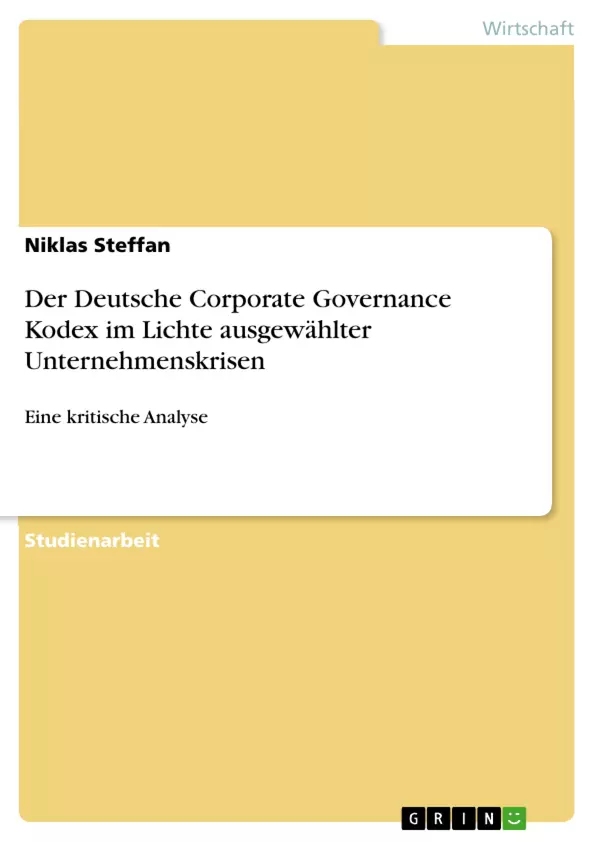Diese Arbeit analysiert den Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) im Kontext aktueller Unternehmenskrisen und beleuchtet dessen Wirksamkeit anhand des Wirecard-Skandals. Corporate Governance spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulierung von Unternehmensführung, insbesondere durch Mechanismen zur Vermeidung von Interessenkonflikten und zur Stärkung von Transparenz und Kontrolle. Der DCGK bietet börsennotierten Unternehmen einen Orientierungsrahmen zur guten Unternehmensführung, wobei das Prinzip „Comply-or-Explain“ eine flexible Anwendung erlaubt. Der Wirecard-Skandal zeigt jedoch Schwachstellen in der praktischen Umsetzung von Corporate Governance-Richtlinien, insbesondere im Bereich der Finanzaufsicht und der unternehmensinternen Kontrollmechanismen. Die Analyse verdeutlicht, dass trotz bestehender Regelwerke und Kontrollmaßnahmen erhebliche Informationsasymmetrien und Überwachungslücken bestehen. Abschließend werden Reformvorschläge zur Verbesserung des DCGK und zur Stärkung der Unternehmensaufsicht diskutiert, um zukünftige Skandale zu vermeiden und das Vertrauen in den Finanzmarkt langfristig zu sichern.
c_1
3 Wirecard – Kritische Analyse des Börsenskandals (2019-2020)
4 Zusammenfassung und kritische Bewertung
Literatur
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Interessenkonflikte in der AG - Darstellung angelehnt an (Schottmüller-Einwag), S. 18
1 Einführung
1.1 Problemstellung
Seit Mitte der 90er Jahre gewinnt Corporate Governance (CG) zunehmend an Bedeutung und ist heute ein oft diskutiertes Managementthema in Wissenschaft, Politik und Unternehmenspraxis. Die Hauptgründe hierfür sind die Globalisierung, Digitalisierung, Liberalisierung der Kapitalmärkte und zahlreiche Unternehmensskandale, die die Notwendigkeit für Grundsätze zur Sicherstellung finanzieller Stabilität und Transparenz verdeutlichen.[1]
Im Zentrum der CG-Problematik steht der Interessenkonflikt zwischen Eigentümern und Managern, besonders in börsennotierten Gesellschaften.[2] Kritik richtet sich daher oft an Aufsichtsrat und Vorstand, denen hohe Mitverantwortung für Unternehmensskandale zugeschrieben wird. Um Überwachungslücken zu schließen und das Vertrauen der Anleger wiederherzustellen, wurden indes zahlreiche Initiativen ergriffen.
Das bekannteste Beispiel ist der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK) von 2002, der die CG-Regulierung in Deutschland transparenter und verständlicher machen sollte. Angesichts vieler Unternehmenskrisen wie bei Wirecard, VW oder der DWS stellt sich jedoch die Frage, welchen Mehrwert der DCGK tatsächlich bietet und ob er die Erwartungen in der Praxis erfüllt.
Eine besonders weitreichende Unternehmenskrise erreichte ihren Höhepunkt nachdem durch die wohl bekannteste Stellungnahme eines DAX-Vorstandes das Verschwinden von 1,9 Milliarden Euro bekannt wurde. Der ehemalige CEO von Wirecard teilte im Sommer 2020 öffentlich Folgendes mit:
„Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist.“[3]
- Markus Braun (Juni, 2020)
Diese Aussage markiert den Beginn eines der größten Wirtschaftsskandale, der zugleich als spektakuläres Beispiel für das Versagen von Corporate Governance gilt. Welche Folgen hat dieser Skandal für die Zukunft der Corporate Governance in Deutschland?
1.2 Aufbau und Ziele der Arbeit
Das Ziel dieser Hausarbeit besteht darin, die Regulierungsform des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) im Kontext einer aktuellen Unternehmenskrise darzustellen und kritisch zu analysieren. Anhand des Praxisbeispiels soll untersucht werden, wie effektiv der DCGK bei der Bewältigung von Problemen und Herausforderungen in der Corporate Governance ist.
Im zweiten Kapitel werden die grundlegenden Begriffe und theoretischen Grundlagen der Corporate Governance definiert, wobei der Fokus auf börsennotierte Aktiengesellschaften (AG) liegt. Zudem werden die historische Entwicklung, der Aufbau, die wesentlichen Kritikpunkte sowie die Inhalte, Aufgaben und Ziele des DCGK erläutert. Besondere Aufmerksamkeit gilt der verpflichtenden Entsprechenserklärung der Unternehmen nach dem Comply-or-Explain-Prinzip.
Nach dieser theoretischen Einführung wird im dritten Kapitel der Wirecard-Skandal näher betrachtet. Hierbei wird zunächst der Sachverhalt der Krise beschrieben und ihre Relevanz für die Corporate Governance aufgezeigt. Es werden die Kodex-Empfehlungen und Governance-Richtlinien genannt, die Wirecard nicht befolgt hat. Abschließend werden anhand dieses Praxisbeispiels einige Defizite des DCGK aufgezeigt und mögliche Gegenmaßnahmen sowie Handlungsempfehlungen formuliert, um zukünftige Unternehmensskandale zu verhindern.
2 Grundlagen
2.1 Corporate Governance
Der Begriff der CG setzt sich aus den englischen Wörtern „Corporate“ (zum Unternehmen gehörig) und „Governance“ (Führung, Steuerung) zusammen. Durch das weitläufig hinzugedachte „good“ meint CG sodann die gute Unternehmensführung. Nach Hungenberg und Wulf (2021) zählt neben der Gestaltung der Führung auch die Einhaltung der Gesamtheit aller Vorschriften, Werte und Regeln dazu, um eine Grundordnung zu etablieren.[4] Der Begriff umfasst zudem auch noch die Unternehmensverfassung, Führungsorganisation sowie das vakante Feld der Managementvergütungssysteme.[5]
Die Problematik der CG hat international keine einheitliche Definition und wird aus verschiedenen wissenschaftlichen Theorien, insbesondere der Prinzipal-Agent (PA)-Theorie, betrachtet. Die zentrale Herausforderung liegt in der Trennung von Eigentum und Kontrolle sowie in der Lösung von Interessenkonflikten zwischen Eigentümern/Aktionären (Prinzipal) und Managern (Agent). Im Fokus stehen dabei große börsennotierte Gesellschaften, bei denen diese Trennung besonders relevant ist.
Die PA-Theorie untersucht die Auswirkungen dieser Beziehung, basierend auf Informationsasymmetrie und Interessensdivergenz, und sucht nach Wegen, diese zugunsten des Prinzipals zu gestalten. Das Menschenbild des Agenten ist opportunistisch, weshalb davon ausgegangen wird, dass er seinen Eigennutzen maximiert und nur bedingt im Interesse des Prinzipals handelt. Um diesem Zielkonflikt entgegenzuwirken, muss ein Überwachungs- und Kontrollsystem sicherstellen, dass der Agent im Sinne des Eigentümers handelt. [6]
CG kann in zwei Perspektiven unterteilt werden: Die innere Perspektive befasst sich mit den Rollen, Kompetenzen und dem Zusammenwirken der Unternehmensorgane (Vorstand, Aufsichtsrat, Hauptversammlung).[7] Ihre Aufgabe ist die Regelung der Interessenskonflikte innerhalb und zwischen diesen Organen, die in Abbildung 1 mit rotem „!“ markiert sind.

Abbildung 1: Interessenkonflikte in der AG - Darstellung angelehnt an (Schottmüller-Einwag), S. 18
Die externe Perspektive behandelt das Verhältnis der Unternehmensführung zu den Anspruchsgruppen wie Shareholdern und Stakeholdern (Arbeitnehmer, Lieferanten, Gläubiger, Gesetzgeber).[8] Gemäß der PA-Theorie soll die Corporate Governance durch geeignete Ordnungsrahmen opportunistische Handlungen des Managements und Interessenskonflikte innerhalb und außerhalb des Unternehmens verhindern.[9]
2.2 Deutscher Corporate Governance Kodex
2.2.1 Entstehung
Das deutsche Rechtssystem umfasst zahlreiche Gesetze wie das Aktiengesetz, Handelsgesetz und Wertpapierhandelsgesetz, die detailliert und abstrakt sind. Um Investoren internationale Vergleiche zu ermöglichen, wurde das System transparent dargestellt. Ein wichtiger Meilenstein war das KonTraG (1998), das Regelungen zur Erhöhung der Transparenz und zur Verbesserung der Unternehmensüberwachung einführte. Aufgrund der Krisen der 1990er Jahre wurde die Regierungskommission „Deutscher Corporate Governance Kodex“ (DCGK) eingesetzt, die 2002 den DCGK entwickelte.[10] Der Kodex wurde mehrfach überarbeitet, zuletzt 2022, um aktuellen Entwicklungen gerecht zu werden.
2.2.2 Aufbau und Ziele
Der DCGK richtet sich an börsennotierte Kapitalgesellschaften und regelt die Rechte und Pflichten von Vorständen, Aufsichtsräten und Aktionären. Die aktuelle Fassung vom 28. April 2022 umfasst neben der Präambel, die die grundlegende Funktion und Zielsetzung beschreibt, sieben aufgabenorientierte Themenkomplexe:
A. Aufgaben der Leitung und Überwachung
B. Besetzung des Vorstands
C. Zusammensetzung des Aufsichtsrats
D. Arbeitsweise des Aufsichtsrats
E. Interessenskonflikte
F. Transparenz und externe Berichterstattung
G. Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat
Diese Themenbereiche werden in Grundsätze (Muss-Vorschriften), Empfehlungen (soll) und Anregungen (sollte) unterteilt. Der Kodex ist rechtlich nicht bindend, dient aber der Transparenz und dem Vertrauen der Anleger. Eine Ausnahme bildet die Entsprechenserklärung nach § 161 AktG. Der Kodex zielt darauf ab, das deutsche CG-System zu verbessern und flexibel zu gestalten. Er wird jährlich von der Regierungskommission überprüft und angepasst.[11]
Der bis 2023 Vorsitzende der Regierungskommission DCGK fasst die Wirkungsweise treffend zusammen:
„Nicht die Befolgung der Empfehlungen, aber ihre Begründung bei Abweichung ist gesetzlich zwingend. Der Kodex setzt auf Akzeptanz ohne Zwang. Das hierin liegende Prinzip des „Comply or Explain“ räumt den Unternehmen die notwendige Flexibilität ein, um etwa branchen- oder unternehmensspezifische Bedürfnisse zu berücksichtigen, und stellt gleichzeitig die erforderliche Transparenz sicher.“[12]
- Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher
2.2.3 Entsprechenserklärung (§ 161 AktG)
Vorstand und Aufsichtsrat einer börsennotierten Gesellschaft müssen gemäß § 161 AktG jährlich offenlegen, ob sie den Empfehlungen des DCGK folgen und etwaige Abweichungen begründen. Diese Regelung, auch als Comply-or-Explain-Prinzip bekannt, erfordert, dass Unternehmen entweder die Empfehlungen befolgen oder öffentlich erklären, welche Empfehlungen nicht umgesetzt werden und warum. Hierbei wird es für erforderlich und auch für genügend angesehen, dass die Gesellschaft von ihr praktizierte Abweichungen nicht nur beschreibt, sondern argumentativ unterlegt[13]. Der Drucksache 19/26185 des Bundestages und dem Bundesgerichtshof (BGH) folgend, kommt es auf sachbezogene, rationale, am Unternehmenswohl orientierte Erwägungen an.[14] Knappe Ausführungen sind jedoch nicht ausgeschlossen.[15]
Obwohl diese Vorschrift den DCGK nicht zu geltendem Recht macht, erzeugt sie einen gewissen Handlungs- und Rechtfertigungsdruck[16] für die Unternehmen. Gleichzeitig bietet das Comply-or-Explain-Prinzip jedoch notwendige Flexibilität bei der Gestaltung der Corporate Governance. Gut begründete Abweichungen von den Kodexempfehlungen können hierbei zur Transparenz und zum Vertrauen auf dem Kapitalmarkt beitragen, was im Interesse einer guten Unternehmensführung liegt. Von den im DCGK genannten Anregungen kann hingegen ohne Offenlegung abgewichen werden.
Wird die Entsprechenserklärung nicht oder falsch abgegeben, stellt dies einen Verstoß gegen das AktG dar, der mit Buß- oder Ordnungsgeld geahndet werden kann. Zusätzlich könnte eine Verletzung der Sorgfaltspflicht gemäß § 93 AktG vorliegen. Diese Vorschrift ist besonders wichtig, da Sie potenziell zur Nichtentlastung durch die Hauptversammlung und zu Schadensersatzklagen durch die Aktionäre führen kann.
2.2.4 Kritik
Obwohl eine Auswertung von Bannier und Flach (2024) zur Einhaltung der Empfehlungen des DCGK durch die größten deutschen Unternehmen in den jährlichen Entsprechenserklärungen 2020-2023 eine robuste Steigerung der Entsprechensquoten zeigt, steht der DCGK aus verschiedenen Gründen in der Kritik.
Ein wesentlicher von Unternehmensleitungen vorgetragener Kritikpunkt ist der hohe Aufwand, der durch gestiegene CG-Anforderungen und jährliche Überarbeitungen entsteht, insbesondere bei den Entsprechenserklärungen. Viele Unternehmen argumentieren, dass die Zusatzkosten den Nutzen übersteigen, da empirische Forschung keinen Zusammenhang zwischen dem Erfüllungsgrad der DCGK-Kriterien und dem Unternehmenserfolg zeigt. Zudem kann es bei fehlerhaften Entsprechenserklärungen schnell zu rechtlichen Konsequenzen kommen, was den Kodex verbindlicher macht als ursprünglich beabsichtigt.[17]
Trotz Fortschritten bei Transparenz und Kontrolle gibt es weiterhin bedeutende Unternehmensskandale, die Zweifel an der Wirksamkeit der CG-Regulierungen aufwerfen. Ein besonders markantes Beispiel ist der Wirecard-Skandal, der weltweit für Aufsehen sorgte und die Grenzen der bestehenden Aufsichtsmechanismen aufzeigte. Dieser Skandal stellt die Effektivität der aktuellen Corporate Governance-Richtlinien infrage und verdeutlicht die Notwendigkeit weiterer Reformen. Das nächste Kapitel untersucht den Wirecard-Skandal und dessen Bezug zum DCGK, um herauszufinden, welche Lehren gezogen werden können und welche Anpassungen notwendig sind, um zukünftige Vorfälle zu verhindern.
- Arbeit zitieren
- Niklas Steffan (Autor:in), 2024, Der Deutsche Corporate Governance Kodex im Lichte ausgewählter Unternehmenskrisen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1592085