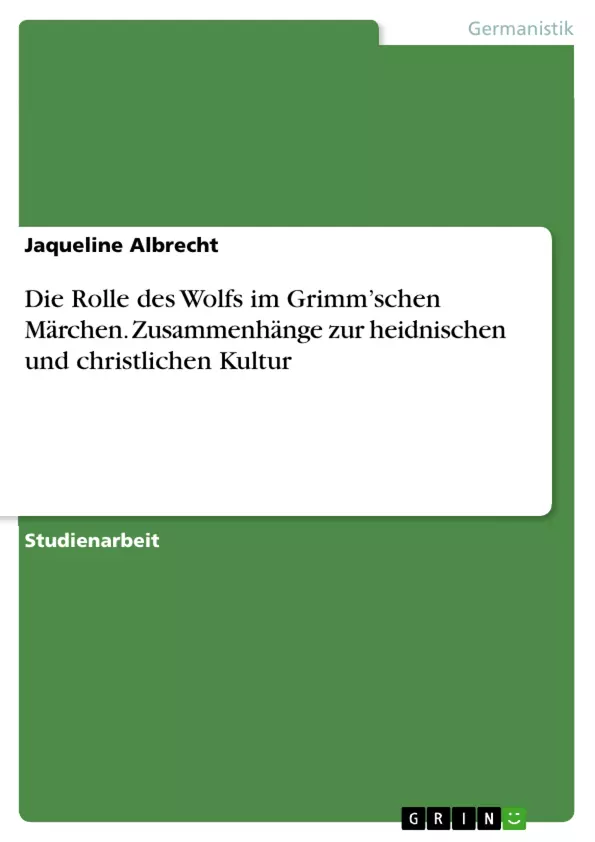Diese Arbeit untersucht die Rolle des Wolfs im Spannungsfeld von germanischer Mythologie, christlicher Symbolik und den Märchen der Brüder Grimm. Anhand ausgewählter mythologischer Figuren sowie biblischer Metaphern wird die kulturelle Bedeutung des Wolfs als Symbol für Stärke, Zerstörung und moralische Grenzfigur analysiert. Im Zentrum steht die Frage, wie sich diese Bedeutungen in den Grimm’schen Märchen widerspiegeln – als Antagonist, Opfer oder Helfer. Ziel ist es, die Wolfsfigur als vielschichtige Projektionsfläche zwischen Natur, Religion und Literatur sichtbar zu machen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Charakter des Wolfs
- 3. Heidentum
- 3.1 Wolfsbild in heidnischen Kulturen
- 3.1.1 Der Wolf als gefürchtetes Tier
- 3.1.2 Der Wolf als ebenbürtiger Jäger
- 3.1.3 Der Wolf als Symbol für Stärke
- 3.2 Bedeutung des Wolfs in der deutschen Mythologie
- 3.2.1 Werwölfe
- 3.2.2 Sköll und Hati
- 3.2.3 Der Fenriswolf
- 3.2.4 Geri und Freki
- 3.3 Fazit
- 3.1 Wolfsbild in heidnischen Kulturen
- 4. Christentum
- 4.1 Wolfsbild in der Bibel
- 4.2 Bedeutung des Wolfs als teuflisches Tier
- 4.3 Fazit
- 5. Der Wolf in den Märchen der Brüder Grimm
- 5.1 Ursprung und Entstehung der Märchen
- 5.2 Wolfsbild im Märchen
- 5.2.1 Der Wolf als Antagonist
- 5.2.2 Der Wolf als Opfer
- 5.2.3 Der Wolf als Helfer
- 5.3 Zusammenhangsanalyse
- 5.3.1 Heidnische Kultur und Religion
- 5.3.2 Christliche Kultur und Religion
- 6. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung des Wolfs in Märchen der Brüder Grimm im Kontext von heidnischer und christlicher Kultur. Ziel ist es, die unterschiedlichen Rollen des Wolfs in diesen kulturellen Kontexten zu beleuchten und deren Einfluss auf die Märchenfiguren zu analysieren. Die Arbeit fragt nach dem Verhältnis der Wolfsfigur zum Heidentum und Christentum und untersucht, inwieweit diese Einflüsse in die Märchen eingeflossen sind.
- Der Wandel des Wolfsbildes von der heidnischen zur christlichen Zeit
- Die ambivalenten Rollen des Wolfs in der Mythologie (gefürchtet und respektiert)
- Der Einfluss heidnischer und christlicher Vorstellungen auf die Märchen der Brüder Grimm
- Die Funktion des Wolfs als Antagonist, Opfer und Helfer in den Märchen
- Der Vergleich der Wolfsdarstellung in der Mythologie und den Märchen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein, indem sie den Wiedereinzug des Wolfs in den deutschen Lebensraum und seine ambivalente Rolle in Märchen – sowohl als Bösewicht als auch als Helfer – beschreibt. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Einfluss heidnischer und christlicher Vorstellungen auf die Wolfsdarstellung in den Märchen der Brüder Grimm und skizziert den Aufbau der Arbeit.
2. Charakter des Wolfs: Dieses Kapitel beleuchtet den Charakter des Wolfs, indem es seine biologischen Eigenschaften und die damit verbundene historische Wahrnehmung beschreibt. Es analysiert die negative Konnotation des Wortes "Wolf" in verschiedenen Sprachen und geht auf die historischen Wolfsjagden und deren Ursachen ein. Die Mischung aus rationalen (Schaden am Vieh) und irrationalen (teuflisches Tier) Gründen für die Ausrottung wird herausgestellt und auf die folgenden Kapitel verwiesen, in denen diese irrationalen Zuschreibungen näher untersucht werden.
3. Heidentum: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Wolfsbild in verschiedenen heidnischen Kulturen. Es wird betont, dass Tiere in diesen Kulturen eine bedeutende Rolle spielten, sowohl im Alltag als auch in Mythen. Der Wolf wird als ambivalentes Symbol dargestellt: einerseits gefürchtet wegen seiner Gefährlichkeit, andererseits respektiert als ebenbürtiger Jäger und sogar als Namensgeber. Die unterschiedlichen Deutungen in verschiedenen Mythologien (indisch, ägyptisch, griechisch, germanisch) werden skizziert, wobei der Fokus auf der germanischen Mythologie liegt.
4. Christentum: Im Gegensatz zum Kapitel über das Heidentum wird hier die christliche Sichtweise auf den Wolf betrachtet. Das Kapitel analysiert das Wolfsbild in der Bibel und die Entwicklung des Wolfs zum Symbol des Teufels im christlichen Kontext. Der Vergleich zum heidnischen Wolfsbild verdeutlicht die gegensätzlichen Perspektiven beider Religionen auf das Tier.
5. Der Wolf in den Märchen der Brüder Grimm: Das Herzstück der Arbeit analysiert die Rolle des Wolfs in ausgewählten Märchen der Brüder Grimm. Es untersucht die verschiedenen Funktionen, die der Wolf in den Erzählungen einnimmt – als Antagonist, Opfer und Helfer – und analysiert den Zusammenhang zwischen diesen Rollen und den heidnischen sowie christlichen Traditionen. Die Kapitel untersuchen den Einfluss dieser Traditionen auf die Gestaltung der Wolfsfiguren in den Märchen.
Schlüsselwörter
Wolf, Märchen der Brüder Grimm, Heidentum, Germanische Mythologie, Christentum, Symbol, Antagonist, Opfer, Helfer, ambivalent, negative Konnotation, religiöse Interpretation, Volkskunde.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Dokuments "Sprachvorschau"?
Das Dokument ist eine Sprachvorschau, die eine Inhaltsangabe, Zielsetzungen, Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter zu einer wissenschaftlichen Arbeit enthält.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht die Darstellung des Wolfs in Märchen der Brüder Grimm im Kontext von heidnischer und christlicher Kultur.
Welche sind die Hauptziele der Arbeit?
Ziel ist es, die unterschiedlichen Rollen des Wolfs in heidnischen und christlichen Kontexten zu beleuchten und deren Einfluss auf die Märchenfiguren zu analysieren. Außerdem wird nach dem Verhältnis der Wolfsfigur zum Heidentum und Christentum gefragt und untersucht, inwieweit diese Einflüsse in die Märchen eingeflossen sind.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf den Wandel des Wolfsbildes von der heidnischen zur christlichen Zeit, die ambivalenten Rollen des Wolfs in der Mythologie, den Einfluss heidnischer und christlicher Vorstellungen auf die Märchen der Brüder Grimm, die Funktion des Wolfs als Antagonist, Opfer und Helfer in den Märchen sowie den Vergleich der Wolfsdarstellung in der Mythologie und den Märchen.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Charakter des Wolfs, Heidentum, Christentum, Der Wolf in den Märchen der Brüder Grimm und Schluss.
Was wird im Kapitel "Heidentum" behandelt?
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Wolfsbild in verschiedenen heidnischen Kulturen. Es wird betont, dass Tiere in diesen Kulturen eine bedeutende Rolle spielten, sowohl im Alltag als auch in Mythen. Der Wolf wird als ambivalentes Symbol dargestellt, einerseits gefürchtet, andererseits respektiert.
Was wird im Kapitel "Christentum" behandelt?
Dieses Kapitel betrachtet die christliche Sichtweise auf den Wolf. Es analysiert das Wolfsbild in der Bibel und die Entwicklung des Wolfs zum Symbol des Teufels im christlichen Kontext.
Was wird im Kapitel "Der Wolf in den Märchen der Brüder Grimm" analysiert?
Dieses Kapitel analysiert die Rolle des Wolfs in ausgewählten Märchen der Brüder Grimm. Es untersucht die verschiedenen Funktionen, die der Wolf in den Erzählungen einnimmt – als Antagonist, Opfer und Helfer – und analysiert den Zusammenhang zwischen diesen Rollen und den heidnischen sowie christlichen Traditionen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Relevante Schlüsselwörter sind: Wolf, Märchen der Brüder Grimm, Heidentum, Germanische Mythologie, Christentum, Symbol, Antagonist, Opfer, Helfer, ambivalent, negative Konnotation, religiöse Interpretation, Volkskunde.
- Arbeit zitieren
- Jaqueline Albrecht (Autor:in), 2018, Die Rolle des Wolfs im Grimm’schen Märchen. Zusammenhänge zur heidnischen und christlichen Kultur, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1591596