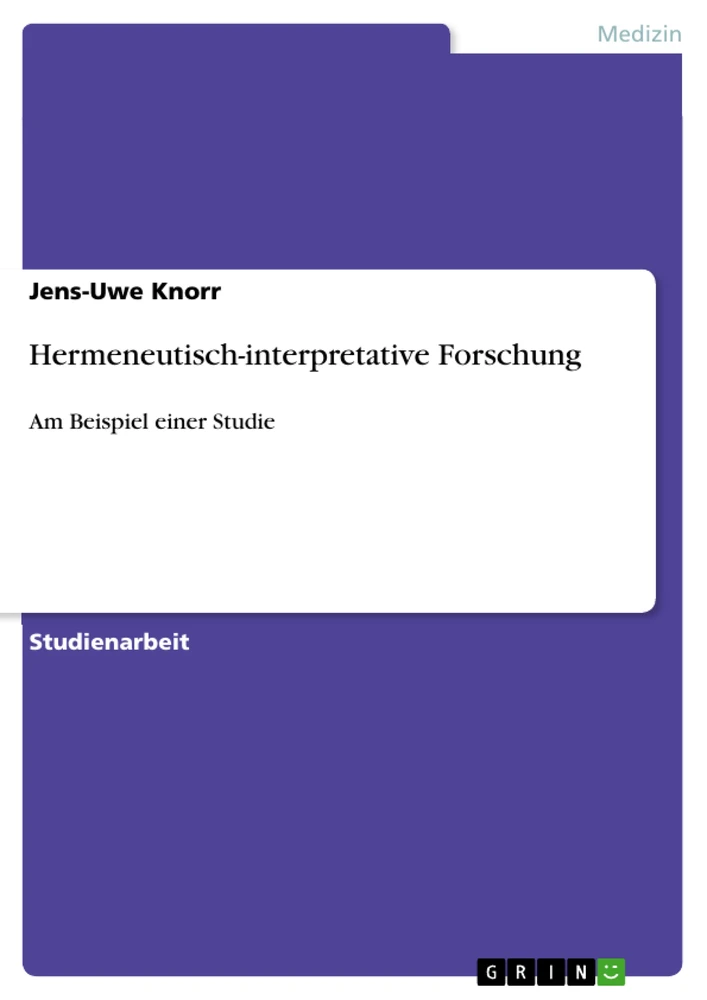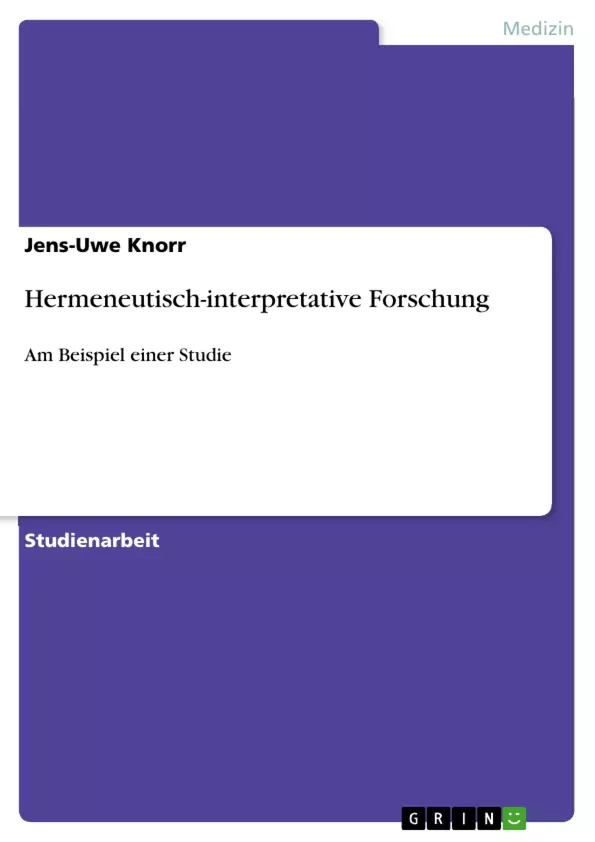In der vorliegenden Arbeit werden hermeneutisch-interpretative Methoden vorgestellt. Eine ausgewählte qualitative Studie zur Adipositasprävention wird kritisch beurteilt.
Inhaltsverzeichnis
- Theoretischer Rahmen
- Hermeneutik
- Phänomenologie
- Ethnographie
- Grounded Theory
- Studienbeispiel
- Recherche
- Studienziel/Fragestellung
- Stichprobe
- Methoden
- Ergebnisse
- Zusammenfassung
- Beurteilung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht hermeneutisch-interpretative Forschungsmethoden anhand eines konkreten Studienbeispiels. Ziel ist es, die Anwendung und Relevanz verschiedener qualitativer Forschungsansätze in der Pflegewissenschaft zu veranschaulichen.
- Qualitative Forschungsmethoden in der Pflegewissenschaft
- Anwendung der Hermeneutik, Phänomenologie, Ethnographie und Grounded Theory
- Analyse eines Studienbeispiels unter Berücksichtigung der gewählten Methodik
- Vergleichende Betrachtung verschiedener qualitativer Forschungsansätze
- Reflexion der Bedeutung des Kontextes in der qualitativen Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
Theoretischer Rahmen: Dieses Kapitel legt den methodologischen Grundstein der Arbeit, indem es die vier zentralen Methoden der qualitativen Forschung – Hermeneutik, Phänomenologie, Ethnographie und Grounded Theory – detailliert beschreibt. Es wird hervorgehoben, dass diese Methoden nicht in ihrem vollen Umfang behandelt werden können, aber dennoch ein umfassendes Verständnis der jeweiligen Ansätze bieten. Der Fokus liegt auf der Erklärung der jeweiligen epistemologischen Grundlagen und methodischen Vorgehensweisen, um die spätere Analyse des Studienbeispiels zu kontextualisieren. Die gegenseitige Bedingtheit und der Unterschied zwischen latenten und manifesten Sinn werden diskutiert. Die Abbildung 1 illustriert die Auswahl der Methoden und ihren Bezug zum Forschungsprozess.
Studienbeispiel: Dieser Abschnitt befasst sich mit der Präsentation und Analyse eines konkreten empirischen Studienbeispiels, welches die Anwendung und den Nutzen der im vorherigen Kapitel vorgestellten Methoden veranschaulicht. Es umfasst die Recherche, die Formulierung der Forschungsfrage, die Beschreibung der Stichprobe und der angewendeten Methoden sowie die Darstellung der Ergebnisse. Der Abschnitt soll die praktische Umsetzung der theoretischen Konzepte demonstrieren und die Stärken und Schwächen der jeweiligen Methoden im konkreten Anwendungsfall hervorheben, ohne jedoch die konkreten Ergebnisse im Detail zu präsentieren.
Schlüsselwörter
Hermeneutik, Phänomenologie, Ethnographie, Grounded Theory, Qualitative Forschung, Pflegewissenschaft, Studienbeispiel, Methodenvergleich, Interpretative Forschung, Kontextualisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Qualitative Forschungsmethoden in der Pflegewissenschaft
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit bietet einen umfassenden Überblick über qualitative Forschungsmethoden in der Pflegewissenschaft. Sie beinhaltet einen theoretischen Rahmen, der Hermeneutik, Phänomenologie, Ethnographie und Grounded Theory detailliert beschreibt. Ein konkretes Studienbeispiel veranschaulicht die Anwendung dieser Methoden und ermöglicht einen Vergleich ihrer Stärken und Schwächen. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlüsselbegriffen.
Welche Forschungsmethoden werden behandelt?
Die Hausarbeit konzentriert sich auf vier zentrale qualitative Forschungsmethoden: Hermeneutik, Phänomenologie, Ethnographie und Grounded Theory. Es wird deren epistemologische Grundlagen und methodische Vorgehensweisen erklärt und ihre Anwendbarkeit in der Pflegewissenschaft anhand eines Studienbeispiels demonstriert.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen Rahmen, der die vier genannten Forschungsmethoden einführt, gefolgt von einem detaillierten Studienbeispiel, das deren Anwendung in der Praxis veranschaulicht. Die Struktur umfasst ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter.
Was ist das Ziel der Hausarbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Anwendung und Relevanz verschiedener qualitativer Forschungsansätze in der Pflegewissenschaft zu veranschaulichen. Sie soll ein Verständnis für die methodischen Vorgehensweisen und die Interpretation der Ergebnisse vermitteln.
Welchen Stellenwert hat das Studienbeispiel?
Das Studienbeispiel dient als praktisches Anwendungsbeispiel für die im theoretischen Rahmen vorgestellten Methoden. Es zeigt die konkrete Umsetzung der theoretischen Konzepte und ermöglicht eine Analyse der Stärken und Schwächen der jeweiligen Methoden im praktischen Kontext. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die konkreten Ergebnisse nicht detailliert präsentiert werden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Hausarbeit?
Schlüsselwörter zur Beschreibung des Inhalts sind: Hermeneutik, Phänomenologie, Ethnographie, Grounded Theory, Qualitative Forschung, Pflegewissenschaft, Studienbeispiel, Methodenvergleich, Interpretative Forschung, Kontextualisierung.
Wird der theoretische Rahmen detailliert beschrieben?
Ja, der theoretische Rahmen beschreibt detailliert die epistemologischen Grundlagen und methodischen Vorgehensweisen der Hermeneutik, Phänomenologie, Ethnographie und Grounded Theory. Es wird betont, dass nicht alle Aspekte der Methoden vollständig behandelt werden können, aber ein umfassendes Verständnis vermittelt wird. Die gegenseitige Bedingtheit und der Unterschied zwischen latenten und manifesten Sinn werden diskutiert.
- Arbeit zitieren
- Jens-Uwe Knorr (Autor:in), 2010, Hermeneutisch-interpretative Forschung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/158977