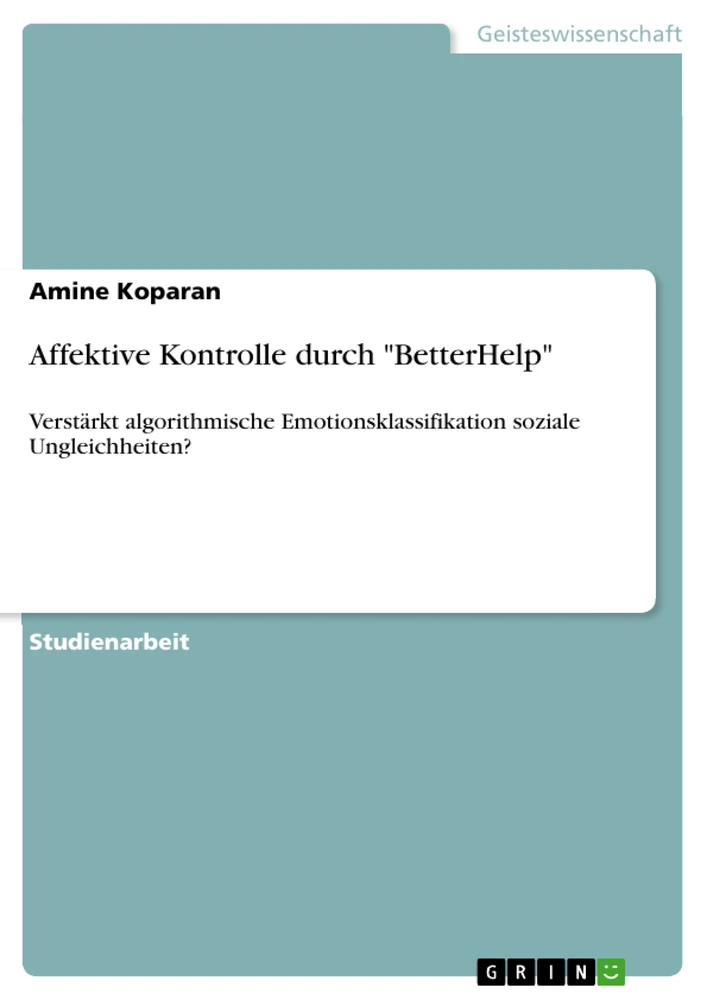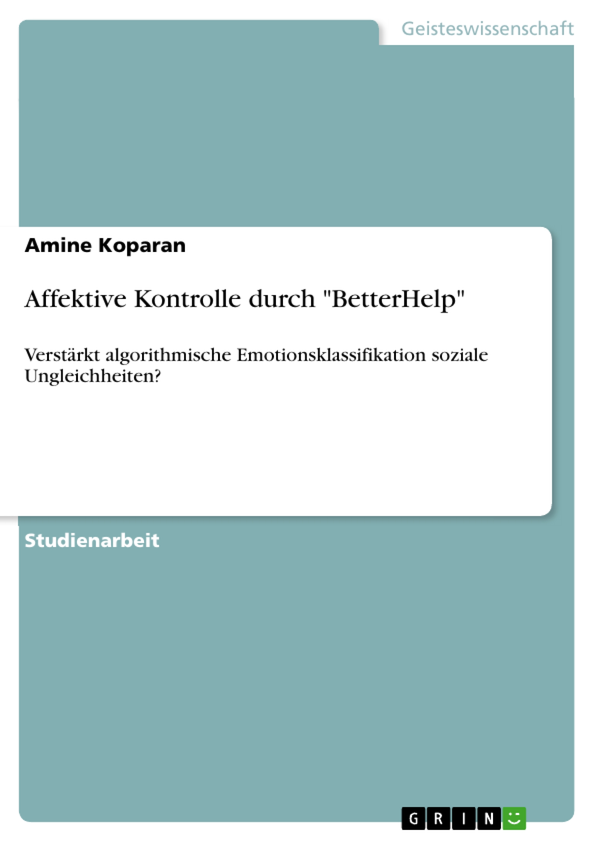Die Hausarbeit analysiert, wie digitale Therapieplattformen wie "BetterHelp" durch algorithmische Emotionsklassifikation affektive Zustände erfassen, normieren und kommerzialisieren. Ausgehend von Theorien von Sara Ahmed (affektive Ökonomien) und Arlie Hochschild (Emotion Work) wird untersucht, wie Emotionen im digitalen Raum entlang neoliberaler, rassistischer und ableistischer Normen standardisiert werden. Die Fallanalyse von "BetterHelp" beleuchtet unter anderem den Datenskandal 2023 und die algorithmisch gesteuerte Therapiezuweisung, die soziale Ungleichheiten verstärken kann. Die Arbeit zeigt, dass "BetterHelp" nicht nur therapeutische Unterstützung bietet, sondern auch als Werkzeug affektiver Kontrolle fungiert. Abschließend plädiert sie für regulative und emanzipatorische Alternativen, die emotionale Vielfalt respektieren und strukturelle Ungleichheiten berücksichtigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Rahmen
- 2.1 Affekte nach Sara Ahmed
- 2.2 Emotion Work nach Arlie Hochschild
- 2.3 Vergleich der Theorien
- 3. Analyse: Fallbeispiel BetterHelp
- 3.1 Funktionsweise von BetterHelp und der Datenskandal 2023
- 3.2 Algorithmische Emotionsklassifikation und ihre Folgen
- 3.3 Affektive Bindung an digitale Therapieplattformen
- 3.4 Intersektionale Perspektiven
- 4. Diskussion – Digitale Therapie zwischen Innovation und Machtausübung
- 4.1 Die Hybrid-Version als ideales Modell
- 5. Zukunftsperspektiven und Alternativen
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen algorithmischer Emotionsklassifikation auf soziale Ungleichheiten, anhand des Fallbeispiels BetterHelp. Ziel ist es aufzuzeigen, wie digitale Therapieplattformen Emotionen nicht nur erfassen, sondern auch normieren und ökonomisieren, wodurch bestehende soziale Hierarchien reproduziert werden können.
- Algorithmische Emotionsklassifikation und ihre Folgen
- Affektive Bindung an digitale Therapieplattformen
- Soziale Ungleichheiten und ihre Reproduktion durch digitale Technologien
- Machtstrukturen und normative Kontrolle in der digitalen Gesundheitsversorgung
- Intersektionale Perspektiven auf die Digitalisierung psychischer Gesundheit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Digitalisierung der psychischen Gesundheitsversorgung und deren Auswirkungen auf die gesellschaftliche Regulierung von Emotionen ein. Sie präsentiert die zentrale These, dass Plattformen wie BetterHelp, trotz des Anscheins inklusiver Lösungen, Machtmechanismen bergen, die emotionale Autonomie beschneiden und soziale Ungleichheiten reproduzieren. Die Arbeit untersucht, wie BetterHelp durch algorithmische Emotionsklassifikation Affekte normiert und ökonomisiert, und hinterfragt, ob diese Prozesse soziale Ungleichheiten verstärken anstatt zu reduzieren. Die methodische Vorgehensweise, die auf einer Kombination aus Affect Studies und kritischer Techniksoziologie basiert, wird ebenfalls skizziert.
2. Theoretischer Rahmen: Dieses Kapitel legt den interdisziplinären theoretischen Rahmen der Arbeit dar, der Ansätze der Affekt- und Emotionstheorie mit einer kritischen Analyse digitaler Technologien verbindet. Es werden die Konzepte von Sara Ahmed (affektive Ökonomien), Arlie Hochschild (Emotion Work), Mimi Sheller (automotive emotions) und Shoshana Zuboff (Überwachungskapitalismus) vorgestellt und deren Relevanz für die Analyse von BetterHelp erläutert. Die Kapitel beschreibt, wie diese Theorien helfen zu verstehen, wie Emotionen in digitalen Kontexten verarbeitet und entlang hegemonialer Normen geformt werden, und wie Nutzer*innen affektiv an technologische Infrastrukturen gebunden werden.
3. Analyse: Fallbeispiel BetterHelp: Dieses Kapitel analysiert die Funktionsweise von BetterHelp und den Datenskandal von 2023. Es untersucht die algorithmische Emotionsklassifikation und deren Folgen, insbesondere die affektive Bindung an die Plattform. Ein wichtiger Aspekt ist die Betrachtung intersektioneller Perspektiven, um die Auswirkungen auf verschiedene marginalisierte Gruppen zu beleuchten. Die Analyse zeigt auf, wie BetterHelp Emotionen in Kategorien übersetzt und von ihren strukturellen Ursachen entkoppelt, was zu einer individuellen Optimierungsaufgabe umfunktioniert wird.
4. Diskussion – Digitale Therapie zwischen Innovation und Machtausübung: Die Diskussion reflektiert die Ergebnisse der Analyse von BetterHelp und bewertet die Ambivalenz digitaler Therapieplattformen. Es wird beleuchtet, wie algorithmische Klassifizierungen nicht nur individuelle Therapieerfahrungen beeinflussen, sondern auch gesellschaftliche Auswirkungen haben, indem sie bestehende soziale Hierarchien reproduzieren. Es werden die Implikationen für digitale Gesundheitsplattformen erörtert, insbesondere die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung und die Einbindung marginalisierter Perspektiven, um soziale Ungleichheiten nicht zu zementieren.
5. Zukunftsperspektiven und Alternativen: (Diese Zusammenfassung kann aufgrund der fehlenden Informationen im Text nur spekulativ sein und soll daher weggelassen werden)
Schlüsselwörter
Algorithmische Emotionsklassifikation, BetterHelp, Affektökonomien, Emotion Work, soziale Ungleichheiten, digitale Therapie, Überwachungskapitalismus, intersektionale Perspektiven, digitale Gesundheitsversorgung, normative Kontrolle.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit über BetterHelp?
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der algorithmischen Emotionsklassifikation auf soziale Ungleichheiten am Beispiel von BetterHelp. Sie zielt darauf ab, aufzuzeigen, wie digitale Therapieplattformen Emotionen nicht nur erfassen, sondern auch normieren und ökonomisieren, wodurch bestehende soziale Hierarchien reproduziert werden können.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Arbeit behandelt?
Die Themenschwerpunkte umfassen algorithmische Emotionsklassifikation und ihre Folgen, affektive Bindung an digitale Therapieplattformen, soziale Ungleichheiten und ihre Reproduktion durch digitale Technologien, Machtstrukturen und normative Kontrolle in der digitalen Gesundheitsversorgung sowie intersektionale Perspektiven auf die Digitalisierung psychischer Gesundheit.
Was ist das zentrale Argument der Einleitung?
Die Einleitung argumentiert, dass Plattformen wie BetterHelp, trotz des Anscheins inklusiver Lösungen, Machtmechanismen bergen, die emotionale Autonomie beschneiden und soziale Ungleichheiten reproduzieren. Die Arbeit untersucht, wie BetterHelp durch algorithmische Emotionsklassifikation Affekte normiert und ökonomisiert, und hinterfragt, ob diese Prozesse soziale Ungleichheiten verstärken anstatt zu reduzieren.
Welche theoretischen Rahmen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf einen interdisziplinären theoretischen Rahmen, der Ansätze der Affekt- und Emotionstheorie mit einer kritischen Analyse digitaler Technologien verbindet. Es werden Konzepte von Sara Ahmed (affektive Ökonomien), Arlie Hochschild (Emotion Work), Mimi Sheller (automotive emotions) und Shoshana Zuboff (Überwachungskapitalismus) vorgestellt.
Was wird im Kapitel zur Analyse von BetterHelp untersucht?
Das Kapitel analysiert die Funktionsweise von BetterHelp und den Datenskandal von 2023. Es untersucht die algorithmische Emotionsklassifikation und deren Folgen, insbesondere die affektive Bindung an die Plattform, und betrachtet intersektionelle Perspektiven, um die Auswirkungen auf verschiedene marginalisierte Gruppen zu beleuchten.
Was ist das Ergebnis der Diskussion über digitale Therapie?
Die Diskussion reflektiert die Ergebnisse der Analyse von BetterHelp und bewertet die Ambivalenz digitaler Therapieplattformen. Es wird beleuchtet, wie algorithmische Klassifizierungen nicht nur individuelle Therapieerfahrungen beeinflussen, sondern auch gesellschaftliche Auswirkungen haben, indem sie bestehende soziale Hierarchien reproduzieren. Es werden die Implikationen für digitale Gesundheitsplattformen erörtert, insbesondere die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung und die Einbindung marginalisierter Perspektiven, um soziale Ungleichheiten nicht zu zementieren.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Relevante Schlüsselwörter sind: Algorithmische Emotionsklassifikation, BetterHelp, Affektökonomien, Emotion Work, soziale Ungleichheiten, digitale Therapie, Überwachungskapitalismus, intersektionale Perspektiven, digitale Gesundheitsversorgung, normative Kontrolle.
- Quote paper
- Amine Koparan (Author), 2025, Affektive Kontrolle durch "BetterHelp", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1589640