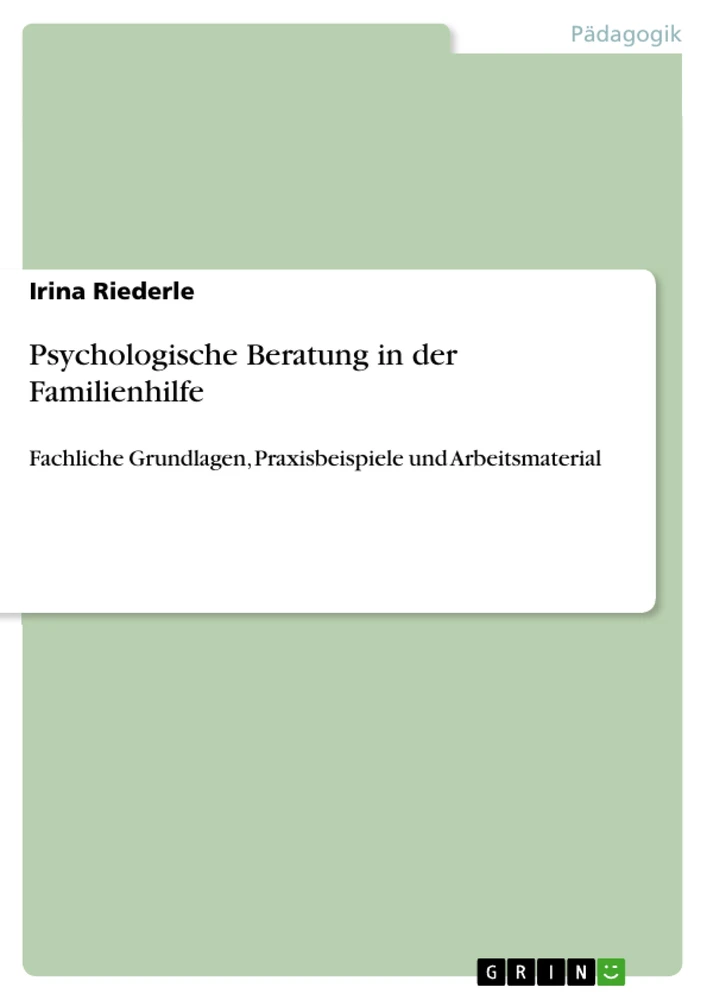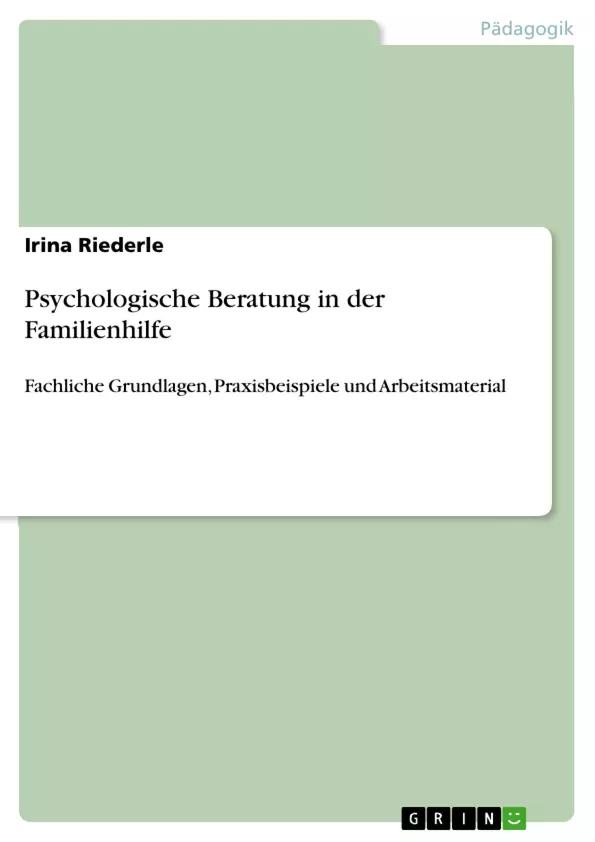„Psychologische Beratung in der ambulanten Familienhilfe“ verbindet wissenschaftliche Grundlagen mit praxisnahen Methoden für Fachkräfte der Sozialen Arbeit, Jugendhilfe und Beratung. Das Buch bietet:
Theoretische Fundierung: Klare Abgrenzung zu Therapie und Coaching, systemische Ansätze (Schlippe & Schweitzer), rechtliche Rahmenbedingungen (SGB VIII, Kindeswohl).
Praktische Tools: Bewährte Methoden wie Genogramm, Wunderfrage, Ressourcenarbeit und Krisenintervention – direkt anwendbar im Familienalltag.
Fallbeispiele & Reflexion: Konkrete Anwendungen aus der Praxis (z. B. Eltern-Kind-Konflikte, Trennung, Erziehungsfragen) mit Analyse der Wirksamkeit.
Checklisten & Vorlagen: Sofort einsetzbare Materialien für Dokumentation, Zielvereinbarungen und Selbstreflexion der Berater:innen.
Ein unverzichtbarer Leitfaden für alle, die Familien in schwierigen Lebenslagen professionell, empathisch und lösungsorientiert begleiten möchten.
2. Begriffsbestimmungen und Grundlagen
3. Das Setting in der ambulanten Familienhilfe
4. Methoden der psychologischen Beratung in der Familienhilfe
5. Anwendungsbeispiele aus der Praxis
5.1 Fallbeispiel 1: Eltern-Kind-Konflikte
5.2 Fallbeispiel 2: Beratung bei Trennung und Scheidung
5.3 Fallbeispiel 3: Unterstützung bei Erziehungsfragen
5.4 Reflexion der Methodenwirksamkeit
6. Fazit und Ausblick
7. Literaturverzeichnis
8. Anlagen
8.1 Methodenkatalog
8.2 Checklisten für die Beratungspraxis
8.2.1 Checkliste für Erstkontakte
8.2.2 Reflexionsbogen zur eigenen Haltung
8.3 Dokumentationsvorlagen
8.3.1 Vorlage für Fallverläufe (Kurzfassung)
8.3.2 Zielvereinbarungsformular mit Familien
8.3.3 Feedbackbogen für Familien
9. Abschließende Worte
1. Einführung
Die ambulante Familienhilfe steht aktuell vor vielfältigen und wachsenden Herausforderungen. So zeigen Daten des Statistischen Bundesamts (2023), dass die Zahl der Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII) seit 2015 um 12 % gestiegen ist. Diese Zunahme ist häufig auf psychosoziale Mehrfachbelastungen innerhalb der Familien zurückzuführen.
Ein weiterer zentraler Faktor ist die psychische Gesundheit der Eltern: Studien belegen, dass etwa 30 % der Eltern, die ambulante Familienhilfe in Anspruch nehmen, klinisch relevante Belastungen wie Depressionen aufweisen (Klasen et al., 2021). Darüber hinaus sind häufig komplexe systemische Verstrickungen vorhanden, die sich aus sozialen Problemlagen wie Armut oder Migration ergeben. Diese erfordern interdisziplinäre und multiprofessionelle Ansätze, um den Familien umfassend gerecht zu werden (BMFSFJ, 2020).
Neu hinzugekommen ist der Einfluss der Digitalisierung: Teleberatung gewinnt zunehmend an Bedeutung, insbesondere um auch Familien in ländlichen Regionen niedrigschwellig zu erreichen und flexible Beratungsangebote zu ermöglichen (Witte & Lohaus, 2021).
Im Vergleich zu klinischen Therapieformen zeichnet sich die psychologische Beratung in der ambulanten Familienhilfe durch eine niedrigschwellige, alltagsnahe und ressourcenorientierte Ausrichtung aus. Sie zielt darauf ab, Familien in ihrer Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung zu stärken und Entwicklungsprozesse anzustoßen. Gerade in multiprofessionellen Settings, an der Schnittstelle von Sozialarbeit, Erziehungsberatung und psychologischen Methoden, fungiert psychologische Beratung als Brücke zwischen emotionaler Unterstützung und struktureller Hilfeleistung (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019).
1.2 Zielsetzung und Aufbau des Buches
Dieses Fachbuch verfolgt das Ziel, eine praxisnahe Brücke zwischen Theorie und Anwendung der psychologischen Beratung in der ambulanten Familienhilfe zu schlagen. Es verbindet wissenschaftliche Grundlagen, etwa systemische Theorien nach Schlippe und Schweitzer (2022), mit konkreten Methoden und Instrumenten wie der „Wunderfrage“.
Die Zielgruppe sind insbesondere Sozialpädagoginnen, Beraterinnen und Studierende der Sozialen Arbeit, die ihre beraterischen Kompetenzen erweitern und praxisorientiert vertiefen möchten.
Das Buch gliedert sich wie folgt: Kapitel 2 erläutert zentrale Begriffe und theoretische Grundlagen. Kapitel 3 widmet sich dem spezifischen Setting der ambulanten Familienhilfe sowie den institutionellen und multiprofessionellen Rahmenbedingungen. Kapitel 4 stellt bewährte Methoden der psychologischen Beratung vor, die sich in der Praxis bewährt haben. Praxisnahe Fallbeispiele in Kapitel 5 illustrieren typische Anwendungsfelder. Kapitel 6 fasst zentrale Erkenntnisse zusammen, reflektiert Grenzen der psychologischen Beratung im ambulanten Kontext und bietet einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
2. Begriffsbestimmungen und Grundlagen
2.1 Definition: Psychologische Beratung
Psychologische Beratung ist ein professionelles Unterstützungsangebot, das auf psychologischen Erkenntnissen und Methoden basiert. Sie begleitet Menschen in belastenden Lebenssituationen, fördert ihre Problemlösungsfähigkeit und trägt zur Stabilisierung ihrer psychischen Gesundheit bei (Hossiep & Frieg, 2017).
Im Unterschied zur Psychotherapie richtet sich psychologische Beratung an Personen, die sich in schwierigen, aber nicht pathologischen Lebenslagen befinden. Sie umfasst Interventionen zur Entscheidungsfindung, Konfliktbewältigung, Emotionsregulation und Perspektivenerweiterung (Wottawa & Thierau, 2018).
Eine wichtige Abgrenzung besteht zur „psychosozialen Beratung“ nach Nestmann (2017), die stärker lebensweltlich orientiert ist und auf alltagspraktische Unterstützung abzielt. Demgegenüber betonen Bensberg und Walter (2017) die „Hilfe zur Selbsthilfe“ als zentrales Merkmal der psychologischen Beratung, womit deren präventive und ressourcenorientierte Ausrichtung unterstrichen wird.
2.2 Abgrenzung zu Therapie, Coaching und Sozialer Arbeit
Eine klare Abgrenzung zu benachbarten Disziplinen ist essenziell:
Psychotherapie fokussiert die Behandlung psychischer Störungen, die nach der ICD-11 klassifiziert werden (Dilling et al., 2022), und ist gesetzlich geregelt. Psychologische Beratung hingegen ist ein präventives Angebot, das nicht klinisch-pathologische Diagnosen umfasst.
Coaching richtet sich häufig auf die Optimierung von Leistung im beruflichen Kontext (Rauen, 2014). Die psychologische Beratung hingegen umfasst neben beruflichen auch familiäre und emotionale Themen, mit besonderem Fokus auf Emotionsarbeit innerhalb des Familiensystems.
Soziale Arbeit bietet rechtliche, materielle und strukturelle Hilfen zur Lebensbewältigung. Psychologische Beratung ergänzt diese um emotionale und kognitive Unterstützungsprozesse (Kraimer, 2021).
2.3 Besonderheiten der ambulanten Familienhilfe
Die ambulante Familienhilfe ist Teil der Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII. Ein zentraler rechtlicher Rahmen ist das „Hilfeplanverfahren“ (§ 36 SGB VIII), das die Bedarfe der Familie systematisch erfasst und die Hilfen koordiniert (Bock & Krüger, 2018).
Die Arbeit erfolgt überwiegend im häuslichen Umfeld, wodurch „Real-Life“-Interventionen möglich werden, die eine hohe Kontextsensibilität erfordern (Gresser, 2020). Weitere Besonderheiten sind:
· multiprofessionelle Kooperation,
· hohe Flexibilitätsanforderungen an die Fachkraft,
· und die besondere Bedeutung einer wertschätzenden, transparenten Haltung (Fröhlich-Gildhoff & Nentwig-Gesemann, 2016).
2.4 Rechtliche und ethische Rahmenbedingungen
Psychologische Beratung in der ambulanten Familienhilfe bewegt sich innerhalb klar definierter rechtlicher und ethischer Leitplanken:
· Datenschutz und Schweigepflicht: Der Schutz personenbezogener Daten nach DSGVO ist verpflichtend, ebenso eine DSGVO-konforme Dokumentation der Beratungsprozesse (Kraimer, 2021).
· Kindeswohlgefährdung: Neben der Schweigepflicht (§ 203 StGB) besteht bei Anhaltspunkten für Kindeswohlgefährdung eine Meldepflicht gemäß § 8a SGB VIII sowie besondere Schweigepflichten nach § 4 KKG, die ein abgestimmtes Vorgehen mit dem Jugendamt erfordern.
· Beratungsauftrag: Er beruht in der Regel auf freiwilliger Mitwirkung der Familie und folgt ethischen Prinzipien wie Wertschätzung, Transparenz und Allparteilichkeit (Deutsche Gesellschaft für Beratung – DGfB, 2015).
3. Das Setting in der ambulanten Familienhilfe
3.1 Strukturmerkmale der ambulanten Familienhilfe
Die ambulante Familienhilfe, auch Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) genannt, ist ein niedrigschwelliges Unterstützungsangebot im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe. Sie basiert auf § 31 SGB VIII und wird in der Regel über das örtliche Jugendamt initiiert. Ziel ist es, durch intensive Betreuung und Begleitung im häuslichen Umfeld die Erziehungsfähigkeit der Eltern zu stärken, das Kindeswohl zu sichern und eine drohende Fremdunterbringung zu vermeiden.
Kennzeichnend für dieses Setting sind folgende Strukturmerkmale (BMFSFJ, 2020; Bundesjugendkuratorium, 2022):
· Langfristigkeit: Die Hilfen erstrecken sich meist über mehrere Monate bis Jahre.
· Frequenz: In der Regel finden ein bis drei Kontakte pro Woche statt, abgestimmt auf die individuellen Bedarfe der Familie.
· Ort: Die Unterstützung erfolgt primär im Lebensumfeld der Familie – zu Hause, in Schulen oder bei Behörden.
· Multiperspektivität: Alle Mitglieder des Familiensystems werden in die Begleitung einbezogen.
· Individualisierung: Hilfepläne werden gemeinsam mit dem Jugendamt und der Familie formuliert und regelmäßig überprüft. Das sogenannte Hilfeplanverfahren fungiert hierbei als partizipatives Instrument, das die aktive Einbindung der Familien sicherstellt (Thiersch, 2014).
· Fallzahlen: Durchschnittlich betreut eine Fachkraft 12 bis 15 Familien (Bundesjugendkuratorium, 2022).
Die psychologische Beratung innerhalb dieses Settings muss diese Rahmenbedingungen berücksichtigen und ihre Methoden flexibel darauf anpassen.
3.2 Zielgruppen und typische Problemfelder
Die Zielgruppen der ambulanten Familienhilfe sind vielfältig, verbunden durch häufige Belastungslagen, die eine temporäre Unterstützung erfordern, um den Alltag eigenständig und kindeswohlorientiert zu bewältigen. Typische Problemlagen sind (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019):
· Erziehungsunsicherheit oder inkonsistentes Erziehungsverhalten
· Partnerschaftsprobleme oder Trennungssituationen
· Psychische Erkrankungen bei Eltern oder Kindern
· Vernachlässigung, Überforderung, Suchtproblematiken
· Soziale Isolation, Armut, prekäre Wohnverhältnisse
· Schulverweigerung und Entwicklungsauffälligkeiten
Beratung in diesen Kontexten erfordert ein hohes Maß an Empathie, fachlicher Kompetenz und Klarheit. Fachkräfte müssen sensibel zwischen Unterstützung, Grenzsetzung und Schutzauftrag balancieren können.
3.3 Rolle und Haltung der Berater*innen
Psychologische Berater*innen in der ambulanten Familienhilfe nehmen eine vermittelnde, begleitende und aktivierende Rolle ein. Sie arbeiten ressourcenorientiert und systemisch, ohne einseitige Schuldzuschreibungen oder Bewertungen vorzunehmen. Eine professionelle Haltung ist hierbei von zentraler Bedeutung:
· Allparteilichkeit: Die Bedürfnisse aller Beteiligten werden ernst genommen – insbesondere auch die der Kinder, die häufig sprachlos bleiben. Dabei ist die Balance zwischen Allparteilichkeit in Konflikten und der Priorisierung des Kindeswohls zentral (Simon et al., 2016).
· Transparenz und Klarheit: Ziele, Vereinbarungen und Erwartungen werden offen kommuniziert.
· Wertschätzung: Auch schwierige Lebensentwürfe verdienen Respekt.
· Selbstreflexion: Eigene Bewertungen, Deutungen und Emotionen werden regelmäßig hinterfragt (Rauen, 2014).
In der Praxis bedeutet dies, dass Fachkräfte Prozesse begleiten, Impulse zur Selbstwirksamkeit geben und bei Bedarf notwendige Konfrontationen herstellen – stets mit dem Ziel, das Familiensystem zu stabilisieren und weiterzuentwickeln.
3.4 Kooperation mit anderen Hilfesystemen (Jugendamt, Schulen etc.)
Ein wesentliches Merkmal der ambulanten Familienhilfe ist ihre Einbettung in ein komplexes Hilfenetzwerk. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit anderen Akteuren ist entscheidend für die Nachhaltigkeit der Beratung. Dazu gehören:
· Jugendämter: Sie fungieren als Kostenträger und Steuerungsinstanz und sind verantwortlich für Zielvereinbarungen und deren Überprüfung. Eine verlässliche Kooperation ist unerlässlich.
· Kitas und Schulen: Pädagogische Fachkräfte sind wichtige Beobachter der Kindesentwicklung. Regelmäßiger Austausch unterstützt die Ganzheitlichkeit der Hilfe. Besonders die Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit ist bei Problemen wie Schulverweigerung ein zentraler Baustein.
· Gesundheitssystem: Kinderärztinnen, Psychiaterinnen oder Ergotherapeut*innen sind relevante Partner im Hilfeprozess.
· Jobcenter, Wohnungsämter, Schuldnerberatungen: Existenzielle Fragen, wie finanzielle oder wohnliche Notlagen, müssen mitberücksichtigt werden.
Psychologische Berater*
innen übernehmen hier häufig eine Schlüsselrolle im Netzwerkmanagement, bei dem sie als Koordinatorinnen agieren, die Fäden zusammenführen, Perspektiven vermitteln und Familien durch das komplexe Hilfesystem loten (Herriger, 2014; Kraimer, 2021).
4. Methoden der psychologischen Beratung in der Familienhilfe
Die psychologische Beratung in der ambulanten Familienhilfe zeichnet sich durch Methodenvielfalt, hohe Flexibilität und situative Anpassungsfähigkeit aus. Fachkräfte müssen systemisch-dynamisch intervenieren und dabei die komplexen Lebenswelten belasteter Familiensysteme berücksichtigen. Die folgenden methodischen Zugänge bilden ein praxisrelevantes Fundament.
Systemische Beratung betrachtet Probleme nicht isoliert bei einzelnen Personen, sondern als Ausdruck von Beziehungsmustern innerhalb sozialer Systeme, insbesondere der Familie. Ziel ist es, festgefahrene Kommunikations- und Interaktionsmuster zu erkennen, zu reflektieren und gemeinsam zu verändern (Simon & Rech-Simon, 2020).
- Arbeit zitieren
- Irina Riederle (Autor:in), 2025, Psychologische Beratung in der Familienhilfe, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1588113