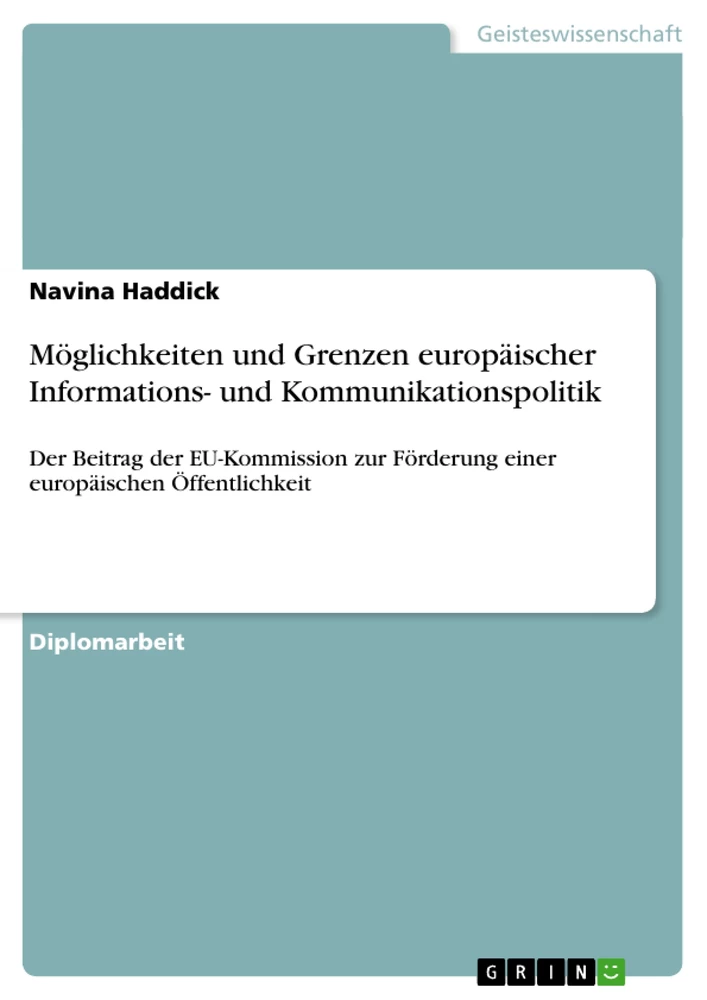Die Europäische Integration hat mit ihrer Verlagerung von Entscheidungsbefugnissen auf die EU-Institutionen dazu geführt, dass die europäische Politik mit weitreichenden Veränderungen im Leben der Bürger verbunden ist. Doch obwohl die EU zahlreiche Entscheidungen trifft, die sich direkt auf das alltägliche Leben der Bürger auswirken, bleibt sie für viele von ihnen eine abstrakte, wirklichkeitsfremde Institution, auf die sie anscheinend kaum Einfluss ausüben können. Eurobarometer-Umfragen bestätigen, dass viele Bürger den Eindruck haben, bei europäischen Fragen selten mitentscheiden zu können und die empirischen Belege für die Missstimmung der Bürger sind vielfältig: notorisch niedrige und stetig sinkende Wahlbeteiligungen bei den Wahlen zum Europäischen Parlament, wachsender Wählerzuspruch bei den anti-europäischen Parteien und rückläufige Zustimmungswerte zur eigenen EU-Mitgliedschaft. Schlagworte wie Demokratie-, Legitimitäts-, Öffentlichkeits- und Kommunikationsdefizit gehören mittlerweile zum Standardrepertoire der europapolitischen Diskussion.
Hinter der Schwierigkeit der Europäischen Union, mit den Bürgern in einen Dialog treten zu können, verbirgt sich das tiefergreifende Problem, dass keine in beide Richtungen wirkende Vermittlungsinstanz besteht: es gibt keine europäische Öffentlichkeit. Die Europäische Kommission hat als zentrales Problem das Fehlen einer europäischen Öffentlichkeit zwischen der EU und ihren Bürgern erkannt und fordert in ihrem 2006 verabschiedeten Weißbuch explizit die Schaffung einer ‚europäischen öffentlichen Sphäre’. Damit verbunden ist die Vision eines grenzüberschreitenden Kommunikationsraums, in dem sich die Europäer in öffentlichen Debatten über gemeinsame Belange verständigen können. Der ‚Dialog mit den Bürgern’ soll die Kluft zwischen den politischen Institutionen und den Menschen verringern.
Die forschungsleitende Frage dieser Arbeit beschäftigt sich damit, ob die Informations- und Kommunikationspolitik der Europäischen Kommission zur Stärkung einer europäischen Öffentlichkeit beitragen kann. Anhand einzelner Instrumente, die der Kommission zur Umsetzung ihrer Informations- und Kommunikationspolitik zur Verfügung stehen, wird konkret untersucht, inwieweit und auf welche Weise es der Kommission bisher gelungen ist, eine europäische Öffentlichkeit zu fördern und welche Probleme und Schwierigkeiten sich bei der Umsetzung vereinbarter Kommunikationsstrategien ergeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Fragestellung und Vorgehensweise
- 1.3 Forschungsstand und Literaturlage
- 1.4 Methodik
- 2 Theoretische Vorüberlegungen
- 2.1 Zum Begriff Öffentlichkeit
- 2.1.1 Öffentlichkeitsakteure
- 2.1.2 Funktionen von Öffentlichkeit
- 2.2 Debatte zur europäischen Öffentlichkeit
- 2.2.1 Supranationale europäische Öffentlichkeit
- 2.2.2 Europäisierung nationaler Öffentlichkeiten
- 2.3 Zum Begriff politische Öffentlichkeitsarbeit
- 2.3.1 Merkmale politischer Öffentlichkeitsarbeit
- 2.3.2 Akteure und Instrumente
- 3 Informations- und Kommunikationspolitik
- 3.1 Stellung der Kommission im Mehrebenensystem europäischer Informations- und Kommunikationspolitik
- 3.2 Akteure europäischer Informations- und Kommunikationspolitik
- 3.2.1 Organisationsstruktur der Kommission
- 3.3 Strukturelle Zusammenarbeit mit den anderen EU-Institutionen und den Mitgliedsstaaten
- 3.4 Ressourcen der Kommission
- 3.5 Zusammenfassung
- 4 Entwicklung europäischer Informations- und Kommunikationspolitik
- 4.1 Informationspolitik vor dem 'Maastricht-Schock'
- 4.2 Wandel von der Informations- zur Kommunikationspolitik
- 4.2.1 Pinheiro-Konzept
- 4.2.2 Vitorino-Konzept
- 4.2.3 Wallström-Konzept
- 4.3 Paradigmenwechsel unter Barroso II?
- 4.4 Zusammenfassung
- 5 Instrumente der Kommission
- 5.1 Pressearbeit
- 5.2 Publikationen
- 5.3 Internetportal
- 5.4 Audiovisuelle Instrumente
- 5.5 Informationsstellen
- 5.6 Zusammenfassung
- 6 Möglichkeiten und Grenzen europäischer Informations- und Kommunikationspolitik
- 6.1 Europäische Öffentlichkeit durch Transparenz?
- 6.1.1 Publikationen und Informationsbroschüren
- 6.1.2 Website EUROPA
- 6.1.3 EUTube
- 6.2 Medienarbeit der Kommission
- 6.2.1 Paneuropäische Medienlandschaft
- 6.2.2 Debatte in den nationalen Massenmedien
- 6.3 Mythos vom Dialog mit den Bürgern?
- 6.3.1 Online-Forum, 'Debate Europe'
- 6.3.2 Podiumsdiskussionen
- 6.4 Schwierigkeiten bei der Umsetzung einzelner Projekte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen europäischer Informations- und Kommunikationspolitik im Hinblick auf die Förderung einer europäischen Öffentlichkeit. Sie analysiert den Beitrag der EU-Kommission und beleuchtet die verschiedenen Instrumente, die sie einsetzt, um mit den Bürgern in Kontakt zu treten und Transparenz zu schaffen.
- Entwicklung der europäischen Informations- und Kommunikationspolitik
- Die Rolle der EU-Kommission in der Gestaltung einer europäischen Öffentlichkeit
- Instrumente der Kommission zur Kommunikation mit Bürgern und Medien
- Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Förderung einer europäischen Öffentlichkeit
- Kritik an der EU-Kommission und deren Öffentlichkeitsarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Problemstellung ein und stellt die Fragestellung und Vorgehensweise der Arbeit dar. Sie beleuchtet den Forschungsstand und die Literaturlage sowie die Methodik der Untersuchung.
Kapitel 2 widmet sich theoretischen Vorüberlegungen zum Begriff Öffentlichkeit, einschließlich der verschiedenen Öffentlichkeitsakteure und Funktionen. Anschließend werden die Debatten zur europäischen Öffentlichkeit, einschließlich der supranationalen europäischen Öffentlichkeit und der Europäisierung nationaler Öffentlichkeiten, beleuchtet.
Kapitel 3 behandelt die Informations- und Kommunikationspolitik der EU-Kommission. Es analysiert die Stellung der Kommission im Mehrebenensystem europäischer Informations- und Kommunikationspolitik und beleuchtet die Organisationsstruktur der Kommission sowie die strukturelle Zusammenarbeit mit anderen EU-Institutionen und den Mitgliedsstaaten. Außerdem werden die Ressourcen der Kommission vorgestellt.
Kapitel 4 befasst sich mit der Entwicklung europäischer Informations- und Kommunikationspolitik. Es beleuchtet die Informationspolitik vor dem "Maastricht-Schock" und analysiert den Wandel von der Informations- zur Kommunikationspolitik, einschließlich der Pinheiro-, Vitorino- und Wallström-Konzepte.
Kapitel 5 stellt die Instrumente der Kommission zur Kommunikation mit Bürgern und Medien vor, wie Pressearbeit, Publikationen, das Internetportal, audiovisuelle Instrumente und Informationsstellen.
Kapitel 6 untersucht die Möglichkeiten und Grenzen europäischer Informations- und Kommunikationspolitik. Es analysiert, wie die EU-Kommission versucht, eine europäische Öffentlichkeit durch Transparenz zu schaffen, und beleuchtet die Medienarbeit der Kommission sowie den Mythos vom Dialog mit den Bürgern.
Schlüsselwörter
Europäische Öffentlichkeit, Informations- und Kommunikationspolitik, EU-Kommission, Medienarbeit, Transparenz, Dialog, Bürgerbeteiligung, Europäisierung, supranationale Öffentlichkeit, politische Öffentlichkeitsarbeit.
- Quote paper
- Navina Haddick (Author), 2010, Möglichkeiten und Grenzen europäischer Informations- und Kommunikationspolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/158788