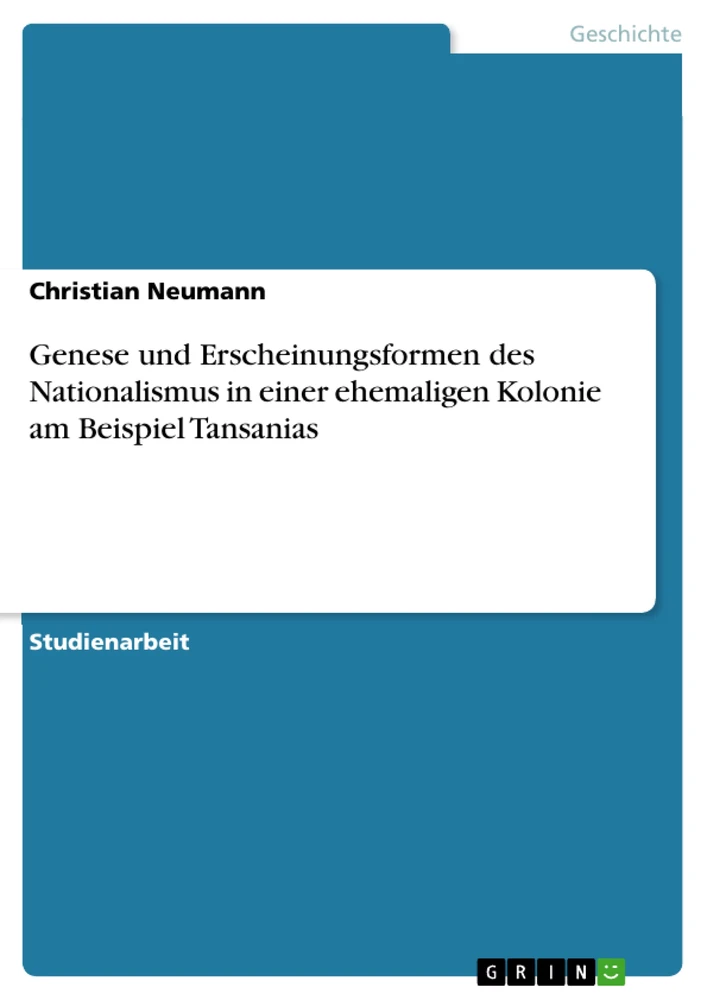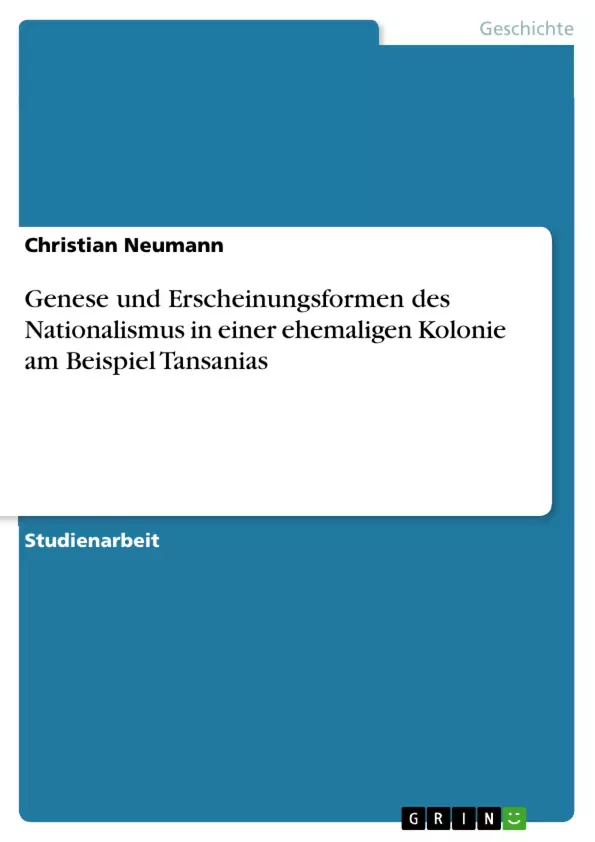Der Text geht am Beispiel Tansanias der Frage nach, wie aus einer Vielzahl von Ethnien innerhalb einer Kolonie eine Nation entsteht, bzw. gemacht wird, mit welchen Mitteln das geschieht und welche Formen dieser spezifische Nationalismus annimmt. Ausgangspunkt sind die Überlegungen zu Nation und Nationalismus von Benedict Anderson, der Nation als eine vorgestellte, begrenzte und souveräne politische Gemeinschaft definiert. Erst eine politische Gemeinschaft, die als Nation Souveränität erlangt, kann glaubhaft Unabhängigkeit von einer Kolonialmacht fordern und durchsetzen.
c_1
6. Taifa
7. Julius Nyerere und die TANU
8. Sozialismus und Nation sprechen Kiswahili
9. Kunst, Kultur und Nation-Building
10. Wurzeln und Helden der Nation
11. Das Nationalgefühl, erforscht
12. Fazit
13. Quellen
14. Literatur
1. Einleitung
Eine Nation sei eine vorgestellte, begrenzte und souveräne politische Gemeinschaft, meint Benedict Anderson.[1] „Vorgestellt ist sie deswegen, weil die Mitglieder selbst der kleinsten Nation die meisten anderen niemals kennen, ihnen begegnen oder auch nur von ihnen hören werden, aber im Kopf eines jeden die Vorstellung ihrer Gemeinschaft existiert.“[2] Da sich keine Nation mit der gesamten Menschheit gleichsetze, sei die Nation zudem immer begrenzt. Die Nation trete an die Stelle des Souveräns von Gottes Gnaden im Ancien Regime. Sie sei der Souverän des modernen Staates.[3]
Diese Definition einer Nation und dem daraus folgenden Nationalismus möchte ich auch für die folgenden Überlegungen zur Genese und dem Wesen der tansanischen Nation und ihres Nationalgefühls zu Grunde legen. Im ersten Teil betrachte ich die vorkolonialen und frühen kolonialen Ausgangsbedingungen, in denen sich nach dem Ersten Weltkrieg ein Nationalgefühl in Tanganyika entwickelte. Danach geht es um die Personen, Personengruppen und Organisationen, die zu Trägern eines Nationalgedankens wurden. Unabsichtlich wurde auch die britische Kolonialregierung mit unpopulären Maßnahmen zu ihrem Förderer. Auch wenn etwa 90 % der Bevölkerung auf dem Land lebte, waren es die verbliebenen 10 % in den Städten, unter denen sich das Bewusstsein einer unabhängigen Nation verbreitete. Deshalb wird die Entwicklung in Dar es Salaam in einem gesonderten Kapitel gewürdigt.
Rassismus und Rassentrennung waren für die gesamte Kolonialzeit gegenwärtig. Eine Hierarchie der Rassen war in ihrer Vorstellung eine gegebene Tatsache, die Unterschiede seien aber weniger biologischer Art, als eine Frage von Kultur und Bildung und damit veränderbar. Auch die weit untenstehenden Afrikaner seien, in ferner Zukunft, zu einem Aufstieg fähig. Der britische Rassismus scheint mehr aus einem Bedürfnis zu kommen, die koloniale Welt zu ordnen, jeder Bevölkerungsgruppe gerecht zu werden, die wirtschaftliche Entwicklung der Inder zu fördern und gleichzeitig die Afrikaner vor den umtriebigen Indern zu schützen. Wenn im Folgenden von Rasse, Race und Rassismus die Rede ist, ist diese paternalistische Variante gemeint. Kolonialkritische Afrikaner übernahmen diesen Rassebegriff, um Gleichberechtigung und Unabhängigkeit für die ‚Afrikanische Rasse‘ einzufordern. Auch die Rolle der Inder wird in diesem Zusammenhang betrachtet. Ein weiteres Kapitel ist dem Kiswahili-Begriff Taifa gewidmet, dessen Bedeutung zwischen Nation und Rasse oszilliert.
Nach der Unabhängigkeit waren afrikanischer Sozialismus, die Verbreitung der Schulbildung und besonders die bewusste Verwendung von Kiswahili als Landessprache entscheidend für den Erfolg des Nation-Building. Zum Ende werde ich noch einen Blick auf Kunst und Kultur als nationalen Ausdruck werfen, sowie auf den Versuch, einen ‚Protonationalismus‘ aus antikolonialen Kriegen zu konstruieren.
Noch ein paar Gedanken zum Gebrauch der Begriffe Stamm, Tribe, Ethnie, die im Großen und Ganzen das gleiche meinen, aber unterschiedliche Konnotationen haben: Stammesangehörige und Tribesmen wurden automatisch als primitiv und den Europäern unterlegen angesehen. Stämme seien quasi naturhafte, stabile Gemeinschaften, meist dauerhaft an einen Ort gebunden, ihrem Stammesgebiet. Es ist eine Sicht von außen, von den Kolonialherren, deren Vorstellungen nur selten mit der Wirklichkeit zusammenfielen. Im Begriff der Ethnie liegt dagegen auch das Wissen darüber, dass eine Ethnie kein Naturprodukt ist, sondern eine soziale Konstruktion. Ethnien können sich teilen oder vereinigen, sie trennen eine Wir-Gruppe von den Anderen. Diese neutrale Sicht auf soziale Gruppen verzichtet auf eine wertende Beschreibung und erlaubt die Erfassung einer Vielzahl unterschiedlicher Gesellschaftsformen. Deshalb werde ich im Folgenden, abgesehen von Zitaten, dem Begriff der Ethnie den Vorzug geben. Bei den Bezeichnungen für das Führungspersonal der Ethnien habe ich mich gegen den Häuptling entschieden, da auch dieser Begriff kolonialen Ursprungs ist und im Deutschen die Endsilbe -ling oft einen abwertenden Charakter hat. Der englische chief ist nicht so eindeutig negativ belastet, obwohl auch er eine Fremdbezeichnung durch die Kolonialmacht ist. Da er aber auch in anderen Bezeichnungen verwendet wird, z.B. als Chief Executive Manager, halte ich dessen Verwendung für vertretbar. Auch die Bezeichnung Traditioneller Führer ist nicht unproblematisch. Um welche Tradition handelt es sich? Auch Traditionen wurden gern von der Kolonialmacht erfunden, wenn es ihrer Herrschaft gelegen kam. Man könnte auch die Bezeichnung auf Kiswahili nehmen: Mkuu. Dessen wörtliche Übersetzung ist aber wieder (Ober)haupt, bzw. Chief, womit man nichts gewonnen hätte. Ich werde deshalb Chief und Traditioneller Führer gleichbedeutend nebeneinander verwenden.
2. Ausgangslage
Das Gebiet, das später Deutsch-Ostafrika und nach dem ersten Weltkrieg zum größeren Teil britisches Treuhandgebiet wurde, war von einer großen Anzahl verschiedener Ethnien mit sehr unterschiedlichen Gesellschaftsformen bewohnt. Im Nordwesten Tanganyikas fanden sich erste zentralisierte Staaten unter einem Monarchen, der mit einer vergleichbaren Macht eines europäischen Königs ausgestattet war.[4] Daneben existierten Gruppen, die als akephal bezeichnet werden, da sie Führer nur für bestimmte Funktionen und auf Zeit benennen.[5] Die Kolonialherren waren auf die lokalen Führer angewiesen, um ihre Herrschaft in der Fläche durchsetzen zu können. Die Briten nannten es Indirect Rule und folgten der Fiktion, damit schon traditionell bestehende Rechtsnormen und Herrschaftsformen weiterzuführen, auch wenn sie im Fall akephaler Gruppen mit der Einsetzung eines Chiefs diese Tradition erst erfinden mussten.[6] Sie regierten ihre Gruppe auf einem bestimmten Territorium.[7] Da deren Angehörige sich in erster Linie dieser Ethnie angehörig fühlten, konnte sich lange kein Nationalgefühl dem gesamten Territorium gegenüber entwickeln. Auch Menschen, die als Wanderarbeiter, insbesondere zu den Sisalplantagen, ihre Heimat verließen, blieben noch Teil ihrer Ethnie und hielten Kontakt mit ihrem Zuhause. Von der Regierung wurden sie außerdem dazu angehalten, nur begrenzte Zeit außerhalb ihrer Heimatregion zu arbeiten und danach wieder zurückzukehren.[8]
3. Der koloniale Staat
Der Ausbau der kolonialen Verwaltung verlangte nach einer immer größer werdenden Anzahl ausgebildeter Fachkräfte, die nicht durch Personal aus dem Mutterland gedeckt werden konnte. Es musste deshalb auf Einheimische zurückgegriffen werden, die eine Schulbildung nach europäischen Vorstellungen und Bedürfnissen durchlaufen hatten. Auch im Handel und Gewerbe der Städte entstanden Arbeitsplätze, die höhere Anforderungen an die Fähigkeiten der Menschen stellten. Schulen wurden überwiegend von Missionen betrieben, weiterführende Schulen in der Regel als Internate. Dort trafen Schüler aus verschiedenen Ethnien zusammen, bildeten Gemeinschaften, die unabhängig von ihrer jeweiligen Herkunft waren. Schulen stellten gemeinsame Erfahrungsräume dar, die jede Schülergeneration durchlief. Einheitliche Schulbücher, eine verbindliche Unterrichtssprache, die immer gleichen Lieder, Bilder, beförderten ungewollt eine nationale Integration. Die gemeinsamen Jahre in der Schule führen zu einer Solidarität der Klassenkameraden, die auch im späteren Leben bedeutsam sein wird. Es ist eine Solidarität zwischen Fremden, die weder miteinander verwandt sind noch derselben Ethnie angehören. Die entstehenden Netzwerke sind nicht mehr ethnisch begründet, sondern national.[9]
Die Kolonialverwaltung setzte ihre einheimischen Angestellten gern in anderen als ihren Herkunftsgebieten ein, auch um zu verhindern, dass deren Loyalität zur Kolonialmacht durch familiäre und sonstige Abhängigkeiten untergraben würde. Ein Nebeneffekt war, dass sie ein Territorium, dessen Grenzen von einer fremden Macht willkürlich gezogen worden waren, als ihr Heimatland erfuhren.[10] Die Grenzen des Territoriums waren gleichzeitig die Grenzen ihrer Entfaltungsmöglichkeiten. Es war in aller Regel ausgeschlossen, in der Verwaltung anderer britischer Kolonien oder gar im Mutterland Karriere zu machen. Es entstand eine Schicht gebildeter Afrikaner, die Englisch beherrschten, Zugang zu europäischen Ideen von individueller Freiheit hatten und erfuhren, welche Stärke die Vorstellung eines Nation-Seins entwickeln konnte.[11] Von den traditionellen Stammesführern fühlten sie sich nicht mehr repräsentiert. Trotz aller Bemühungen der Briten, die Position dieser Führer zu stärken und die Afrikaner als „Tribesmen“[12] ausschließlich als Mitglied eines Tribes zu definieren, war das System des Indirect Rule nicht mehr haltbar. Stattdessen richteten sie ab den späten 1950er Jahren auf verschiedenen Verwaltungsebenen Räte ein, die aus den schon bestehenden Native Authorities hervorgehen sollten. In diesen Räten sollten auch Angehörige dieser afrikanischen Angestelltenschicht tätig werden können.[13]
Afrikanische Angestellte des öffentlichen Dienstes wurden zu Trägern des sich entwickelnden Nationalgefühls. Ihre Möglichkeiten einer politischen Betätigung außerhalb der von der Regierung geduldeten Organe waren aber beschränkt. Deshalb waren es zuerst gebildete Afrikaner, aus der Wirtschaft, die sich seit den späten 1940er Jahren zunehmend kolonialkritisch äußerten und sich für eine unabhängige Nation engagierten. Lehrer und Angehörige vergleichbarer Berufsgruppen folgten erst in den 1950er Jahren und wurden dann führend im Kampf um die Unabhängigkeit und Gründer der TANU, wie z.B. Julius Nyerere.[14]
4. Dar es Salaam
Betrachtet man die gesellschaftliche Entwicklung in den Städten, besonders in Dar Es Salaam, wird deutlich, wie weit die Fiktion der Kolonialregierung, die Bevölkerung der Kolonie könne in definierte Tribes einsortiert werden, von der gesellschaftlichen Realität entfernt war. Von Anfang an waren Städte Magnete für Menschen aus der ganzen Kolonie auf der Suche nach Arbeit und individueller Entfaltung. Sie waren eine Möglichkeit, den zwar Sicherheit bietenden, aber auch einschränkenden Lebensbedingungen in den Dörfern zu entkommen. Die Mehrheit der afrikanischen Bewohner Dar es Salaams wurden dennoch fast bis zum Ende der Kolonialzeit in Zaramo, Nyamwesi, Swahili, usw. aufgeteilt, ungeachtet der Tatsache, dass z.B. eine Selbstbezeichnung als Mswahili kaum etwas über die Zugehörigkeit zu einer Ethnie aussagt, sondern über die Zugehörigkeit zur Swahilikultur an der Küste mit den wichtigsten Kriterien Kleidung, Sprache und Islam. Becher zitiert dazu aus einem Zeitungsartikel: „Ich bin Suaheli, aber früher, da war ich ein Makonde oder ein Mahehe.“[15] Statt in den alten und von der Regierung geförderten Stammesstrukturen sortierten sich die Bewohner in einer anderen Art von ‚Stämmen‘, eine Entwicklung, die in der Zwischenkriegszeit Fahrt aufnahm. Das Wesen dieser ‚Stämme‘ war ihre Konstruktion entlang des Kriteriums einer Seniorität. Diejenigen, die für sich beanspruchten, die ersten Besiedler des Stadtgebiets zu sein, nannten sich Wenye mji, Besitzer der Stadt, und genossen gewisse Privilegien politischer, spiritueller und ökonomischer Art gegenüber den späteren Einwanderern, den sogenannten Watu wa kuja[16]. Letztere hatten keine vorzeigbare Abstammung, gehörten zunächst keiner respektablen und einflussreichen Familie an. Sie hatten nur ihre eigenen Fähigkeiten, um sich durchzusetzen. Sie wurden, möglicherweise auch wegen ihrer relativen Ungebundenheit an lokale Strukturen, wirtschaftlich erfolgreich, besonders im Immobiliensektor.[17] Aus den Reihen der Watu wa kuja stammten auch die Gründer der ersten politischen Organisation von Afrikanern, der African Association im Jahr 1929. Sie wollte nicht mehr die Interessen einzelner Ethnien oder Familien vertreten, sondern „the entire race/nation (taifa) of the natives of Africa.“[18]. Nicht vergessen darf man die ostafrikanischen Soldaten (Askari), die während des Zweiten Weltkriegs in Britisch-Indien stationiert wurden und dort die indische antikoloniale Nationalbewegung kennenlernten.[19]
Ungewollt förderten auch die Briten einen afrikanischen Nationalismus. Wie bereits weiter oben erwähnt richteten sie in den späten 1950er Jahren lokale Räte ein, die einen hohen Anteil gewählter Mitglieder hatten. Allerdings kamen diese Räte zu spät. Afrikaner, die sich von den von den Chiefs beherrschten Native Authorities nicht vertreten fühlten, entwickelten außerhalb der Kolonialverwaltung eine nationalistische, antikoloniale Opposition, auf die später die TANU aufbauen konnte.[20] Die zweite ‚Fördermaßnahme‘ waren die unbeliebten Programme der Regierung zur Verbesserung und Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion und der Erosionsbekämpfung. Für die Durchsetzung bedienten sie sich der Native Authorities, die damit bei der Bevölkerung diskreditiert waren.[21]
5. Koloniale Rassentrennung
In der deutschen Kolonialzeit galten noch alle Nichteuropäer als ‚Eingeborene‘, was unter den Indern zur Gründung einer ersten politischen Organisation führte, die die Gleichsetzung der Inder mit den Europäern als ‚nicht Eingeborene‘ forderte.[22] Unter britischer Verwaltung galten Inder dann gemeinsam mit Europäern als ‚Non-natives‘. Für einige kleinere Bevölkerungsteile, wie z.B. Swahili, Araber oder Somalis hatte die Regierung bis zum Ende der Kolonialzeit keine klare Position, in welche Schublade sie gehören sollten. Diese Rassentrennung hatte ganz praktische Auswirkungen. Bestimmte Bezirke der Städte waren für Afrikaner, Inder oder Europäer reserviert. Während der Lebensmittelrationierung nach dem Zweiten Weltkrieg wurden den einzelnen Rassen unterschiedliche Rationen zugeteilt, unterschiedlich hinsichtlich der Mengen und der Art. Die Höhe der Gehälter im öffentlichen Dienst richtete sich nach Rassenzugehörigkeit, wobei ein Nicht-Europäer gemäß der East African Salary Commission (1947-1948) 3/5 eines Europäers mit gleicher Qualifikation bekam und ein Inder das Doppelte eines Afrikaners.[23] Auch die Hafenarbeit war stark nach rassischen Gesichtspunkten gegliedert. Körperliche Arbeit war Sache der Afrikaner, die der Aufsicht von Indern auf mittlerer Führungsebene unterstanden. Die Leitung war für Europäer reserviert.[24] Begründet wurde dieses System erstens mit der festen Überzeugung der Überlegenheit der Europäer allen anderen Rassen gegenüber und der Vorstellung einer Hierarchie der Rassen, mit den Afrikanern an unterster Stelle. Zweitens herrschte bei den Briten eine paternalistische Einstellung gegenüber den Afrikanern. Diese benötigten einen besonderen Schutz vor den wirtschaftlich stärkeren und geschickteren Indern. Drittens sollte die Trennung von Afrikanern und Indern eine mögliche antikoloniale Verbindung beider Gruppen verhindern. Eine „healthy and natural rivalry“ war im Sinn der Regierung.[25]
Auf dem Papier schien die Organisation der Gesellschaft nach Rasse wohlgeordnet. In der Praxis war sie ein Quell endloser Konflikte. War bei der Lebensmittelrationierung gleiche Mengen Mais und Reis wirklich gleich? Sollte ein schwer arbeitender Afrikaner nicht einen Schwerarbeiterzuschlag bekommen, wodurch seine Ration womöglich die eines Inders überstiege? Auch in den afrikanischen Stadtteilen, wie Kariakoo in Dar es Salaam, kauften Inder Immobilien, wer war wo berechtigt, als Straßenhändler zu arbeiten?[26] Diese Konflikte und die Streiks der afrikanischen Hafenarbeiter zwischen 1939 und 1950 trugen einen nicht unerheblichen Teil zu einer afrikanischen Politisierung bei.
5.1 Inder als ‚colonial middlemen‘
Inder in Tanganyika sind typische Vertreter einer „middleman minority“[27]. Mitglieder dieser Gruppen zeichnen sich dadurch aus, dass sie im Gegensatz zu Siedlern nicht die Absicht haben, auf Dauer ihr Herkunftsland zu verlassen, sondern nur für eine beschränkte Zeit im Ausland bleiben wollen, meist um Geld zu verdienen, dass dann in der Heimat angelegt werden soll. Sie tendieren dazu, sich in einer Diasporagemeinde von der übrigen Gesellschaft abzukapseln, und sich auf Geschäftsfelder zu beschränken, die wenig kapitalintensiv sind. Deshalb findet man sie häufig im Handel. Ihre Mittelstellung ist auch eine vermittelnde Position zwischen einer kleinen Oberschicht und einer breiten Masse.
In Tanganyika wie auch in anderen Kolonien waren sie eine Art Puffer zwischen der Kolonialmacht und den Afrikanern. Während die Lebenswelten von Afrikanern und Indern sonst getrennt voneinander existierten, waren die kleinen indischen Läden (duka) Orte eines umso intensiveren, weil existenzielleren wirtschaftlichen Kontakts. Die Käufer bekamen hier alles, was zum täglichen Leben nötig war, auch auf Kredit. Darüber hinaus fungierten spezialisierte Läden als Pfandleihe (duka poni). Schließlich konnten afrikanische Produzenten, besonders in den Dörfern, hier ihre Produkte verkaufen.[28] Dieser Kontakt verlief nicht unbedingt harmonisch. Streit über zu hohe und scheinbar willkürlich festgelegte Preise, Qualität oder falsche Maße bot jeden Tag Gelegenheit, rassistische Einstellungen zu produzieren und zu verfestigen. Dazu bekamen die indischen Händler, allen Ärger ab, der eigentlich an die Kolonialregierung hätte gerichtet werden müssen. Entsprechend taucht der Begriff colonial middleman schon in den zeitgenössischen Quellen auf, um Inder als illoyal, ausbeuterisch und als Agenten des Kolonialismus zu verleumden.[29] Dieser Status der Inder wird später noch von Bedeutung werden, als es um die Frage ging, wer Staatsangehöriger des unabhängigen Tansania sein konnte.
5.2 Rasse und Nationalismus
In der Auseinandersetzung mit den rassistischen Kategorien des kolonialen Staats wurde seit den 1940erJahren eine rassisch fundierte Identität der Afrikaner begründet, die in Zeitungen wie Kwetu und Mambo Leo veröffentlicht wurde. Auch wenn die Mehrheit der Daressalaamer Analphabeten waren, hatten die Zeitungen eine weite Verbreitung, da sie auf der Straße und in Cafés vorgelesen wurden. Die Verwendung des Rassebegriffs als Mittel für die Bildung einer afrikanischen Identität und als Vehikel für politische Forderungen war die Reaktion auf gemeinsame Erfahrung von Erniedrigung durch Europäer und Inder. Deshalb war dieser Nationalismus keiner, der alle im Land Geborenen einschloss, sondern ein explizit afrikanischer Nationalismus, von dem nicht nur die Kolonialherren, sondern auch die Inder, Araber und wer sonst noch als fremd galt, ausschloss.[30]
- Arbeit zitieren
- Christian Neumann (Autor:in), 2025, Genese und Erscheinungsformen des Nationalismus in einer ehemaligen Kolonie am Beispiel Tansanias, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1585858