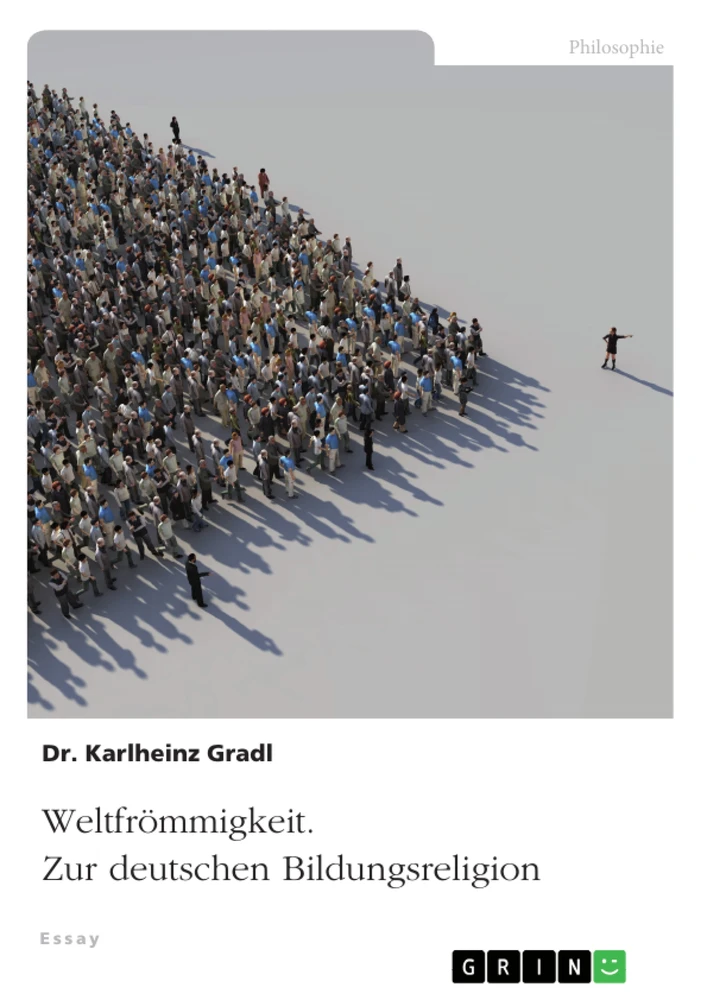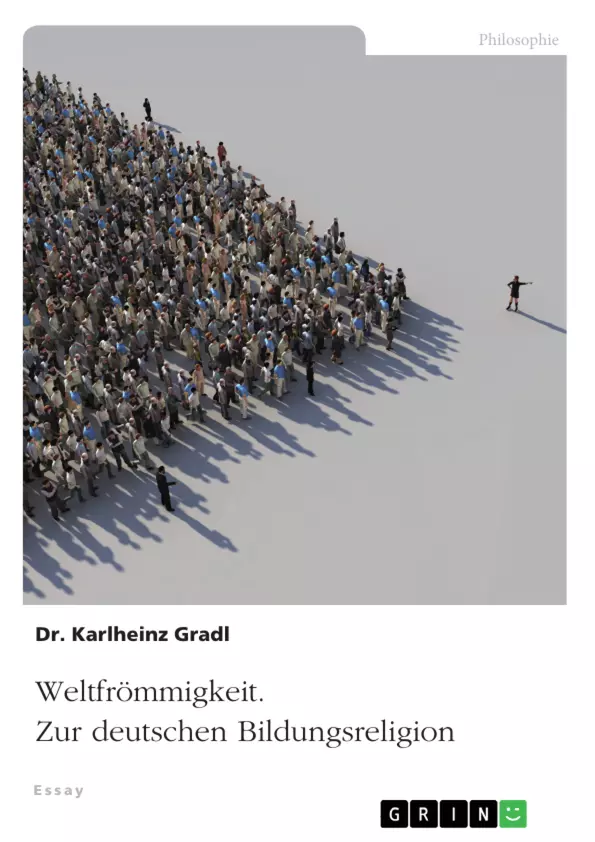Im Folgenden sollen zentrale Stationen eines Wegs beleuchtet werden, der aufzeigen kann, wie die Verknüpfung des Humboldtschen Bildungsprojekts mit dem Idiom der Weltfrömmigkeit die Perspektive auf einen teil-säkularisierten Begriff von Erlösung eröffnet, dessen unscharfes Profil erst im erlösungsdefinierten Kontext einer politischen Religion, der des Nationalsozialismus, den ihm angemessenen „sozialen“ Ort findet. Sichtbar gemacht werden soll dabei der ideologische Kern der klassischen Bildungsidee, über die nach 1800 der Anspruch bürgerlicher Intellektueller auf politische Bewusstseinsbildung relativiert und zugleich die politische Kompetenz aristokratischer Eliten legitimiert wird. Während Weltfrömmigkeit bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts bevorzugt auf literarischer Ebene, exemplarisch im Bildungsroman Goethes und Stifters, sich artikuliert, entwickelt der Begriff nach 1900 jene theoretische Eigenständigkeit, die ihn, wie das Beispiel Spranger zeigt, letztlich verfügbar macht für die nationalsozialistische Ideologie. Adornos Kritische Theorie bewahrt nach 1945 noch den gleichsam geretteten Rest eines Idioms, dessen spirituelle Kraft in der säkularisierten Welt der Spätmoderne, wie Bieris Essay „Wie wäre es, gebildet zu sein?“ dokumentiert, erloschen ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bildung: Humboldt, Bieri und Spaemann
- Weltfrömmigkeit und die Perspektive auf Erlösung
- Goethe und Wilhelm Meisters Lehrjahre
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht die Entwicklung des Begriffs der Bildung von der Aufklärung bis zur Moderne, insbesondere im Kontext der deutschen Bildungsreligion und der Weltfrömmigkeit. Er beleuchtet die Verknüpfung des Humboldtschen Bildungsprojekts mit dem Konzept der Weltfrömmigkeit und analysiert dessen ideologische Implikationen bis hin zum Nationalsozialismus. Der Essay untersucht den Wandel des Bildungsideals und dessen gesellschaftliche Funktion.
- Die Entwicklung des Bildungsbegriffs von der Aufklärung bis zur Moderne
- Die Rolle der Weltfrömmigkeit in der deutschen Bildungsreligion
- Die Verknüpfung von Bildung und Politik
- Die ideologische Instrumentalisierung des Bildungsideals
- Der Wandel des Verständnisses von Ganzheit und Autonomie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Der Essay untersucht den Wandel des Bildungsbegriffs im Kontext der deutschen Bildungsreligion und Weltfrömmigkeit, beginnend mit Humboldts Konzept und dessen Transformation bis hin zur Moderne. Er fokussiert auf die Verflechtung von Bildung, Politik und Ideologie, insbesondere die Instrumentalisierung des Bildungsideals im Nationalsozialismus. Die Analyse beleuchtet das ambivalente Verhältnis von idealistischem Anspruch und realpolitischem Konservatismus.
Bildung: Humboldt, Bieri und Spaemann: Dieses Kapitel vergleicht die Bildungskonzepte von Humboldt, Bieri und Spaemann. Humboldt verknüpft Bildung mit individueller Selbsterkenntnis und einer gesellschaftlichen Rolle im Kontext einer aufgeklärten Gesellschaft. Bieri sieht Bildung im Kontext spätmoderner "Identitätsfindung", während Spaemann an einem klassischen, religiös fundierten Verständnis festhält. Die unterschiedlichen Perspektiven zeigen den Wandel des Bildungsbegriffs im Laufe der Zeit und die damit verbundenen ideologiekritischen Fragen.
Weltfrömmigkeit und die Perspektive auf Erlösung: Dieses Kapitel beleuchtet den Weg der Verknüpfung des Humboldtschen Bildungsprojekts mit dem Konzept der Weltfrömmigkeit. Es wird gezeigt, wie dieses Konzept eine teil-säkularisierte Form der Erlösung ermöglicht, deren unscharfes Profil erst im Kontext des Nationalsozialismus seinen "sozialen Ort" findet. Der Fokus liegt auf der Analyse des ideologischen Kerns der klassischen Bildungsidee und der damit verbundenen Relativierung des Anspruchs bürgerlicher Intellektueller auf politische Bewusstseinsbildung.
Goethe und Wilhelm Meisters Lehrjahre: Goethes "Wilhelm Meisters Lehrjahre" wird als konkrete Antwort auf Humboldts Frage nach der Funktion individueller Bildungsprozesse in einer bürgerlichen Gesellschaft interpretiert. Der Roman illustriert die Interaktion zwischen Reformadel und Bürgertum und wie Bildung in diesem Kontext als Instrument der gesellschaftlichen Gestaltung funktioniert. Der Abbé als theoretische Instanz erläutert die Entwicklung eines neuen bildungsbürgerlichen Ganzheitsbewusstseins durch das Gleichgewicht zwischen "Sinn" und "Tat".
Schlüsselwörter
Bildung, Weltfrömmigkeit, deutsche Bildungsreligion, Humboldt, Goethe, Nationalsozialismus, Ideologie, Säkularisierung, Ganzheit, Autonomie, bürgerliche Gesellschaft, politische Bewusstseinsbildung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Textes?
Dieser Essay untersucht die Entwicklung des Begriffs der Bildung von der Aufklärung bis zur Moderne, insbesondere im Kontext der deutschen Bildungsreligion und der Weltfrömmigkeit. Er beleuchtet die Verknüpfung des Humboldtschen Bildungsprojekts mit dem Konzept der Weltfrömmigkeit und analysiert dessen ideologische Implikationen bis hin zum Nationalsozialismus. Der Essay untersucht den Wandel des Bildungsideals und dessen gesellschaftliche Funktion.
Welche Hauptziele verfolgt dieser Essay?
Der Essay zielt darauf ab, die Entwicklung des Bildungsbegriffs von der Aufklärung bis zur Moderne, die Rolle der Weltfrömmigkeit in der deutschen Bildungsreligion, die Verknüpfung von Bildung und Politik, die ideologische Instrumentalisierung des Bildungsideals und den Wandel des Verständnisses von Ganzheit und Autonomie zu untersuchen.
Welche zentralen Themen werden in diesem Text behandelt?
Zu den zentralen Themen gehören Bildung, Weltfrömmigkeit, deutsche Bildungsreligion, die Ideen von Humboldt und Goethe, der Nationalsozialismus, Ideologie, Säkularisierung, Ganzheit, Autonomie, die bürgerliche Gesellschaft und die politische Bewusstseinsbildung.
Welche Bildungskonzepte werden verglichen?
Die Bildungskonzepte von Humboldt, Bieri und Spaemann werden verglichen. Humboldt verknüpft Bildung mit individueller Selbsterkenntnis und einer gesellschaftlichen Rolle im Kontext einer aufgeklärten Gesellschaft. Bieri sieht Bildung im Kontext spätmoderner "Identitätsfindung", während Spaemann an einem klassischen, religiös fundierten Verständnis festhält.
Welche Rolle spielt die Weltfrömmigkeit im Kontext der Bildung?
Der Essay beleuchtet, wie das Humboldtsche Bildungsprojekt mit dem Konzept der Weltfrömmigkeit verknüpft wurde. Es wird gezeigt, wie dieses Konzept eine teil-säkularisierte Form der Erlösung ermöglicht, deren unscharfes Profil erst im Kontext des Nationalsozialismus seinen "sozialen Ort" findet.
Wie wird Goethes "Wilhelm Meisters Lehrjahre" in diesem Kontext interpretiert?
Goethes "Wilhelm Meisters Lehrjahre" wird als konkrete Antwort auf Humboldts Frage nach der Funktion individueller Bildungsprozesse in einer bürgerlichen Gesellschaft interpretiert. Der Roman illustriert die Interaktion zwischen Reformadel und Bürgertum und wie Bildung in diesem Kontext als Instrument der gesellschaftlichen Gestaltung funktioniert.
Welche Schlüsselwörter sind für diesen Text relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen: Bildung, Weltfrömmigkeit, deutsche Bildungsreligion, Humboldt, Goethe, Nationalsozialismus, Ideologie, Säkularisierung, Ganzheit, Autonomie, bürgerliche Gesellschaft, politische Bewusstseinsbildung.
- Quote paper
- Karlheinz Gradl (Author), 2025, Weltfrömmigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1579146