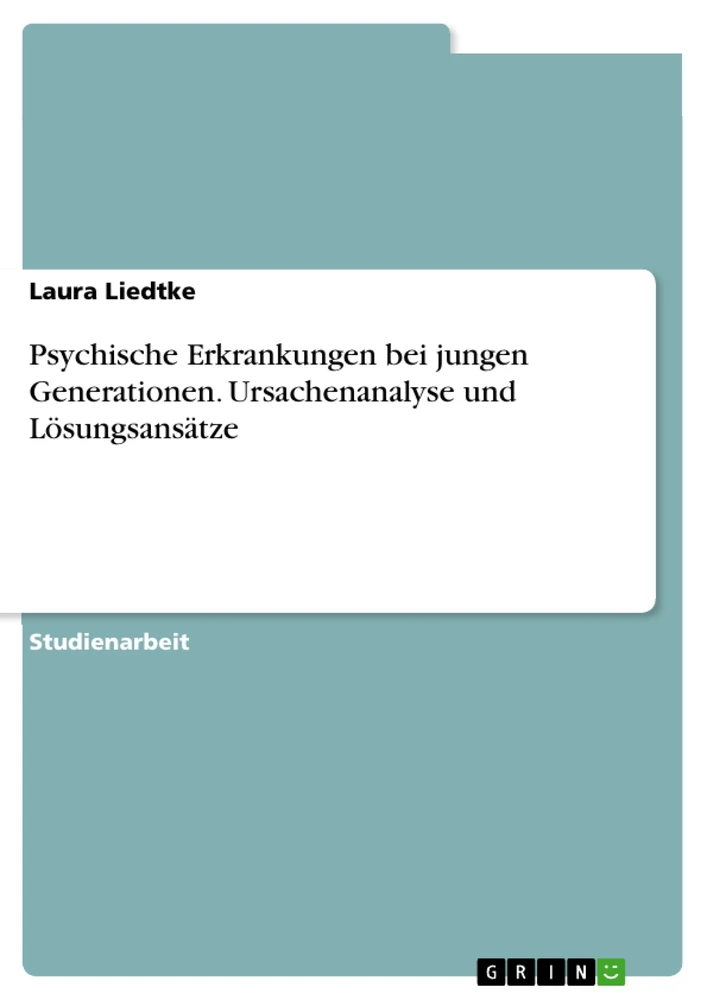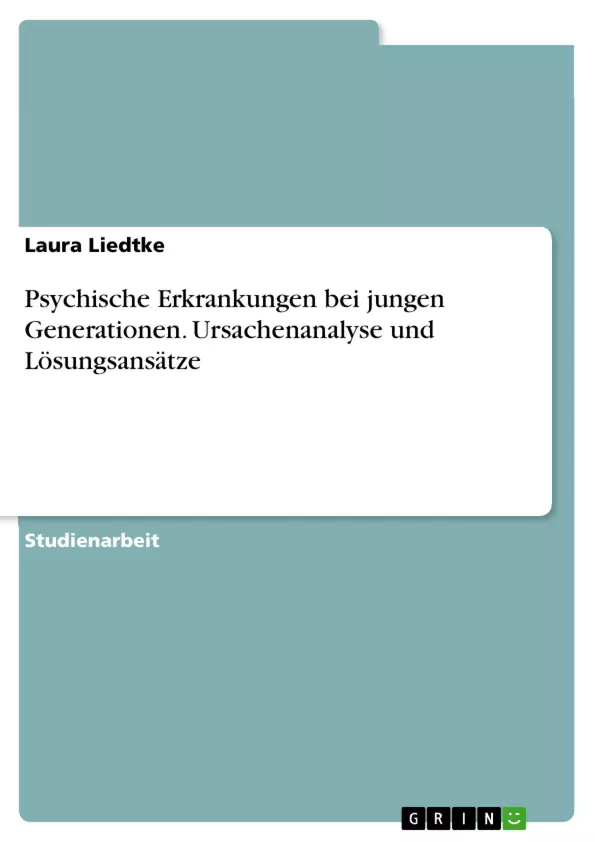Psychische Erkrankungen rücken zunehmend in den Fokus von Wissenschaft und Gesellschaft. Besonders junge Menschen im Alter bis 25 Jahre scheinen davon betroffen zu sein. Laut einer Auswertung von Statista zum Gesundheitsreport 2024 steigen die Raten von psychischen Störungen wie Depressionen, Angstzuständen und Stress in Deutschland kontinuierlich an. Diese Entwicklung betrifft nicht nur die betroffenen Personen, sondern belastet Wirtschaft und Gesundheitssystem durch steigende Kosten und Produktionsausfälle. Diese Entwicklung verstärkt sich seit zwei Jahrzehnten. Vor diesem Hintergrund erscheint es wichtig herauszufinden, welche Ursachen für den Anstieg psychischer Erkrankungen bei jungen Erwachsenen und Kindern verantwortlich sind und mögliche Lösungsansätze zu entwickeln, um die mentale Gesundheit der Betroffenen zu fördern.
c_1
4 Analyse
5 Methodenkritik
6 Fazit
7 Praxistransfer
III. Literaturverzeichnis
IV. Hinweis zur Datei
V. Anlagenverzeichnis (flüchtige Literatur)
I. Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 eigene Darstellung PRISMA Diagramm angelehnt an Page et al. (2021)
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
Psychische Erkrankungen rücken zunehmend in den Fokus von Wissenschaft und Gesellschaft (Keles et al., 2020, S. 79; Keyes & Platt, 2024, S. 385f.). Besonders junge Menschen im Alter bis 25 Jahre scheinen davon betroffen zu sein (American Psychological Association, 2019). Laut einer Auswertung von Statista zum Gesundheitsreport 2024 (DAK-Gesundheit, 2025, S. 27) steigen die Raten von psychischen Störungen wie Depressionen, Angstzuständen und Stress in Deutschland kontinuierlich an. Dieser Zustand betrifft nicht nur die betroffenen Personen, sondern belastet Wirtschaft und Gesundheitssystem durch steigende Kosten und Produktionsausfälle (Pimpertz, 2024, S. 1). Diese Entwicklung verstärkt sich seit zwei Jahrzehnten (Twenge et al., 2019, S. 185). Vor diesem Hintergrund erscheint es wichtig herauszufinden, welche Ursachen für den Anstieg psychischer Erkrankungen bei jungen Erwachsenen und Kindern verantwortlich sind und mögliche Lösungsansätze zu entwickeln, um die mentale Gesundheit der Betroffenen zu fördern.
1.2 Theoretischer Hintergrund
Bisher ist der Nachweis eines kausalen Zusammenhangs vom Einfluss bestimmter Faktoren auf die mentale Gesundheit schwer nachweisbar (Keyes & Platt, 2024, S. 387f.). Die Ursachen für den Anstieg von psychischen Störungen und die Entwicklung von internalisierenden Symptomen sind vielfältig und werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst, so dass theoretische Modelle dabei helfen sollen, die Zusammenhänge zu verstehen (Keyes & Platt, 2024, S. 387).
Die Erklärung von Depressionen wird in biologischen Theorien vorrangig durch den Einfluss und die Störung von Hormonen und dem endokrinem System erläutert (Bernaras et al., 2019, S. 2). Die Störung dieser Funktionen sorgt dafür, dass betroffene Personen häufig unter Schlafstörungen leiden und oftmals ein Gefühl von Einsamkeit und Traurigkeit verspüren, was Symptome für Depressionen sind (Narbona, 2014). Ein weiterer Faktor ist die Genetik bei der Entstehung von psychischen Erkrankungen. So fanden Forscher heraus, dass eine starke Reaktion der Amygdala auf Stress in der Kindheit, das psychische System beeinflussen kann und bestimmte Gene einen besonderen Einfluss auf stressbedingte depressive Störungen haben (Bernaras et al., 2019, S. 6).
Psychologische Theorien zur Erklärung von Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen beziehen sich vor allem auf Bindungstheorien und Verhaltensmodelle und berücksichtigen den Einfluss von stressigen Lebensereignissen sowie soziokulturellen Modellen (Bernaras et al., 2019, S. 2). Bindungstheorien betonen die Wichtigkeit von frühen Bindungsprozessen und -erfahrungen, die Kinder im frühen Alter bereits erleben (Bowlby, 2003, S. 11). Skinner beschreibt in seinem Verhaltensmodell zum operanten Konditionieren, das Verhalten durch Belohnung und Bestrafung erlernt wird (Skinner, 1953). Das kann dazu führen, dass Kinder, die depressive Verhaltensweisen, wie starkes Weinen, anfangs noch zeigen, da das soziale Umfeld dies verstärkt. Bei anhaltendem Verhalten erfahren Kinder später oftmals ein aversives Verhalten aus dem Umfeld, was zur sozialen Isolation führt und die Depression verstärkt (Bernaras et al., 2019, S. 7). Kognitive Theorien befassen sich mit Modellen, wie der gelernten Hilflosigkeit (Abramson & Seligman, 1978, S. 50f.), die darauf beruht, dass negative Erlebnisse intern attribuiert und als stabil angesehen werden und so die Entstehung von Depressionen fördert. Ebenso stehen stressige Ereignisse im Zusammenhang mit der Verarbeitung der Informationen aus diesen Erlebnissen, welche negative Denkmuster fördern und zu beeinträchtigenden Wahrnehmungsverzerrungen führen können (Beck et al., 2002, S. 275ff.). Weitere Studien zeigen, dass viele betroffene Personen im Jahr zuvor schwere oder stressige Lebensereignisse erlebt haben, bevor eine Depression entwickelt wurde (Bernaras et al., 2019, S. 8).
1.3 Gang der Untersuchung
Diese Arbeit ist so aufgebaut, dass die Fragestellung systematisch bearbeitet und erläutert wird. Das erste Kapitel stellt die Relevanz des Themas auf und zeigt den aktuellen Stand der Forschung, sowie die verwendete Methode in der Untersuchung und mögliche Limitationen, die dabei aufgetreten sind. Das zweite Kapitel beschreibt grundlegenden Begriffe, die für den Kontext dieser Arbeit wichtig sind. Die darauffolgende Passage widmet sich der inhaltlichen Untersuchung. Unter anderem wird das Vorgehen und die Durchführung der qualitativen Inhaltsanalyse beschrieben und angewendet. Die Analyse der gewonnenen Erkenntnisse wird im vierten Kapitel erläutert. Im letzten Teil werden die Ergebnisse kritisch diskutiert und mögliche Lösungsansätze für die Verbesserung der mentalen Gesundheit vorgeschlagen.
1.4 Methode
Mithilfe einer systematischen Literaturrecherche wird die, für diese Arbeit verwendete Literatur, erschlossen. Dafür werden in Vorbereitung auf die Recherche Schlagworte und Synonyme gesucht, die zu der Fragestellung und dem Thema dieser Arbeit passen.

Tabelle 1 eigene Darstellung Übersicht Schlagworte und Synonyme
Quelle: Eigendarstellung
Anschließend werden diese mithilfe eines booleschen Verbands im Recherchetool EBSCO eingegeben.

Tabelle 2 eigene Darstellung Boolescher Verband
Quelle: Eigendarstellung

Abbildung 1 eigene Darstellung PRISMA Diagramm angelehnt an Page et al. (2021)
Weitere Literatur ergibt sich durch Rückwärtsrecherche, der in den Artikeln angegebenen Literaturangaben oder explizite Suche nach Fachliteratur für Definitionen. Die Anzahl an Ergebnissen der Literatur zeigt, dass das Thema aktuell ist und bereits viel in dem Bereich geforscht wird. Aus diesem Grund eignet sich die Auswertung des erhobenen Materials mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring & Fenzl, 2019, S. 42f.) und wird durch eine Forschertriangulation in der Objektivität der Ergebnisse bestärkt.
Die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse wird in Kapitel 3.1 weiter beschrieben.
2 Begriffserklärungen
2.1 mentale Gesundheit
Die mentale oder auch psychische Gesundheit umfasst das Wohlbefinden, die Stressverarbeitung, die Fähigkeit zum produktiven Arbeiten sowie die Teilhabe an sozialen Interaktionen (WHO, o.J.). Eine positive mentale Gesundheit ist für die körperliche Verfassung und die Produktivität von großer Bedeutung, da sie die Regulierung und den Ausgleich von Emotionen fördert und wichtige körperliche Funktionen unterstützt (Deviantony et al., 2024, S. 291). Eine negative mentale Gesundheit kann, vor allem bei Kindern und Jugendlichen, zu einem Anstieg von psychischen Erkrankungen wie zum Beispiel Angst, Depressionen oder Essstörungen bis hin zu suizidalem Verhalten führen (Cavioni et al., 2021, S. 1). Suizid und suizidales Verhalten (Suizidgedanken, Selbstverletzung) sind die führende Todesursache und größter Faktor für die Sterblichkeit bei Kindern und Jugendlichen weltweit (Keyes & Platt, 2024, S. 386f.). Psychische Störungen und Erkrankungen werden in den Klassifikationen des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Health (DSM-5) der American Psychiatric Association und der International Classification of Diseases (ICD-10) der Weltgesundheitsorganisation definiert (American Psychiatric Association, 2013; WHO, 2018).
2.2 Generation Z
Die Generation Z, beschreibt die Personengruppen, die zwischen 1996 und 2010 geboren worden sind (Institut für Generationsforschung, o.J.). Sie zeichnen sich durch eine hohe Technikaffinität aus und sind die erste Generation, die vom Kindesalter an mit dem Internet und Smartphones aufgewachsen sind (Liang, 2024, S. 439).
2.3 Social Media
Social Media umfasst und beschreibt Anwendungen, bei denen Nutzer untereinander private Inhalte teilen und miteinander interagieren können. Aktuellste Beispiele für sozialen Netzwerken sind unter anderem Instagram und TikTok, die sich durch individuelle Einspielung von Inhalten für Nutzer kennzeichnen (Liang, 2024, S. 439).
3 Empirische Untersuchung
3.1 Beschreibung der Methode
In dieser Arbeit wird die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (Mayring & Fenzl, 2019, S. 633ff.) als Methode verwendet, um die umfangreichen Textinhalte systematisch zu untersuchen und die zentralen Aussagen herauszuarbeiten. Diese Methodik kombiniert deduktive Kategorienbildung mit der Möglichkeit zur induktiven Anpassung, um relevante Inhalte systematisch zu erfassen (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 39).
Zunächst erfolgt die Kategorienbildung deduktiv angelehnt am Umfeldanalyse-Modell PEST (politcal, economic, social, technical). Diese Begriffe entsprechen zunächst den vier festgelegten Oberkategorien, wonach die ausgewählten wissenschaftlichen Artikel inhaltlich untersucht werden. Die Auswertung der codierten Inhalte führt dazu, dass die zuvor deduktiv gebildeten Kategorien induktiv angepasst werden müssen. Somit ergeben sich die Oberkategorien biologische Merkmale, Wirtschaft, Sozial und Digitalisierung. Den Oberkategorien sind verschiedene Unterkategorien zugeordnet. Beispielsweise gehören zu den biologischen Merkmalen die Unterkategorien Geschlecht und Genetik, während der Oberkategorie Wirtschaft die Themen Einkommen und Arbeitslosigkeit zugeordnet sind. Weitere Aspekte wie Lebensereignisse, soziale Interaktion, Beziehungen, Bildung, Familie, Ungleichheit, Pandemie, Waffengewalt, Drogenkonsum und Erziehung werden zur Oberkategorie Sozial zusammengefasst. Zuletzt gehören die Themen Digitale Medien, Cybermobbing und soziale Medien zur Gruppe Digitalisierung.
Die Flexibilität aus deduktiver und induktiver Kategorienbildung ermöglicht es, dass zunächst theoretisch hergeleitete Kategorien mit empirisch relevanten Aspekten kombiniert werden und in die Analyse einfließen (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 39f.; Mayring & Fenzl, 2019, S. 633f.).
3.2 Durchführung der Methode
Für die Durchführung der Analyse liegen vier wissenschaftliche Artikel zur Verfügung vor, die dem Thema dieser Arbeit und der Forschungsfrage entsprechen. In den jeweiligen Artikeln werden zunächst die relevanten Textstellen markiert und anschließend in einer Excel-Tabelle extrahiert und erfasst. Die Textpassagen werden für eine einfachere und einheitliche Bearbeitung sinngemäß ins Deutsche übersetzt mithilfe von Übersetzungstools wie deepl.com. Anschließend werden die extrahierten Textstellen inhaltlich zusammengefasst und die wichtigsten Kernaussagen darin hervorgehoben. Diese Informationen werden als Grundlage genutzt, um die entwickelten Unterkategorien zuzuordnen. Im weiteren Schritt werden diese zu den induktiv hergeleiteten Oberkategorien zusammengefasst und die wichtigsten Kernaussagen gebildet.
Um die Belastbarkeit und Objektivität der gebildeten Kernaussagen zu bekräftigen, wird eine Forschertriangulation mit einer unabhängigen Person durchgeführt (Castiblanco & Vizcaino, 2019, S. 174). In diesem Prozess begutachtet die zweite Forscherperson die Kernaussagen und prüft, ob Sie zu dem gleichen Ergebnis kommt auf Grundlage der erschlossenen Textinhalte. Dieser zusätzliche Schritt unterstützt dabei subjektive Verzerrungen zu verringern und die Validität der Ergebnisse zu erhöhen.
Durch die Ausarbeitung der relevanten Textstellen in einer Excel-Tabelle (Anlage a), ist die intersubjektive Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse jederzeit gegeben.
3.3 Auswertung
3.3.1 Wirtschaft
Faktoren wie Arbeitslosigkeit, Unsicherheit im Job, wirtschaftliche Entwicklungen und Instabilität der Wirtschaft beeinflussen das psychische Wohlbefinden der Eltern, was sich auf die mentale Gesundheit der Kinder auswirkt (Tamirisa & Maringanti, 2024, S. 2). Durch Arbeitslosigkeit verursachte finanziellen Schwierigkeiten haben zur Folge, dass Eltern unter zusätzlichem Stress stehen, so dass häufig eine Verschlechterung der schulischen Leistungen bei den Kindern zu vermerken ist (Tamirisa & Maringanti, 2024, S. 3).
Es gibt Unterschiede zwischen einkommensstarken und einkommensschwachen Familien, wobei letztere häufiger von psychischen Störungen betroffen sind (Keyes & Platt, 2024, S. 393). Das äußert sich auch darin, dass sich die mentale Gesundheit nachweislich verbessert, sobald die Einkommensungleichheit sich verringert (Keyes & Platt, 2024, S. 393). Die Wirtschaftslage hat Einfluss auf das Armutsverhältnis, welches dynamisch ist, so dass in Krisenzeiten ein Anstieg psychischer Erkrankungen bei Erwachsenen und Kindern zu verzeichnen ist (Keyes & Platt, 2024, S. 393).
Wirtschaftliche Faktoren allein sind nicht die Ursache für den Anstieg psychischer Störungen in den letzten Jahren, da sich die Wirtschaftslage, beispielsweise in den USA im vergangenen Jahrzehnt erholt hat und Aspekte wie Produktionsrückgänge und Einkommensungleichheit seit mehreren Jahrzehnten zu verzeichnen sind (Twenge, 2020, S. 20).
3.3.2 Biologische Merkmale
Mädchen und Frauen sind häufiger von psychischen Problemen betroffen als Jungen und Männer (Keyes & Platt, 2024, S. 389). Sie erleben eher sexualisierte Gewalt und Missbrauch als Männer, die wiederum häufiger von physischer Gewalt betroffen sind (Keyes & Platt, 2024, S. 388). Jungen und Männer tendieren dazu negative Gedanken und Emotionen zu internalisieren und diese nicht zu kommunizieren, so dass sie häufig antisoziale Verhaltensweisen in Form von Aggressivität oder Suchtverhalten entwickeln (Keyes & Platt, 2024, S. 389).
Mädchen und Frauen kommunizieren negative Emotionen und Gedanken anderen gegenüber offener, entwickeln stattdessen allerdings mehr Formen psychischer Störungen, wohingegen Männer anfälliger für Alkohol- und Drogenmissbrauch sind (Keyes & Platt, 2024, S. 389ff.). Frauen sind eher von Mobbing und Cybermobbing betroffen als Männer und sind stärker negativ beeinflusst durch soziale Medien (Keyes & Platt, 2024, S. 394).
- Arbeit zitieren
- Laura Liedtke (Autor:in), 2025, Psychische Erkrankungen bei jungen Generationen. Ursachenanalyse und Lösungsansätze, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1575113