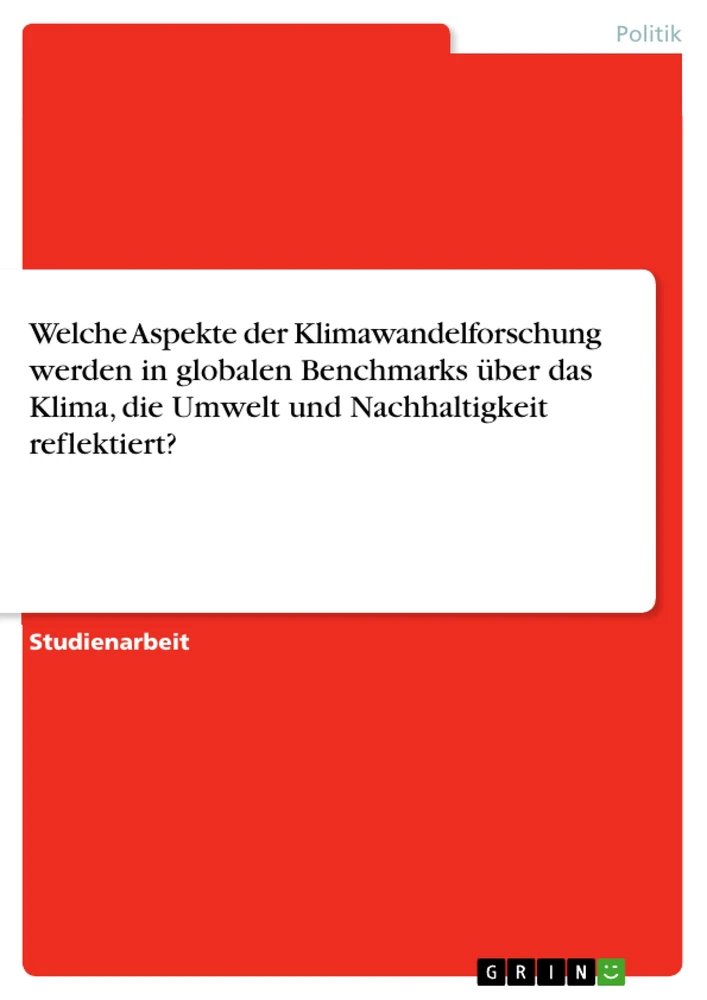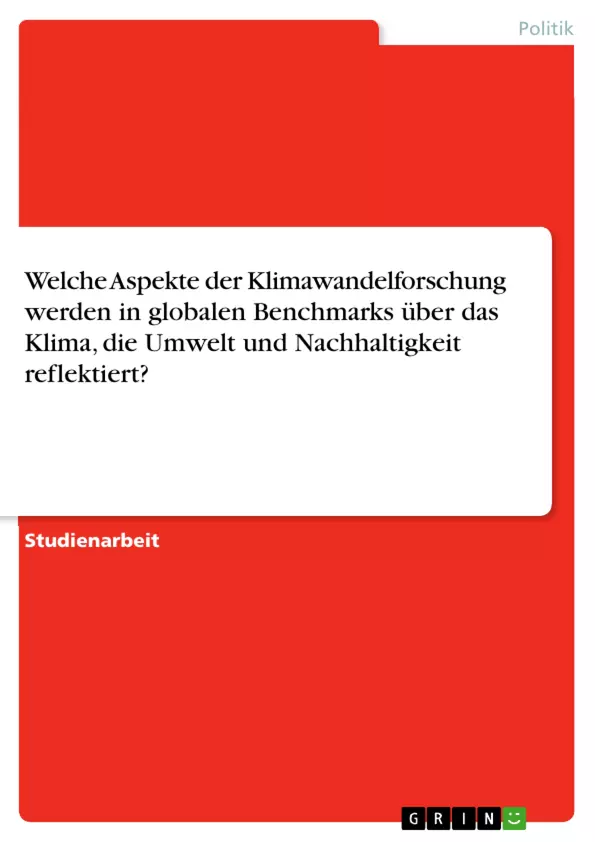Welche Aspekte der Klimawandelforschung werden in globalen Benchmarks über das Klima, die Umwelt und Nachhaltigkeit reflektiert – oder nicht?
Im zweiten Kapitel werden Benchmarks als Instrumente des Weltregierens präsentiert, wobei zunächst Global Governance und die relevanten Bereiche Klimawandel, Umwelt und Nachhaltigkeit vorgestellt werden. Die theoretische Einführung in die Welt des Benchmarkings definiert wichtige Begriffe und stellt dann aus konstruktivistischer Sicht dar, dass Benchmarks Formen sozialen Drucks sind, die Einfluss auf das Verhalten von Akteur:innen haben. Ebenfalls werden Funktionen von Benchmarks vorgestellt mit Schwerpunkt auf Agenda Setting, was in dieser Arbeit besonders relevant ist. Schließlich wird ein Überblick über Aspekte der Klimawandelforschung und wissenschaftliche Diskurse im Klimawandel-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsbereich gegeben. Im dritten Kapitel werden zunächst die behandelten Themen von Benchmarks herausgearbeitet. Dafür werden auf Grundlage des Analysefokus von Benchmarks Kategorien für Themen entwickelt und die Benchmarks in diese eingeordnet. Daraufhin erfolgt die Analyse der Ergebnisse der Kategorisierung, darunter der herausgearbeitete Fokus von Benchmarks sowie der Abgleich der in Benchmarks enthaltenen Themen mit den Aspekten der Klimawandelforschung, die im zweiten Kapitel vorgestellt wurden. Abschließend wird das methodische Vorgehen im Fazit kritisch beleuchtet und die Forschungsfrage beantwortet.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2. Benchmarks als Instrumente. des Weltregierens
2.1 Dimensionen von Global Governance: Klimawandel, Umwelt und Nachhaltigkeit
2.2 Theoretische Einführung in die Welt des Benchmarkings
2.3 Aspekte der Klimawandelforschung
3. Benchmarks im Bereich Klimawandel, Umwelt und Nachhaltigkeit
3.1 Auf der Agenda: Kategorisierung der Themen
3.2 Vergleich enthaltener Themen in Benchmarks mit Aspekten der Klimawandelforschung
4. Fazit
5. Literaturverzeichnis
6. Anhang
Abkürzungsverzeichnis
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
Die Auswirkungen des Klimawandels1 haben „[...] for the first time in human history [...] the potential to endanger the fate of humanity” (Hayden et al., 2020, 1). Das Vertrauen, das Problem auf der Bühne des Weltregierens zu lösen, sinkt zunehmend (Delmas & Young, 2009). Trotz bestehenden wissenschaftlichen Konsenses über den Klimawandel (Gines, 2011, 2) ist kein politischer Konsens hinsichtlich des Umgangs mit dem Problem und seinen Konsequenzen entstanden (Hoffmann, 2018, 657). Handlungsbedarf besteht jedoch auf globaler Ebene, weil Umweltprobleme über staatliche Grenzen hinausgehen (DeSombre & Li, 2018, 630).
Auf der Bühne der Globalen Governance spielen unzählige Akteur:innen eine Rolle und versuchen, das globale Handeln zu beeinflussen (Weiss & Wilkinson, 2018, 10). Dabei herrscht auch Uneinigkeit darüber, welche Themen diskutiert werden sollen und welche Priorität diese innehaben sollen, was den Prozess des Agenda Settings beschreibt (Zahariadis, 2016, 5). Benchmarks haben Einfluss auf die Themen der Agenda, indem der Fokus auf bestimmte Themen gelegt wird, die behandelt bzw. ausgelassen werden - kurz, Benchmarks verengen den Blick und verändern die Wahrnehmung der Öffentlichkeit (Kingdon, 1984; Zahariadis, 2016, 5). Benchmarks beeinflussen über sozialen Druck das Handeln von Akteur:innen und sind somit Instrumente von Global Governance. Folglich können sie dazu beitragen Handlungsveränderungen zu erzielen, um den Klimawandel global bekämpfen zu können.
Benchmarks verkörpern ebenfalls Ideen und Annahmen und verdecken folglich eine Reihe an politischen Kalkulationen, Agenden und Interessen der Erschaffenden (Broome & Quirk, 2015, 823). Die behandelten Themen von Benchmarks müssen deshalb nicht der Gesamtheit der wissenschaftlichen Ideen und Annahmen entsprechen. Benchmarks beeinflussen jedoch den heutigen und zukünftigen globalen Umgang mit dem Klimawandel und somit auch die langfristigen Auswirkungen, welche die gesamte Menschheit sowie die Erde gefährden. Es sollten möglichst viele Themen mit wissenschaftlicher Bedeutung in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gelangen - nicht nur solche, die auch mit Benchmarks auf die Agenda gesetzt werden bzw. besonders viel Beachtung bekommen. Es ist daher gesellschaftlich und wissenschaftlich relevant die von Benchmarks behandelten Themen herauszuarbeiten und mit denen zu vergleichen, die Gegenstand des wissenschaftlichen Diskurses sind. Somit können einerseits Lücken identifiziert werden. Andererseits kann herausgearbeitet werden, ob es einen Fokus von Benchmarks gibt bzw. ob dieser begründet werden kann durch Aspekte der Klimawandelforschung. Bisher gibt es keine Arbeit, die einen Überblick bietet im Klimawandelbereich über die Themen, die Benchmarks behandeln bzw. bewerten und mit denen wissenschaftlicher Forschung vergleicht. Die vorliegende Arbeit soll diese Lücke schließen und untersucht daher die Forschungsfrage:
Welche Aspekte der Klimawandelforschung werden in globalen Benchmarks über das Klima, die Umwelt und Nachhaltigkeit reflektiert - oder nicht?
Im zweiten Kapitel werden Benchmarks als Instrumente des Weltregierens präsentiert, wobei zunächst Global Governance und die relevanten Bereiche Klimawandel, Umwelt und Nachhaltigkeit vorgestellt werden. Die theoretische Einführung in die Welt des Benchmarkings definiert wichtige Begriffe und stellt dann aus konstruktivistischer Sicht dar, dass Benchmarks Formen sozialen Drucks sind, die Einfluss auf das Verhalten von Akteur:innen haben. Ebenfalls werden Funktionen von Benchmarks vorgestellt mit Schwerpunkt auf Agenda Setting, was in dieser Arbeit besonders relevant ist. Schließlich wird ein Überblick über Aspekte der Klimawandelforschung und wissenschaftliche Diskurse im Klimawandel-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsbereich gegeben. Im dritten Kapitel werden zunächst die behandelten Themen von Benchmarks herausgearbeitet. Dafür werden auf Grundlage des Analysefokus von Benchmarks Kategorien für Themen entwickelt und die Benchmarks in diese eingeordnet. Daraufhin erfolgt die Analyse der Ergebnisse der Kategorisierung, darunter der herausgearbeitete Fokus von Benchmarks sowie der Abgleich der in Benchmarks enthaltenen Themen mit den Aspekten der Klimawandelforschung, die im zweiten Kapitel vorgestellt wurden. Abschließend wird das methodische Vorgehen im Fazit kritisch beleuchtet und die Forschungsfrage beantwortet.
2. Benchmarks als Instrumente des Weltregierens
2.1 Dimensionen von Global Governance: Klimawandel, Umwelt und Nachhaltigkeit
Das Konzept des Klimawandels erschien Ende der 1980er das erste Mal auf der internationalen politischen Agenda (Hoffmann, 2018, 658). Heute gibt es eine überwältigende Anzahl an Forschung, die bestätigt, dass es den Klimawandel gibt und menschliches Verhalten zum Großteil verantwortlich ist2, dass die Auswirkungen bereits global spür- und messbar sind, dass einige geographische Regionen vulnerabler sind als andere und dass es gemeinsamen, globalen Anstrengungen bedarf, um den Klimawandel zu bekämpfen (Gines, 2011, 2). Nicht nur Umweltprobleme gehen über staatliche Grenzen hinaus und bedürfen globaler Steuerung (DeSombre & Li, 2018, 630): Die Energie- und Wirtschaftssysteme, die den Klimawandel verursachen, sind ebenfalls globaler Natur (Hoffmann, 2018, 655). Benchmarks sind Instrumente des Weltregierens und bewerten sämtliche Bereiche davon. Um zu untersuchen, ob relevante Unterscheidungen im Rahmen der Analyse von Themen getroffen werden können, wird in diesem Kapitel das Konzept von Global Governance und spezifischen Bereichen mit Bedeutung für den Klimawandel untersucht.
Global Governance (GG)3 beschreibt die Struktur und Ordnung der Gesamtheit der informellen und formellen Arten, wie die Welt regiert wird (Weiss & Wilkinson, 2018, 9f.). Dabei geht es nicht nur um die Beziehungen zwischen Staaten auf globaler Ebene, sondern auch um die globalen Politikgestaltungsprozesse und deren Implementierung auf allen Ebenen4, die Effekte von lokalen Handlungen auf globaler Ebene und die Beziehungen zwischen Institutionen, Akteur:innen und Mechanismen auf jedem Level dazwischen (Ebd., 10). Akteur:innen in GG sind alle, die auf jeglicher Ebene in einem Feld agieren, darunter Staaten, Internationale Organisationen (IOs), Multinationale Unternehmen (MNCs), transnationale Netzwerke, Medien, private Regulatoren und Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Es existieren verschiedene Felder von Global Governance. In dieser Arbeit sind drei relevant: Global Climate Change Governance, Global Environmental Governance und Global Sustainability Governance.
Die Themen Klima bzw. Klimawandel5, Umwelt und Nachhaltigkeit sind eng miteinander verwandt und gehen grundsätzlich miteinander einher. Es gibt unzählige Theorien und Ansätze über den Klimawandel und mögliche Lösungsstrategien, weil es so ein komplexes Problem darstellt (Gines, 2011, 3). Dies erschwert definitorische Abgrenzungen. Nach dem vorherrschenden Klimaverständnis kann Umwelt von Klima getrennt werden (Kuzemko, 2015, 981); Umweltprobleme sind jedoch komplexer und interdependenter geworden, weil sie zunehmend mit menschlichem Verhalten zusammenhängen (DeSombre & Li, 2018, 641). Global Environmental Governance (GEG) umfasst sämtliche Themen der Umwelt, unter anderem deren Schutz und Erhalt, wobei sich viele Institutionen mit vier Hauptthemen beschäftigen: den Ozeanen, der Biodiversität, der Atmosphäre und den toxischen Materialien (DeSombre & Li, 2018, 633). Dahingegen beschäftigt sich Global Climate Change Governance (GCCG)6 lediglich mit den Strukturen und Mechanismen des Weltregierens rund um die Bekämpfung des Klimawandels, was einerseits technische Probleme wie die Emissionsreduzierung und anderseits Bereiche wie die Anpassungsfähigkeit zum sich verändernden Klima abdeckt (Green, 2021, 118f.). Das Problem des Klimawandels der wichtigste Teil von Global Environmental Governance (Hoffmann, 2018, 655), die Abgrenzung des Governance-Bereiches verdeutlicht jedoch auch die definitorische Trennung von Klima und Umwelt. Global Sustainability Governance (GSG) umfasst die Herausforderung anhaltender und langfristiger Nachhaltigkeit in Umwelt und Gesellschaft, um das Überleben der Menschheit und der Erde zu sichern (Hayden et al., 2020, 1). Dies könne nicht geschehen ohne das Infragestellen der „[...] broader, deeper causes underlying the major sustainability challenges that we are experiencing and without debating who defines and benefits from the proposed solutions” (Ebd., 2). Nach dieser Auffassung unterscheidet sich GSG vor allem von GEG und GCCG durch die zugrundeliegenden kritischen Theorieansätze. Dementsprechend sind für die Bekämpfung des Klimawandels und alternativen Umgang mit der Umwelt ebenfalls neue Innovationen erforderlich.
Zusammenfassend sind definitorische Abgrenzungen zwischen den Bereichen globaler Governance GEG, GCCG und GSG zwar möglich, aufgrund der fließenden Übergänge werden alle Indizes jedoch gemeinsam diskutiert und kategorisiert.
2.2 Theoretische Einführung in die Welt des Benchmarkings
Die Produktion und Nutzung von Performanzevaluationstechniken ist in allen Bereichen des modernen sozialen und politischen Lebens (Cooley, 2015, 10) und damit auch im Kontext der Global Governance stark angestiegen (Broome & Quirk, 2015, 819; Davis et al., 2012, 3; Kelley & Simmons, 2019, 493). Benchmarks sind Instrumente des Weltregierens, wenn sie darauf abzielen, Messungen zur Vergleichbarkeit von Performanz über mehrere Länder und Regionen hinweg zu produzieren (Broome & Quirk, 2015, 821). Verschiedene Autor:innen nutzen dabei unterschiedliche Überbegriffe, um die Praxis des Bewertens und Vergleichens zu beschreiben. Allgemein verwendet sind jedoch die Bezeichnung Indikator, Index, Ratings und Rankings.
Ein Indikator ist die „[...] named collection of rank-ordered data that purports to represent the past or projected performance of different units” (Davis et al. 2012, 6). Indikatoren sind in jedem Index, Ranking, Rating oder sonstigen Tools zur Bewertung enthalten, weil sie festlegen, nach welchen Maßstäben etwas bewertet wird (Ebd.). Der Prozess, wie Indikatoren Rohdaten simplifizieren und das Endprodukt benennen, ist unterschiedlich, letztlich geschieht jedoch immer eine Simplifikation, etwa durch die Aggregation von mehreren Quellen oder das Filtern von bestimmten Daten (Ebd.). Eine Benchmark besteht meist aus mehreren Indikatoren.
Ratings und Rankings sind unterschiedliche Methodiken zur Bewertung von Akteur:innen. Ein Rating gibt der Performanz von Akteur:innen einen diskreten Wert, Indikator oder eine Note, welche unabhängig von der Bewertung anderer Einheiten sind (Cooley 2015, 13). Dahingegen ist ein Ranking inhärent relativ, da Akteur:innen im Vergleich zueinander ordinale Plätze in einer Liste zugewiesen werden (Ebd.).
Inhaltlich überschneiden, ergänzen oder unterscheiden sich die Überbegriffe hinsichtlich der Fragen, welche Akteur:innen bewertet werden sollen, was bewertet und mit welchen Messkonzepten dies getan werden soll. So verwenden Davis et al. (2012) den bereits vorgestellten Begriff Indikator, während Kelley und Simmons (2019) von Global Performance Indicators (GPIs) und Broome und Quirk (2015) von Benchmarks sprechen. GPIs sind „[.] regularized public assessments that rate, rank, and categorize state policies, qualities, and/or performance” (Kelley & Simmons, 2019, 491), die Indizes, Indikatoren sowie kategorische Assesments und Blacklists und Watchlists in der Definition umfassen (Ebd.). Benchmarking ist breiter definiert und meint die „[.] classification of relative performance or value“ (Broome & Quirk, 2015, 820), wobei sämtliche Indikatoren, Rankings, Prüfungen, Indizes, Baselines und Ziele mit Benchmarks gemeint sind (Ebd.). Gleichzeitig begreifen Broome und Quirk (2015) die zu bewertenden Einheiten umfassender mit Akteur:innen, Populationen oder Institutionen (Ebd.) - nicht nur Staaten, wie bei Kelley und Simmons (2019).
In Anbetracht des breiten Analysefokus dieser Arbeit bezüglich sämtlicher Themen und Aspekte in GCCG, GEG und GSG und der Diversität der Akteur:innen in GG wird der umfassendere Oberbegriff der Benchmarks im Folgenden verwendet. Konkret werden in dieser Arbeit unter Benchmarks sämtliche Performanzevaluationstools verstanden. Ebenfalls sind jegliche bewertbare oder vergleichbare Dimensionen, darunter Policies, Qualitäten oder Performanz von Staaten, IOs, NGOs, MNCs oder auch Zustände des Klimas und der Umwelt, in der Analyse eingeschlossen.
Die Produktion von Benchmarks ist ein kollektiver Prozess (Davis et al. 2012, 13) mit dem Ziel auf die Prioritäten von Staaten, die öffentliche Wahrnehmung und die Entscheidung ökonomischer Akteur:innen Einfluss zu nehmen (Doshi et al., 2019, 611). Anders ausgedrückt haben Benchmarks die Macht Global Governance zu beeinflussen (Davis et al., 2012, 3; Kelley & Simmons, 2019, 491). Zwei Haupttheorien erklären wie bzw. warum Staaten und andere Akteur:innen auf äußere Bewertung reagieren (Cooley, 2015, 4ff.)7. Lediglich darüber nehmen Benchmarks Einfluss auf die aktuellen und geplanten Handlungsstrategien von Akteur:innen hinsichtlich des Klimawandels, was die langfristige Bekämpfung beeinflusst.
Der Sozialkonstruktivismus ist eine Sozialtheorie auf Grundlage der Überzeugung, dass Menschen, ihre Interessen und Identitäten durch den sozialen Kontext, in dem sie leben, beeinflusst werden (Finnemore & Sikkink 2001: 393). Ideen und Normen haben für die Konstruktion der sozialen Welt eine große Bedeutung (Krell & Schlotter, 2018, 248f.). Benchmarks enthalten sowohl Ideen und Weltanschauungen (Kelley & Simmons, 2019, 504), als auch Ideologien über ideale Gesellschaften und den Prozess diese zu erreichen (Davis et al., 2012, 9f.). Darüber hinaus haben alle Benchmarks die gemeinsame Grundlage, dass sie normative Werte und Agenden übersetzen in numerische Repräsentation, obwohl sich einzelne unterscheiden in Anzahl und Anwendung (Broome & Quirk 2015, 819). Der Identität von Akteur:innen8 kommt im Konstruktivismus eine bedeutende Rolle zu (Schimmelpfennig, 2021, 65). Akteur:innen handeln zudem nach der Logik der Angemessenheit9 (Ebd., 164ff.). Vor allem neuere Benchmarks sind „[...] relentlessly comparative, suggesting an intention to pressure, shame, or provoke competition [.]“ (Kelley & Simmons, 2019, 494). Dieser normative, soziale Druck (Cooley, 2015, 2; Doshi et al., 2019, 61) gefährdet sowohl die eigene Identität als auch die Reputation von Akteur:innen, weswegen Benchmarks als soziale Konstrukte Wirkung entfalten (Kelley & Simmons, 2019, 498f.). Benchmarks können folglich Kernkonzepte etablieren oder festigen, Akteursidentitäten beeinflussen, Entscheidungen darüber beeinflussen, was wie gemessen werden soll und Ideen sowie Eindrücke validieren oder hinterfragen (Davis et al., 2012, 10).
Benchmarks können zudem mehrere Rollen und Funktionen einnehmen. Einerseits fällen sie Urteile basierend auf Expertise und Wissenschaft über die Performanz von Akteur:innen sowie Mechanismen der globalen Regulation und dem Monitoring von Akteur:innen. Weiterhin stellen sie transnationale Aufklärungs- und Informationstools dar und werden auch von Rating und Ranking Organisationen (RROs)10 genutzt, um sich zu positionieren oder eine bestimmte Rolle einzunehmen (Cooley, 2015, 14-23). Zudem setzen Benchmarks Standards, indem sie theoretische Ansprüche dahingehend verkörpern, welche Maßstäbe angemessen sind, um die Performanz von Akteur:innen zu bewerten, was auch als standard-setting verstanden wird (Davis et al., 2012, 9f.).
Ebenso reflektieren Benchmarks über die Inhalte, die sie bewerten, eine Reihe an Themen und Problemen, die die Öffentlichkeit als wichtig ansieht, was als Agenda bezeichnet wird (McCombs & Shaw, 1972). Die Agenda enthält in irgendeiner Form eine Ordnung und Priorisierung der Themen, da die allgemein verfügbare Aufmerksamkeit begrenzt ist und Individuen und Institutionen eingrenzen müssen, welchen Themen wie viel Aufmerksamkeit geschenkt wird (Zahariadis, 2016, 5).
Letztlich gelangen nicht alle Themen auf die Agenda (Kingdon, 1984). Dieser Filterprozess selektiert Themen aus einem breiten Feld und verengt folglich den Blick der Öffentlichkeit und die Wahrnehmung, ob und wo gehandelt werden sollte. Agenda Setting meint dabei den Prozess die öffentlichen Themen in Handlungsfelder und in Prioritäten der Regierung bzw. anderen Akteur:innen mit Macht umzuwandeln (Zahariadis, 2016, 6). Nicht alle Agenden werden sich ausschließlich auf Dinge konzentrieren, die umsetzbar sind, aber es werden vorranging solche ernsthaft diskutiert, von denen politische Entscheidungsträger:innen glauben, dass sie beeinflussbar sind (Ebd., 5f.). Ob etwas auf der Agenda ist sowie mit welcher Priorisierung beeinflusst maßgeblich, ob etwas als ein Problem angesehen und wie dementsprechend gehandelt wird (Bali & Halpin, 2021).
Der wissenschaftliche Konsens hinsichtlich des Klimawandels hat dabei nicht politischen Konsens generiert, was erforderlich ist, um die notwendige, umfassende, globale Handlung zu erreichen (Hoffmann, 2018, 657). Dies liegt neben der Komplexität des Problems (Gines, 2011, 3) auch in der normativen Komponente, die in dem Prozess des Agenda Settings enthalten ist (Schroth et al., 2020, 1). Viele Faktoren haben Einfluss auf das Setzen von Themen auf die Agenda und die Prioritätensetzung, etwa Werte, Rollen, Ideen, Interessen und Perspektiven der Akteur:innen (Zahariadis, 2016, 5). Agenda Setting ist aus konstruktivistischer Sicht ebenso wie Benchmarking geformt von kulturellen, institutionellen, zeitlichen und politischen Annahmen (Ebd., 6). Benchmarks enthalten diese Annahmen bzw. basieren auf Ideen. Indem sie selektiv Themen behandeln oder nicht behandeln, agieren Benchmarks im Bereich des Agenda Settings. Die Themen auf der Agenda reflektieren dabei immer die als bedeutend wahrgenommenen Probleme, welche aufgrund des Filterprozesses nicht zwingend mit der Gesamtheit der Themen übereinstimmen müssen. Dies kann widerspiegeln, dass einige Themen besonders dringend sind. Es kann ebenfalls darin begründet sein, dass Akteur:innen bestimmte Themen von der Agenda fernhalten und andere dann mehr Beachtung bekommen. Diese Arbeit bereitet die weitere Forschung diesbezüglich vor, weil zunächst ein Überblick über die Themen gegeben und ein Vergleich mit Aspekten von Klimawandelforschung durchgeführt wird.
Zusammengefasst beeinflusst die Praxis des globalen Benchmarkings das Regieren der Welt. Benchmarks werden genutzt in Prozessen von GEG, GCCG und GSG, um neue Klimanormen zu etablieren und damit Klimagesetze und Verhaltensänderungen zu erzielen (Kuzemko, 2015, 970). Die Identitäten und das Verhalten von Akteur:innen wird beeinflusst, was Benchmarks zu Instrumenten von GG macht.
2.3 Aspekte der Klimawandelforschung
Benchmarks drücken Ideen und Weltanschauungen aus (Kelley & Simmons, 2019, 504), wobei nicht alle Themen auf die Agenda kommen bzw. in gleicher Weise priorisiert werden (Cobb & Ross, 1997, 25; Kingdon, 1984). Als Grundlage für den Vergleich mit den Themen von Benchmarks werden in diesem Kapitel Aspekte der Klimawandelforschung sowie zur Einordnung wissenschaftliche Diskurse zu den Themen des Klimawandels, der Umwelt und Nachhaltigkeit vorgestellt. Es gibt nach Gines (2011, xv-xvii) verschiedene Aspekte von Klimawandelforschung. Der wissenschaftlich beobachtbare, physische Prozess selbst wird in drei zentralen Kategorien untersucht: dem Klimasystem, Treibhausgasen und den Effekten auf das Ökosystem.
Erstens hat das zugrundeliegende Klimaverständnis einen Einfluss darauf, welche Elemente der Biosphäre in die Diskussion über Klimasysteme eingehen und welche den Rationalitäten und Technologien von Global Governance unterliegen (Allan, 2017).
Klima wird heute als globales geophysisches System verstanden11, das verschiedenen Formen von Governance unterliegt (Hart & Victor, 1993). Dies ist der Fall, weil es durch einen dynamischen und interaktiven Prozess zwischen Staaten und Wissenschaftler:innen entstanden ist (Allan, 2017, 131). Im Kontrast dazu vermitteln biologische und ökologische Wissenschaften ein nichtlineares, unbestimmtes und volatiles Bild von Klima in der Biosphäre unter einem ganzheitlichem Ansatz (Ebd., 132). Das Einbetten von Klima in den größeren Kontext zeigt die komplexen ökonomischen und sozialen Praktiken, die den anthropologischen Klimawandel verursachen, weil sie hervorheben, wie menschliche Aktivitäten die Systeme der Erden stören und ihnen schaden (Ebd.). So werden wirtschaftliches Wachstum und Nachhaltigkeit nicht als Widerspruch zueinander gesehen, was die akzeptierte Rolle von wirtschaftlichem Wachstum in westlichen kapitalistischen Gesellschaften verdeutlicht (Kuzemko, 2015, 979-981). Auf nationalem Level ist zu beobachten, dass Wachstum oft über Nachhaltigkeit und Umwelt gestellt wird (Ebd.).
Zweitens widmet sich das Climate Change Management der Bekämpfung des Klimawandels12. Dabei ist die Kontrolle der Treibhaugase einer der zentralsten Faktoren, durch den Menschen die Erderwärmung beeinflussen können, weil diese Emissionen die bedeutsamste Ursache von anthropogenem Klimawandel sind (Gines, 2011, 40). Die verbreitete Annahme, dass die ausschließliche Kontrolle dieser Treibhausgasemissionen zur präzisen Manipulierung der globalen Temperatur ausreichend ist, wird dabei aufgrund der unberechenbaren und komplexen Klimasysteme zumindest angezweifelt (Allan, 2017, 132). Politische Ideen über Klima und Umwelt sind enthalten in Benchmarks über die Art und Weise, in der Klimawandel als Problem identifiziert und verstanden wurde (Kuzemko, 2015, 973). Die Emissionsreduzierung als Hauptaugenmerk der GCCG ist auch Folge der Annahme, dass Klima separat von der Umwelt betrachtet werden kann (Ebd., 981). Im Verhalten der Akteur:innen hat dies zur Folge, dass Klima mitunter über Umwelt gestellt wird (Ebd.). Aspekte des globalen Energiesystems wie erneuerbare Energien werden hingegen miteingeschlossen in GCCG (Ebd.), da die globale Wirtschaft stark abhängig von einer ununterbrochenen Energieversorgung ist (Heubaum, 2018, 681), die Einhaltung der Pariser Klimaziele jedoch die drastische Reduzierung des weltweiten Emissionsausstoßes erfordert (Ebd., 687).
Drittens entstehen die Hauptauswirkungen auf Ökosysteme durch den globalen Temperaturanstieg und entstehen in den Dimensionen Wasser (Verfügbarkeit und Dürren), Ökosystemen (Speziessterben, Korallenriff, Waldbrände), Nahrung (Auswirkungen auf Landwirtschaft und Fischerei), Küstenregionen (Überflutung und Stürme) und Gesundheit (mehr Gesundheitsprobleme und höhere Sterblichkeit) (Gines, 2011, 82).
Ein weiterer Aspekt ist die Rolle von soziologischen Beziehungen zum Klimawandel, wie der Effekt auf Biodiversität, dem Konzept von Klimagerechtigkeit oder Auswirkungen auf die Gesellschaft. Innerhalb der Gesellschaft sind dabei einige Bevölkerungsgruppen, etwa Kinder oder ältere Menschen, vulnerabler gegenüber den Folgen (Ebd., 74f.). Einige Wissenschaftlerinnen in der GSG-Forschung warnen vor der ,Entmachtung’ der Bevölkerung in Klimafragen und Bedrohungen für Demokratien sowie zunehmenden Ungleichheiten, was bereits vulnerable Bevölkerungsgruppen zusätzlich gefährdet und beschreiben vor dem Hintergrund von Nachhaltigkeit die Werte und Kultur rund um Massenkonsum (Hayden et al., 2020, 2).
Ökonomische und sozioökonomische Auswirkungen des Klimawandels, also die ökonomischen Folgen von Veränderungen der Natur, stellen ebenfalls einen zentralen Aspekt der Klimawandelforschung dar. Die Privatwirtschaft passt sich bereits der Forderung nach einem langfristigen Umgang mit dem Klimawandel an. Die Idee der Corporate Social Responsibility (CSR), die in den letzten Jahren zunehmend diskutiert wurde, um zu beschreiben, „[...] wie nachhaltiges Wirtschaften zur Lösung der gegenwärtigen gesellschaftlichen Herausforderungen beitragen kann [...]“ (Schmidpeter, 2015, 1), unterstreicht dies. Unternehmerische Verantwortung (UV) gegenüber der Gesellschaft ist für Unternehmen aus normativen und ökonomischen Gründen ein wichtiges Thema (Ebd.). Ebenso werden Unternehmen mittlerweile bezüglich des Handelns im CSR-Bereich am Finanzmarkt bewertet (Ebd.). Die Politik fordere etwa durch Nachhaltigkeitsberichte Rechenschaft und Transparenz (Ebd.).
Weiterhin sind soziopolitische Auswirkungen, darunter auf die nationale Sicherheit oder staatliche Fragilität, sowie die Untersuchung existierender Strategien zur Bekämpfung des Klimawandels als Aspekte zu nennen (Gines, 2011, xv-xvii).
Zusammenfassend wurden hier vorrangig Aspekte aus der Klimawandelforschung vorgestellt in Verbindung mit Stimmen über enthaltene Normen in Benchmarking in GEG, GCCG und GSG.
3. Benchmarks im Bereich Klimawandel, Umwelt und Nachhaltigkeit
3.1 Auf der Agenda: Kategorisierung der Themen
Benchmarks messen und bewerten unterschiedliche Akteur:innen und vielfältige Inhalte. Mithilfe der Kategorisierung werden die Themen sortiert, womit analysiert werden kann, welche Aspekte in welchem Ausmaß13 abgebildet werden - oder eben nicht. Folglich werden mögliche Lücken in der Praxis des Benchmarkings identifiziert, was Implikationen für die zugeschriebene Bedeutung Aspekten hat.
Dafür wurde zunächst mithilfe der Global Benchmarking Database14 sowie eigenständiger Recherche im Internet eine Vielzahl an Benchmarks gesammelt, deren Namen vermuten ließ, dass sie Themen der GCCG, GEG oder GSG behandeln. Um dies zu prüfen, wurden daraufhin für diese Benchmarks weiterführende Informationen wie die verantwortliche RRO, Details zur Veröffentlichung und Details darüber wen und was sie bewerten gesammelt und Benchmarks ausgeschlossen, die inhaltlich nicht übereinstimmen mit dem Schwerpunkt dieser Arbeit. Schließlich wurden auf der Grundlage von 27 Benchmarks thematische Übereinstimmungen identifiziert und Kategorien entwickelt. Die Tabelle 6.1 im Anhang gibt einen Überblick über die weiterführenden Informationen und Einordnung der Benchmarks in die Kategorien.
Die Abbildung 1 (S. 15) veranschaulicht die thematischen Kategorien der Benchmarks in GCCG, GEG und GSG. Die bewerteten Akteur:innen werden Untersuchungseinheit genannt. Die Anzahl der Benchmarks in der jeweiligen Untersuchungseinheit wird auch mit der Größe der Kästen dargestellt. Es wurden drei Untersuchungseinheiten identifiziert: Staaten, Firmen und der Planet. Benchmarks über Planeten sind der Einheit Staaten und Firmen aus zwei Gründen zwar untergeordnet, aber trotzdem eine eigene Einheit: Zum einen veröffentlichen diese Benchmarks die Ergebnisse pro Staat15, zum anderen ist der Zustand des Planeten von menschlichem Handeln in Firmen und Staaten abhängig. Da einige Kategorien das Handeln von Firmen und Staaten gegenüber dem Planeten ausdrücken, sind diese Kreise übergreifend in diese Untersuchungseinheit. Die Größe des Kreises verdeutlicht die Anzahl der Benchmarks in dieser Kategorie.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Thematische Kategorien der Benchmarks in GCCG, GEG und GSG
Quelle: Eigene Darstellung
Die Tabellen 6.2, 6.3 und 6.4 im Anhang geben eine Übersicht über die Kategorien, die Gesamtanzahl der Benchmarks in diesen Kategorien und die konkreten Benchmarks. Behandeln Benchmarks mehrere Kategorien, so werden diese doppelt gezählt, weswegen die Gesamtzahl in den Kategorien mehr als die 27 untersuchten Benchmarks beträgt.
Die größte Anzahl der Benchmarks behandelt demnach Staaten (25). Dabei sind die Gesetzgebung (6) hinsichtlich verbindlicher Abkommen oder zukünftiger Nachhaltigkeit, die Verletzlichkeit (6) der Gesellschaft, einzelner vulnerabler Gruppen oder der Infrastruktur gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels und die Treibhausgasemissionen (5) die am meisten behandelten Themen. Weitere Themen in Benchmarks über Staaten sind Energie (3), darunter der aktuelle Verbrauch und erneuerbare Energien, multidimensionale kritische Themen (3), die Themen kritischer Theorien wie des Feminismus (Gender) behandeln, sowie das Management der Umwelt durch Staaten (2), etwa in Hinblick auf Umweltkatastrophen oder Müll.
Hinsichtlich der Firmen als untersuchte Einheit können elf Benchmarks in zwei Hauptthemen identifiziert werden: Ökonomischer Erfolg (7), wobei es um die Bewertung der Firmen nach Nachhaltigkeit am Finanzmarkt geht, ebenso wie unternehmerische Verantwortung (4) gegenüber der Gesellschaft, unterteilt in Treibhausgasemissionen (2) und Strategien und Versprechen (2).
Benchmarks über die Untersuchungseinheit Planet (3) behandeln den Zustand der Umwelt in Klima (1) und Ökosystemen (2). Die geringe Anzahl an Benchmarks hier ist jedoch nicht aussagekräftig. Eine Fülle an Informationen von Institutionen und IOs über den Zustand der Natur und Erde für Staaten oder Regionen16 bzw. spezifische Ökosysteme oder Ereignisse17 werden nur bedingt in Form von Benchmarks zur Verfügung gestellt bzw. haben einen rein informativen Charakter. Der wissenschaftliche Konsens über den Klimawandel und die Auswirkungen wird in der folglich notwendigen Beobachtung wiedergespiegelt, kann im Rahmen dieser Arbeit jedoch lediglich beispielhaft an einzelnen Benchmarks erläutert und nicht tiefergehend dargestellt werden.
3.2 Vergleich enthaltener Themen in Benchmarks mit Aspekten der Klimawandelforschung
In diesem Kapitel erfolgt der Vergleich der vorgestellten Aspekte der Klimawandelforschung mit der thematischen Kategorisierung der Benchmarks. So soll untersucht werden, inwieweit der Fokus der Benchmarks ebenso den wissenschaftlichen Diskurs reflektiert bzw. ob es Lücken gibt. Im Rahmen dieser Arbeit kann durch die fließenden definitorischen Übergänge keine Einordnung der Benchmarks und Kategorien in GG-Bereiche durchgeführt werden.
Der Großteil der Benchmarks bewertet Staaten als Akteure, da politische Entscheidungsträger:innen sämtliche Bereiche des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens beeinflussen können. Benchmarks zielen auf Änderungen der Themen auf der Agenda ab und deren Priorisierung, womit folglich alle Akteur:innen mittelbar beeinflusst werden. Die Inhalte und Auswirkungen der Gesetze und Vorgaben von Staaten hinsichtlich der Bekämpfung des Klimawandels, der Umwelt und Nachhaltigkeit sind daher eine bedeutende Kategorie. Über 20 % (6 von 25) der Benchmarks über Staaten sind der Gesetzgebung zuzuordnen, was die große Bedeutung des Themas auf der Agenda zeigt. Darüber hinaus ist das Climate Change Management ein zentraler Aspekt der Klimawandelforschung, was maßgeblich die gesetzlichen Vorgaben beinhaltet.
Der Ausstoß von Treibhausgasen stellt nach Gines (2011, 40) einen zentralen Faktor in der Bekämpfung des Klimawandels dar, der dementsprechend auch viel Aufmerksamkeit benötigt. Dass dies anerkannt und Teil der Agenda ist, spiegelt der hohe Anteil der Benchmarks über Treibhausgase wider, sowohl für Staaten (20 %, 5 von 25) als auch für Firmen (18 %, zwei von elf). Dabei behandeln auch die Benchmarks der Gesetzgebung häufig zum Teil Treibhausgase. Ein Beispiel ist der Climate Change Performance Index, der nicht nur Treibhausgase selbst, sondern auch die Gesetzgebung hinsichtlich der Emissionen bewertet. Das wurde in dieser Kategorisierung nicht berücksichtigt, würde den Anteil der Benchmarks über Treibhausgase allerdings zusätzlich erhöhen. Dieser Aspekt der Klimawandelforschung ist also breit abgedeckt durch Benchmarks im Klimawandel-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsbereich.
Die dritte große Kategorie von Benchmarks über Staaten ist das Konzept der Verletzlichkeit, was in dieser Arbeit breit definiert wurde. In diese Kategorie werden entsprechend Gines (2011, 65, 74f.) sowohl Benchmarks über die Verletzlichkeit von besonders vulnerablen Gruppen (z.B. Children’s Climate Risk Index) oder Gesellschaften (z.B. Index of Social Vulnerability to Climate Change in Africa), aber auch Staaten und Infrastruktur hinsichtlich Naturkatastrophen (z.B. Climate Change Vulnerability Index) abgebildet. Über 20 % (6 von 25) der Benchmarks über Staaten sind der Kategorie Verletzlichkeit zuzuordnen. Die Kategorie reflektiert die Auswirkungen des veränderten Klimas auf die Gesellschaft18 einerseits und sozioökonomischen Auswirkungen andererseits, welche Aspekte der Klimawandelforschung sind. Themen dieser Aspekte, die nicht in den Benchmarks enthalten sind, sind Klimagerechtigkeit, die Werte und Kultur rund um Massenkonsum sowie zunehmende Ungleichheiten. Mit Benchmarks über Verletzlichkeit können die Folgen des Klimawandels auf das Leben der einzelnen Menschen sowie konkrete Bevölkerungsgruppen anschaulich dargestellt werden. Die Folgen als Thema der Agenda können genutzt werden, um Bewusstsein zu schaffen und Handlung zu erzeugen. Soziopolitische Auswirkungen des veränderten Klimas etwa auf die nationale Sicherheit oder Fragilität von Staaten kommen jedoch in den untersuchten Benchmarks nicht vor.
Energie ist ebenfalls eine Kategorie in Benchmarks über den Klimawandel. Die Benchmarks bewerten den aktuellen Energiekonsum sowie erneuerbare Energien (z.B. Climate Change Performance Index). Die stabile Energieversorgung ist essenziell für wirtschaftliches Wachstum. Dass Benchmarks im Klimawandelbereich Energie aufgreifen, reflektiert die Bedeutung für die globale Wirtschaft und folglich von wirtschaftlichem Wachstum. Nach Kuzemko (2015) wird wirtschaftliches Wachstum und Nachhaltigkeit nicht als Widerspruch gesehen (979-981). Durch die Kategorisierung wird deutlich, dass es zwar Benchmarks über Energie gibt, aber keine über nachhaltige Praktiken - Energie ist relevant für das wirtschaftliche Wachstum, Nachhaltigkeit bedeutet zunächst Kosten durch das Infragestellen etablierter Prozesse und der Suche nach neuen Lösungen, was das wirtschaftliche Wachstum gefährden könnte. Die Bedeutung von wirtschaftlichem Wachstum und die implizite Annahme, dass Nachhaltigkeit der Klimawandelbekämpfung nachgestellt ist bzw. automatisch damit einhergeht, könnte darauf hindeuten, dass angenommen wird, dass der Klimawandel innerhalb der bestehenden Systeme und Strukturen bekämpft werden kann. Globale Energie- und Wirtschaftssysteme sind jedoch mitverantwortlich für den Klimawandel, weswegen die GSG-Forschung fordert, die etablierten Systeme in Frage zu stellen. Der Energy Trilemma Index greift den Konflikt auf zwischen Nachhaltigkeit und Energieversorgung, was ein Indiz dafür sein könnte, dass das Bewusstsein diesbezüglich wächst. Energie ist kein Aspekt der Klimawandelforschung. Die Diskussion um die Energieversorgung ist vorrangig begründet in der Bedeutung von Energie für die Weltwirtschaft und letztlich dem ultimativen Ziel des wirtschaftlichen Wachstums Dabei zeigen die MSCI Climate Change Indexes mit der Bewertung von Unternehmen hinsichtlich UV die Bedeutung von Nachhaltigkeit am Finanzmarkt, aber auch für den zukünftigen ökonomischen Erfolg von MNCs. Die Nachhaltigkeitsberichte, die von der Politik und Gesellschaft zunehmend von Unternehmen gefordert werden, sind ebenfalls Ausdruck einer zunehmenden Bedeutung von nachhaltigem Wirtschaften (z.B. Corporate Climate Responsibility Monitor). Das Konzept von CSR und Firmen mit gesellschaftlicher Verantwortung ist recht neu, was die relativ geringe Anzahl begründet (6 von 27). Zudem sind Firmen an gesetzliche Vorgaben und Richtlinien gebunden, weswegen der Fokus der Benchmarks eher auf der Untersuchungseinheit Staaten liegt. Nichtsdestotrotz ist der Aspekt der ökonomischen und sozioökonomischen Folgen des Klimawandels in den Benchmarks über Firmen sowie einigen Benchmarks über Verletzlichkeit enthalten.
Benchmarks in der Kategorie der multidimensionalen kritischen Theorien beschäftigen sich z.B. aus feministischer Sicht mit den Auswirkungen des Klimawandels (Environment and Gender Index). Ebenso wird die Demokratiequalität hinsichtlich der Beteiligung der Bevölkerung und der Einforderung von Rechten bewertet (Environmental Democracy Index), was den Stimmen der Wissenschaftler:innen aus dem GSG Bereich mit Hinblick auf die Entmachtung der Bevölkerung entspricht (Hayden et al., 2020, 2). Dahingegen werden Themen wie Werte und die Kultur rund um Massenkonsum oder zunehmende Ungleichheiten nicht thematisiert. Das Konzept der Klimagerechtigkeit kommt in keiner der untersuchten Benchmarks vor.
Klima wird separat von Umwelt gesehen (Kuzemko, 2015, 981). In den Benchmarks zur Performanz in der Bekämpfung des Klimawandels sind in keiner - außer einer - Umweltaspekte enthalten, was dem Klimaverständnis von biologischen und ökologischen Wissenschaften widerspricht (Allan, 2017, 132). Das Management der Umwelt ist eine eigene Kategorie, mit der sich z.B. der Ecological Footprint beschäftigt. Eine Ausnahme von der Trennung von Klimawandel und Umwelt stellt der Environmental Performance Index (EPI) dar, der sich umfassend mit sämtlichen Kategorien über den Planeten und Staaten beschäftigt. Im EPI werden sowohl die staatliche Gesetzgebung, Treibhausgasemissionen, das Management der Umwelt, aber ebenso der Zustand der Ökosysteme in einem Land bewertet.
Die Forschung über globale Klima- und Ökosysteme kann in der Untersuchungseinheit Planet eingeordnet werden, zum einen in den Zustand der Umwelt hinsichtlich des Klimas, zum anderen hinsichtlich der Ökosysteme. Auch durch die Bereitstellung von Informationen auf meteorologischen Grundlagen in alternativen Formen, nicht nur Benchmarks, ist die Beobachtung des Zustands des Planeten breitflächig abgedeckt. Es gibt jedoch kaum Benchmarks19, die den Zustand der Umwelt in Ländern bewerten. Dem Klimasystem als Aspekt der Klimawandelforschung wird also durch die untersuchten Benchmarks kaum berücksichtigt, ist jedoch als Phänomen durch die Forschung bewiesen und wird beobachtet. Dies kann etwa durch die Trennung von Klima und Umwelt verursacht sein. Der Zustand der Umwelt kann Informationen über nachhaltige Praktiken der Staaten geben. Zudem sind gesunde Ökosysteme unabdingbar für das Überleben der Menschheit. Das Thema ist auf der Agenda, jedoch nicht ausreichend priorisiert. Weiterer, globaler Fokus auf die Umwelt und den Planeten und Lösungen zur Bekämpfung der Auswirkungen des Klimawandels und menschlichen Aktivitäten ist nötig.
Zusammengefasst spiegeln die Themen, die durch die Analyse der Benchmarks und die Kategorisierung herausgearbeitet wurden, zum größten Teil vorhandene Aspekte der Forschung in den Bereichen von Klimawandel, Umwelt und Nachhaltigkeit wider. Die Aspekte Klimagerechtigkeit und Normen und Werte um Massenkonsum und zunehmende Ungerechtigkeit werden nicht aufgegriffen durch Benchmarks. Diese Themen können der Forschung im GSG-Bereich zugeordnet werden. Energie ist hingegen kein Aspekt, aber eine Kategorie, was die Bedeutung der bestehenden Wirtschaft für Akteur:innen des Weltregierens verdeutlicht. Viele Themen mit wissenschaftlicher Bedeutung sind bereits auf der Agenda im Benchmarking-Prozess.
4. Fazit
Die Bekämpfung des Klimawandels, der Schutz der Umwelt und die Förderung von Nachhaltigkeit erfordern globale Handlung. Die Governance-Bereiche GCCG, GEG, GSG beinhalten verwandte, ineinander übergreifende Themen, die Benchmarks aufgreifen. Als Instrumente des Agenda-Setting-Prozesses haben Benchmarks Einfluss auf die Themensetzung und so auf folgende Politikprozesse. Deswegen ist es von Bedeutung, die in Benchmarks enthaltenen Themen zu untersuchen. Es gibt diverse Aspekte von Klimawandelforschung und folglich Themen, die Bestand von Benchmarking sein können. In dieser Arbeit wurden 27 Benchmarks analysiert und mithilfe einer Kategorisierung thematisch geordnet. Diese Arbeit soll vergleichen, welche Aspekte von Klimawandelforschung in globalen Benchmarks über den Klimawandel, die Umwelt und Nachhaltigkeit reflektiert werden bzw. welche Themen nicht aufgegriffen werden.
Staaten sind Hauptakteur:innen, wenn es um die Bekämpfung des Klimawandels geht. Dementsprechend liegt der Fokus von Benchmarking auf Staaten, dann Firmen und schließlich dem Planeten: Staaten können über ihre Gesetzgebung und in Zusammenarbeit mit sämtlichen Akteur:innen auf internationaler, regionaler und nationaler Ebene die Bekämpfung des Klimawandels gestalten. Welche Themen auf der politischen, Agenda sind spielt eine bedeutende Rolle. Politische Entscheidungsträger:innen entscheiden darüber, in welchen Themenbereichen wie gehandelt wird. Die Benchmarks über Staaten erzeugen sozialen Druck und zielen darauf ab, die Gesetzgebung zu beeinflussen. Die hohe Bedeutung dieser Kategorie reflektiert das Climate Change Management als einen zentraler Aspekt der Klimawandelforschung. Unternehmerische Verantwortung wird allein aus ökonomischer Sicht immer wichtiger für Firmen, welche jedoch den Regularien der Staaten unterliegen, weshalb sich weniger Benchmarks auf diese Einheit konzentrieren. Der Planet ist kein Akteur im klassischen Sinne, zudem wird der Klimawandel über Umwelt und Nachhaltigkeit gestellt20, wodurch neben der reinen Informationsbereitstellung kaum Benchmarks über das Klimasystem existieren.
Neben der Gesetzgebung sind zwei weitere Themen großer Bewertungsgegenstand: Treibhausgasemissionen und Verletzlichkeit hinsichtlich des Klimawandels. Der hohe Anteil an Benchmarks über Treibhausgase reflektiert die Bedeutung für die Klimawandelbekämpfung und deckt sich mit dem Aspekt der Klimawandelforschung. Die vielfältigen Auswirkungen des Klimawandels werden mit Benchmarks über den Grad der Verletzlichkeit deutlich gemacht und in die Wahrnehmung der Öffentlichkeit getragen. Benchmarks in dieser Kategorie decken Teile des Aspekts der soziologischen Beziehungen sowie den Aspekt der ökonomischen und sozioökonomischen Auswirkungen ab.
Kaum Benchmarks, die untersucht wurden, behandeln den Aspekt des Klimasystems. In dieser Hinsicht werden Informationen ohne den Bewertungs- oder Vergleichsaspekt durch nationale und regionale Institutionen bereitgestellt. Die meisten Benchmarks über den Planeten behandeln den Zustand des Planeten und das Verhalten von Staaten oder Firmen einzeln. Dies verdeutlicht die thematische Trennung von Umwelt und Klima. Der Aspekt der Effekte auf das Ökosystem wird im Rahmen des Zustands des Planeten nur geringfügig behandelt.
Schließlich können trotzdem thematische Lücken identifiziert, die bislang nicht durch Benchmarks abgedeckt werden. Dies betrifft die Teilbereiche des Aspektes der soziologischen Beziehungen: der Werte und Kultur rund um Massenkonsum, der Klimagerechtigkeit sowie den Aspekt der soziopolitischen Auswirkungen des Klimawandels. Die Gründe hierfür können Gegenstand weiterer Forschung sein. Energie als Kategorie ist die Folge der Bedeutung für die Weltwirtschaft und deren notwendige Veränderung im Rahmen der Bekämpfung des Klimawandels - es ist jedoch kein expliziter Aspekt der Klimawandelforschung.
Die Arbeit gibt einen ersten Überblick über die Themen auf der Agenda des Benchmarking-Prozesses in GCCG, GEG und GSG. Die Recherchen nach Benchmarks wurden hinreichend intensiv durchgeführt, es werden jedoch konstant neue Benchmarks produziert, weswegen diese Arbeit zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt werden sollte. Die Überprüfung dieser Ergebnisse und der Vergleich mit denen in dieser Arbeit kann Erkenntnisse über eine mögliche Veränderung der Benchmarking-Landschaft bringen. Die Kategorien wurden aus den bestehenden Themen der gesammelten Benchmarks entwickelt, was in inhärente Subjektivität zur Folge hat. Die Reliabilität der Kategorien ist daher eingeschränkt. In weiterführender Forschung, etwa durch Interviews mit Expert:innen, könnten weitere Meinungen eingeholt und die Kategorisierung weiterentwickelt werden.
Vorrangig wurde die Frage untersucht, ob ein Aspekt aufgegriffen wurde oder nicht. Es wurde ansatzweise mithilfe der Anzahl der Benchmarks in einer Kategorie versucht, die Bedeutung der Themen für GG herauszustellen. Weitere Forschung könnte dies vertiefen. Zudem könnte die Einordnung der Benchmarks und Kategorien in die Bereiche Globaler Governance erfolgen. Die nichtbehandelten Aspekte sind dem GSG-Bereich zuzuordnen. Eine Frage könnte deswegen sein, ob Bereichen auf globaler Ebene unterschiedlich viel Beachtung geschenkt wird und ob Benchmarks bestimmter Bereiche machtvoller sind als andere. Im Zuge dessen könnte eine Überprüfung der konstruktivistischen Theorie erfolgen.
Zusammenfassend reflektiert der der Großteil der Benchmarks im Bereich Klimawandel, Umwelt und Nachhaltigkeit die Aspekte der Klimawandelforschung. Climate Change Management, Treibhausgase, Teile der soziologischen sowie ökonomischen und sozioökonomischen Auswirkungen sind besonders stark aufgenommene Themen. Der Aspekt des Klimasystems wird nicht in Benchmarks, sondern durch andere Formen der Informationsbereitstellung aufgegriffen. Der Aspekt der Effekte auf das Ökosystem wird kaum thematisiert. Teilaspekte von soziologischen Beziehungen wie Werte und Kultur rund um Massenkonsum oder Klimagerechtigkeit stehen nicht im Blick von Benchmarks. Ebenso werden soziopolitische Auswirkungen wie staatliche Fragilität nicht behandelt. Dahingegen stellt der Energieaspekt ein Thema dar, was kein Aspekt der Klimawandelforschung ist. Auch wenn weiterführende Forschung nötig ist, rocken Benchmarks als Instrumente des Weltregierens bereits jetzt die Bühne von Global Climate Change, Environmental und Sustainability Governance und haben durch das Rücken von Themen ins Scheinwerferlicht und die Erzeugung sozialen Drucks eine essenzielle Bedeutung dafür, dass die globale Bekämpfung des Klimawandels vorangeht.
5. Literaturverzeichnis
Allan, B. B. (2017). Producing the Climate: States, Scientists, and the Constitution of Global Governance Objects. Int Org 71 (1), 131-162. DOI: 10.1017/S0020818316000321.
Bali, A. & Halpin, D. (2021). Agenda-setting instruments: means and strategies for the management of policy demands. Policy and Society 40 (3), 333-344. DOI: 10.1080/14494035.2021.1955489.
Barnett, M. N., Pevehouse, J. C. W. & Raustiala, K. (Hrsg.) (2021). Global Governance in a World of Change. Cambridge University Press.
Broome, A. & Quirk, J. (2015). Governing the world at a distance: the practice of global benchmarking. Rev. Int. Stud. 41 (5), 819-841. DOI: 10.1017/S0260210515000340.
Cobb, R. W., & Ross, M. (1997). Cultural strategies of agenda denial. Kansas University Press.
Cooley, A. (2015). The emerging politics of international rankings and ratings. In Cooley, A. & Snyder, J. (Hrsg.), Ranking the World (S. 1-38). Cambridge University Press.
Cooley, A. & Snyder, J. (Hrsg.) (2015). Ranking the World. Cambridge University Press.
Davis, K. E., Fisher, A., Kingsbury, B. & Engle Merry, S. (Hrsg.) (2012). Governance by Indicators. Oxford University Press.
Davis, K. E., Kingsbury, B. & Engle Merry, S. (2012). Introduction: Global Governance by Indicators. In Davis, K., Fisher, A., Kingsbury, B. & Engle Merry, S. (Hrsg.), Governance by Indicators (S. 3-28). Oxford University Press.
DeSombre, E. R. & Li, A. H. (2018). Global Environmental Governance. In Weiss, T. G. & Wilkinson, R. (Hrsg.), International Organization and Global Governance ( S. 630-642) (2. Aufl.). Routledge.
Doshi, R., Kelley, J. G. & Simmons, B. A. (2019). The Power of Ranking: The Ease of Doing Business Indicator and Global Regulatory Behavior. Int Org 73 (03), 611-643. DOI: 10.1017/S0020818319000158.
Finnemore, M. & Sikkink, K. (1998). International Norm Dynamics and Political Change. International Organization 52 (4), 887-917. http://www.jstor.org/stable/2601361
Finnemore, M. & Sikkink, K. (2001). Taking Stock: The Constructivist Research Program in International Relations and Comparative Politics. Annual Review of Political Science 4(1), 391-416. DOI: 10.1146/annurev.polisci.4.1.391
Gines, J. K. (2011). Climate Management Issues. CRC Press.
Green, J. F. (2021). Climate Change Governance. In Barnett, M. N., Pevehouse, J. C. W. & Raustiala, K. (Hrsg.), Global Governance in a World of Change ( S. 109-129). Cambridge University Press.
Hayden, A., Fuchs, D. & Kalfagianni, A. (2020). Introduction. Critical and transformative perspectives on global sustainability governance. In Kalfagianni, A., Fuchs, D. A. & Hayden, A. (Hrsg.), Routledge handbook of global sustainability governance (S. 1-10) . Routledge.
Hart, David M., and David G. Victor. 1993. Scientific Elites and the Making of US Policy for Climate Change Research, 1957-74. Social Studies of Science 23 (4). 643648.
Heubaum, H. (2018). Global energy governance. In Weiss, T. G. & Wilkinson, R. (Hrsg.), International Organization and Global Governance (S. 681-693) (2. Aufl.). Routledge.
Hoffmann, M. J. (2018). Climate Change. In Weiss, T. G. & Wilkinson, R. (Hrsg.), International Organization and Global Governance (S. 655-666) (2. Aufl.). Routledge.
Kalfagianni, A., Fuchs, D. A. & Hayden, A. (Hrsg.) (2020). Routledge handbook of global sustainability governance. Routledge.
Kelley, J. G. & Simmons, B. A. (2019). Introduction: The Power of Global Performance Indicators. Int Org 73 (03), 491-510. DOI: 10.1017/S0020818319000146.
Kingdon, J. W. (1984). Agendas, alternatives, and public policies. Little, Brown.
Krell, G. & Schlotter, P. (2018). Weltbilder und Weltordnung. Einführung in die Theorie der Internationalen Beziehungen (5. Aufl.). Nomos Verlagsgesellschaft.
Kuzemko, C. (2015). Climate change benchmarking: Constructing a sustainable future? Rev. Int. Stud. 41 (5), 969-992. DOI: 10.1017/S0260210515000418.
McCombs, M. E. & Shaw, D. L. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. Public Opinion Quarterly 36 (2), 176-187. DOI: 10.1086/267990.
Risse, T., Ropp, S. C. & Sikkink, K. (Hrsg.) (1999). The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change. Cambridge University Press.
Schimmelfennig, F. (2021). Internationale Politik (6. Aufl.). Brill | Schöningh.
Schmidpeter, R. (2015). Unternehmerische Verantwortung - Hinführung und Überblick. In Schneider, A. & Schmidpeter, R. (Hrsg.), Corporate Social Responsibility (S. 1-18). Springer VS.
Schneider, A. & Schmidpeter, R. (Hrsg.), Corporate Social Responsibility. Springer VS.
Schroth, F., Glatte, H., Kaiser, S. & Heidingsfelder, M. (2020). Participatory agenda setting as a process — of people, ambassadors and translation: a case study of participatory agenda setting in rural areas. Eur J Futures Res 8 (1). DOI: 10.1186/s40309-020-00165-w.
Weiss, T. G. & Wilkinson, R. (2018). From international organization to international governance. In Weiss, T. G. & Wilkinson, R. (Hrsg.), International Organization and Global Governance (S. 3-19) (2. Aufl.). Routledge.
Weiss, T. G. & Wilkinson, R. (Hrsg.) (2018). International Organization and Global Governance (2. Aufl.). Routledge.
Zahariadis, N. (Hrsg.) (2016). Handbook of Public Policy Agenda Setting. Edward Elgar Publishing.
Zahariadis, N. (2016). Setting the agenda on agenda setting: definitions, concepts, and controversies. In Zahariadis, N. (Hrsg.), Handbook of Public Policy Agenda Setting (S. 1-22). Edward Elgar Publishing.
6. Anhang
Tabelle 1: Detaillierte Informationen über verwendete Benchmarks
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Daten und Darstellung
Tabelle 2: Übersicht über die Kategorien und Benchmarks in der Untersuchungseinheit Staaten
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Daten und Darstellung
Tabelle 3: Übersicht über die Kategorien und Benchmarks in der Untersuchungseinheit Firmen
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Daten und Darstellung
Tabelle 4: Übersicht über die Kategorien und Benchmarks in der Untersuchungseinheit Planet
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Daten und Darstellung
[...]
1 Der Begriff wird genutzt, um die globale Erderwärmung durch die erhöhte Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre zu beschreiben. Gleichzeitig hat dies nicht nur die Erhöhung der Temperatur, sondern auch langfristige Veränderungen des globalen Klimas und den darauf beruhenden Systemen zur Folge, was sich etwa in dem Aussterben von Pflanzen und Tieren, häufigeren extremen Wetterereignissen, Dürren und dem gefährlichen Anstieg der Meeresspiegel zeigt. Der Klimawandel betrifft Staaten auch ökonomisch, politisch und auf gesellschaftlicher sowie individueller Ebene (Gines, 2011, 4ff.).
2 Dies wird auch als anthropogener Klimawandel bezeichnet.
3 Dt.: Weltregieren
4 Lokal, national, regional, global
5 Im Folgenden wird als umfassender Begriff Klimawandel benutzt, wobei das System des Klimas ebenfalls eingedacht wird.
6 Die Begriffe werden in dieser Arbeit als Synonyme verwendet.
7 Rationalistische und Soziale Theorien. Die Praxis des Benchmarkings ist entstanden durch normative Argumente und Gruppenidentitäten und der Bedeutung von Reputation, Kommunikationsnetzwerken und Sozialisationsmuster (z.B. Risse et al., 1999; Finnemore & Sikkink, 1998) und kann nicht nur aus rationalistischer Sicht durch Macht und Interessen sowie das Senken von Kosten von Kooperation, Koordination und Regulation durch das Vereinfachen komplexer Phänomene erklärt werden (Broome & Quirk, 2015, 823).
8 Relativ stabile, rollenspezifische Erwartungen bezogen auf sich selbst.
9 D.h. Akteur:innen orientieren sich an ideellen Strukturen wie Rollen, Ideen, Normen und Erwartungen.
10 Solche Akteur:innen, die Benchmarks produzieren, etwa NGOs oder IOs.
11 Dies spiegelt sich auch in den vorgestellten Aspekten der Klimawandelforschung nach Gines (2011) wider und bestätigt wiederum, dass Ideen und Vorstellungen über bestimmte Sachverhalte Forschungsperspektiven zugrunde liegen.
12 Der Begriff Climate Change Management wurde von der Quelle übernommen, ein alternativer Begriff in der Sprache dieser Arbeit wäre Global Climate (Change) Governance.
13 Ausmaß bezieht sich hier auf die Anzahl der Benchmarks pro Kategorie im Vergleich zur Bedeutung der zugrundeliegenden Ideen in dem wissenschaftlichen und öffentlichen Diskurs.
14 Global Benchmarking Database, v2.0, Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation, University of Warwick. Available at: www.warwick.ac.uk/globalbenchmarking/database.
15 Beispielsweise wird der Zustand der Ökosysteme weltweit nach Ländern gerankt, obwohl also der Planet bewertet wird, geht es auch um Ländergrenzen zur Vergleichbarkeit.
16 In Europa veröffentlich die Copernicus Climate Change Service (C3S) etwa Informationen über Klimawandel (die Temperatur, Waldbrände und den Meeresanstieg) sowie die Qualität der Atmosphäre, Meere und Landflächen. Ebenfalls werden durch die United States Environmental Protection Agency (EPA) mehr als 50 Indikatoren in Bezug auf den Klimawandel veröffentlicht, darunter über Treibausgasemissionen, Wetter und Klima, die Überwinterung von Vögeln, der Blüte von Pflanzen, Extremwetterereignisse, Schnee und Eis oder Gesundheit.
17 Die folgenden Beispiele stellen eine Auswahl für globale Zusammenarbeit dar aufgrund des Fokus dieser Arbeit auf GG; ähnliche Informationsbereitstellung gibt es auch auf regionaler und nationaler Ebene. So misst bspw. der World Glacier Monitoring Service den aktuellen Zustand von Gletschern. Das Global Coral Reef Monitoring Network informiert über den Status und Trends von Korallenriff-Ökosystemen. Das Global Wildfire Informatin System (GWIS) stellt Reports und Statistiken über Waldbrände zur Verfügung.
18 Damit sind soziologische Beziehungen gemeint.
19 Neben dem EPI nur den Living Planet Index.
20 Bei dem Planeten als Untersuchungseinheit von Benchmarkings geht es vorrangig um den Zustand des Klimas und der Ökosysteme, nicht aber um die Bekämpfung des Klimawandels.
- Quote paper
- Anonymous,, 2023, Welche Aspekte der Klimawandelforschung werden in globalen Benchmarks über das Klima, die Umwelt und Nachhaltigkeit reflektiert?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1571851