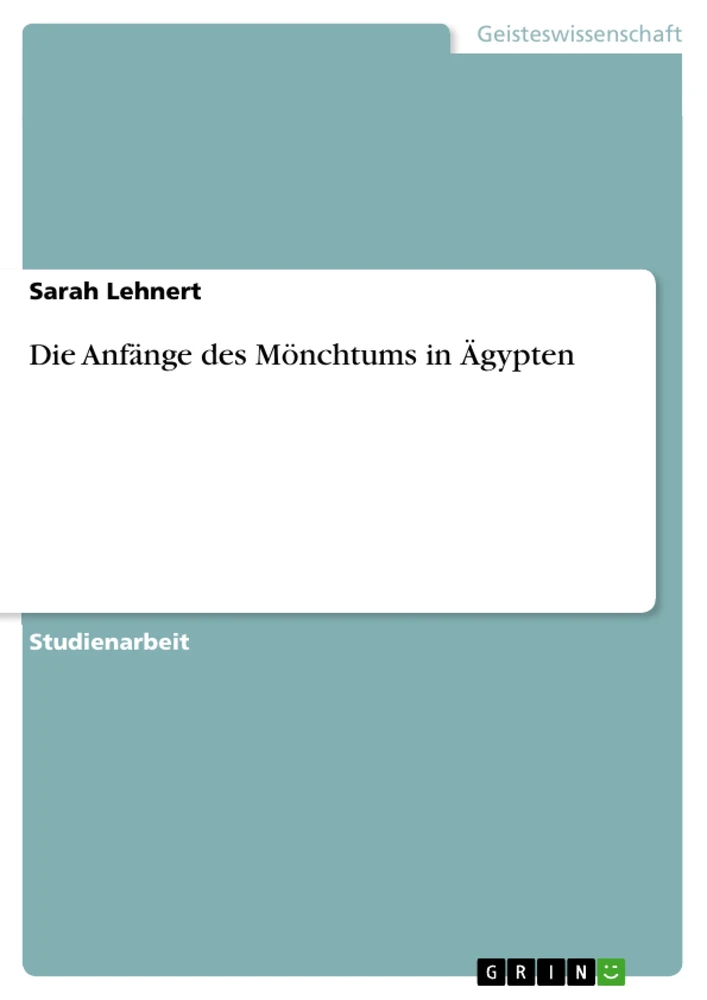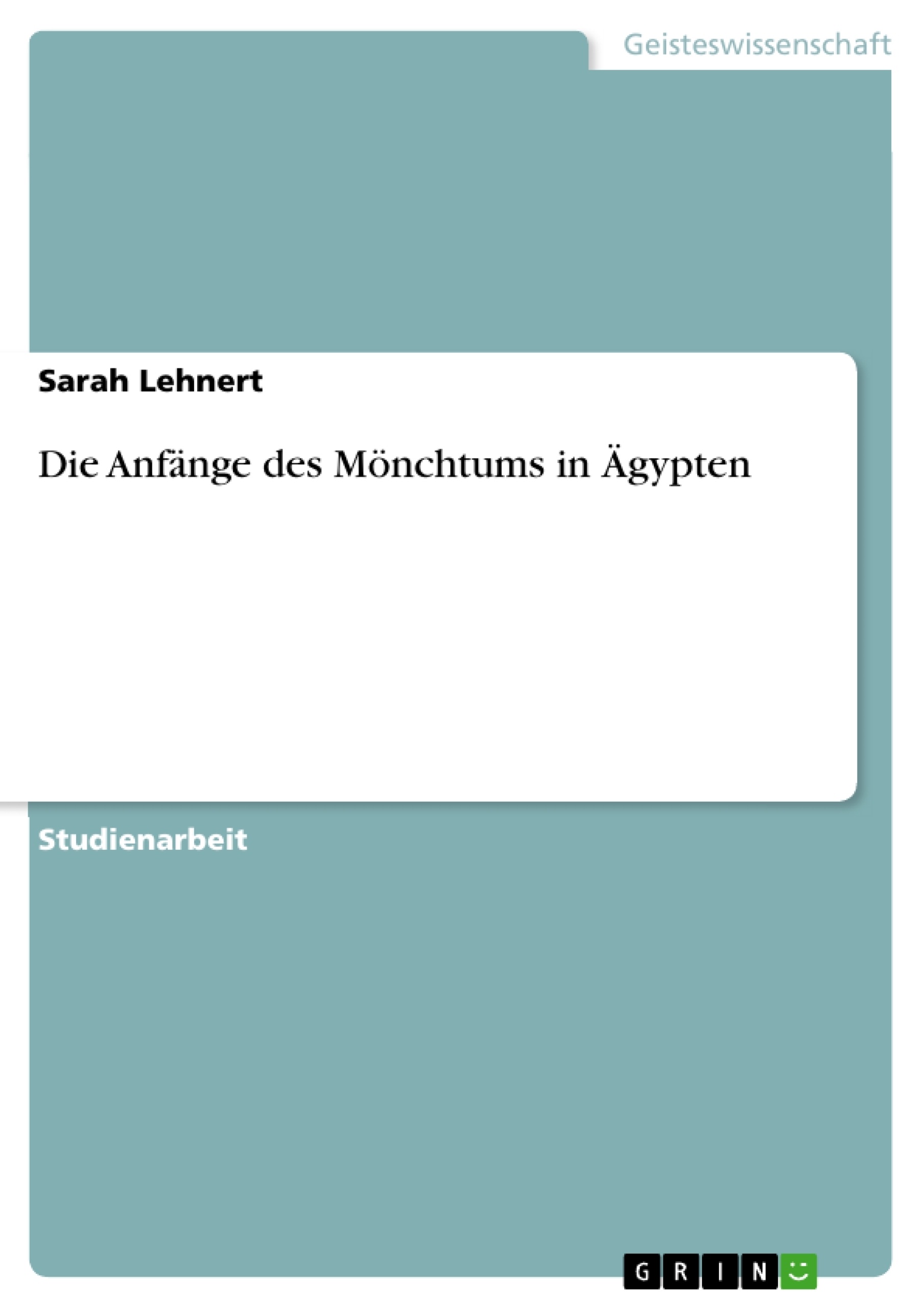Ich habe mich ganz bewusst für das Thema „Die Anfänge des Mönchtums in Ägypten“ entschieden, da ich mich mit dieser Materie bis zum Schreiben der Hausarbeit nicht auskannte und es mein Interesse geweckt hat. Schon oft habe ich mir die Frage gestellt, wie man sich dafür entscheiden kann, sein gesamtes Leben aufzugeben und es ganz nach Gott auszurichten. Wo liegt der Ursprung des Mönchtums? Leben Mönche nur in ihrem Kloster oder dürfen sie auch den Kontakt zur Außenwelt halten? Wer oder was veranlasst sie dazu in ein Kloster zu ziehen? Wie entstand das Mönchtum? Können sie sich dort zurückziehen oder ist alles auf die Gemeinschaft ausgerichtet? Generell würde mich interessieren, wie der Alltag eines Mönchs aussieht. Wie ist es mit dem Empfang von Besuch im Kloster? Gab es früher schon Frauenklöster oder ähnliche Lebensformen, die deren der Mönche gleicht? Diese Fragen gehen mir durch den Kopf, wenn ich das Wort „Mönch“ höre.
Um alle diese und weitere Fragen zu klären, werde ich als erstes bei meiner Hausarbeit auf die vermutlichen Ursprünge der christlichen Askese eingehen, wo ich die Essener und Therapeuten genauer untersuchen werde. Dann gehe ich näher auf die christliche Askese ein und komme schließlich zu den Ursprüngen des Mönchtums in Ägypten. Desweiteren gehe ich noch auf die Entwicklung des Mönchtums in anderen östlichen Ländern ein, wie Palästina, Syrien, Kleinasien und insbesondere Konstantinopel. Dort sind unabhängig und neben dem ägyptischen Mönchtum klösterliche Lebensformen entstanden, auf die ich jedoch nur kurz eingehe, um anzudeuten, dass das Mönchtum nicht nur in Ägypten Fuß gefasst hat. Abschließend werde ich alles für mich reflektieren und so zu einem Fazit zu gelangen, in dem auch meine eigene Meinung deutlich wird und welche ich mir durch das Lesen der im Literaturverzeichnis angegebenen Bücher, gebildet habe. Bis dahin will ich mich auch mit meinen Anfangsfragen auseinandergesetzt haben und eine Antwort darauf wissen.
Inhaltsverzeichnis
- Begründung des gewählten Themas
- Der Ursprung des christlichen Mönchtums
- Von der Askese zum christlichen Mönchtum
- Die Anfänge des Mönchtums in Ägypten
- Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Anfängen des christlichen Mönchtums in Ägypten. Sie analysiert die Ursprünge dieser Lebensform und untersucht die Entwicklung von der Askese zum Mönchtum. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung der Essener und Therapeuten für die Entstehung des christlichen Mönchtums und untersucht, wie diese Lebensform in Ägypten Fuß fasste.
- Die Ursprünge des christlichen Mönchtums
- Die Rolle der Essener und Therapeuten
- Die Entwicklung von der Askese zum Mönchtum
- Die Anfänge des Mönchtums in Ägypten
- Die Bedeutung des Mönchtums für die christliche Religion
Zusammenfassung der Kapitel
Begründung des gewählten Themas
Dieses Kapitel erläutert die Motivation des Autors, sich mit dem Thema „Die Anfänge des Mönchtums in Ägypten“ zu beschäftigen. Es werden Fragen aufgeworfen, die die Grundlage für die weitere Untersuchung bilden, wie z. B. die Gründe für die Entscheidung zum Mönchsein, die Ursprünge des Mönchtums, die Beziehung zur Außenwelt und der Alltag der Mönche.
Der Ursprung des christlichen Mönchtums
Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Auffassungen in der kirchengeschichtlichen Forschung über die Ursprünge des christlichen Mönchtums. Es werden die Essener und Therapeuten als mögliche Vorläufer diskutiert, wobei die Argumentation und Kritik an den jeweiligen Ansichten dargestellt werden.
Von der Askese zum christlichen Mönchtum
Dieses Kapitel behandelt die Entwicklung der Askese, die als Grundlage für das Mönchtum angesehen wird. Es werden die asketischen Strömungen im antiken Griechenland und die Rolle der Askese in der frühen christlichen Religion erläutert.
Die Anfänge des Mönchtums in Ägypten
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Entstehung des Mönchtums in Ägypten und seine Entwicklung in der frühen christlichen Kirche.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Hausarbeit sind: Mönchtum, Askese, Ursprünge, Ägypten, Essener, Therapeuten, christliche Religion, Geschichte, Lebensform, Kloster, Enthaltsamkeit, Reflexion.
Häufig gestellte Fragen
Wo liegen die Ursprünge des christlichen Mönchtums?
Die Wurzeln werden oft in der jüdischen Askese (Essenener, Therapeuten) sowie in der allgemeinen christlichen Askese gesucht, die sich im 3. und 4. Jahrhundert in Ägypten festigte.
Welche Rolle spielten die Therapeuten?
Die Therapeuten waren eine jüdische Gruppe in Ägypten, deren kontemplatives Leben als möglicher Vorläufer für spätere mönchische Lebensformen diskutiert wird.
Warum entstand das Mönchtum ausgerechnet in Ägypten?
Ägypten bot durch seine Wüstenregionen den idealen Raum für Rückzug und Einsamkeit (Anachorese), um ein Leben ganz nach Gott auszurichten.
Was ist der Unterschied zwischen Eremitentum und Koinobitentum?
Das Eremitentum bezeichnet das Leben in vollkommener Einsamkeit, während das Koinobitentum das gemeinschaftliche Leben in einem Kloster beschreibt.
Gab es in der Frühzeit auch Frauenklöster?
Ja, die Arbeit untersucht, ob es bereits in den Anfängen Lebensformen für Frauen gab, die denen der Mönche glichen.
- Quote paper
- Sarah Lehnert (Author), 2008, Die Anfänge des Mönchtums in Ägypten, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/157149