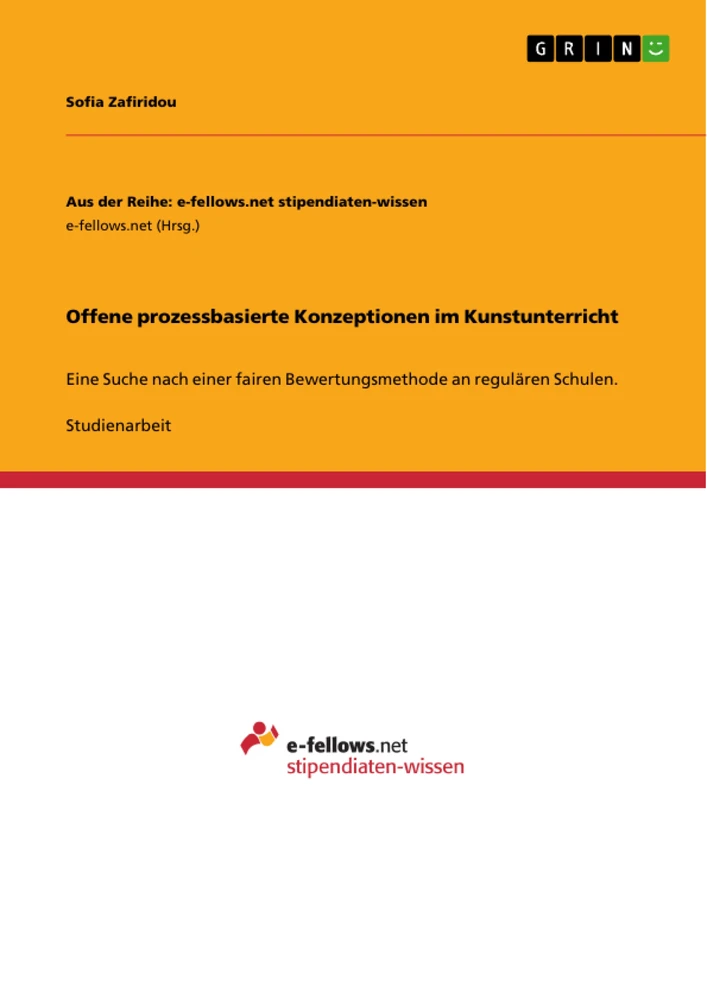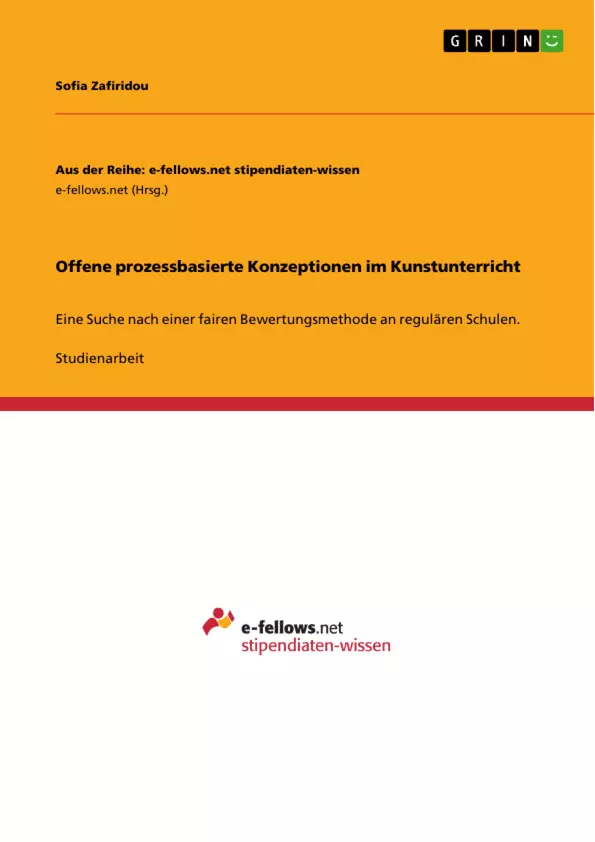In der vorliegenden Arbeit wird die Problematik der Benotung im – von der kunstpädagogischen Ausbildung an einer Kunsthochschule wie der Burg Giebichenstein geprägten – Kunstunterricht an regulären Schulen behandelt. Ein (auch persönliches) Anliegen ist es, bestimmte Problematiken zu klären, die an der Schnittstelle zwischen Studium und Schulpraxis entstehen. Diese sollen vor dem Hintergrund des wissenschaftlichen Diskurses diskutiert und ein möglicher Lösungsweg aufgezeigt werden. Hierzu wird zunächst der eigene intuitive kunstpädagogische Standpunkt vor dem Hintergrund der bestehenden kunstpädagogischen Theorien thematisiert. Darauf folgt ein Exkurs über die kunstpädagogische Position der künstlerischen Bildung nach Buschkühle, um näher auf die konkreten Aspekte einer Kunstunterrichtskonzeption einzugehen, die vermutlich in eine ähnliche Richtung weist wie der zuvor beschriebene intuitive Standpunkt. Die Problematik, die sich durch das Zusammenspiel eines kunstorientierten Ansatzes und des Benotungszwanges an regulären Schulen ergibt, wird insbesondere durch das Miteinbeziehen von Aussagen und Kommentaren einer Kunstlehrerin aus dem zweiten Schulpraktikum deutlich: Es zeichnet sich ein Spannungsfeld ab, zwischen dem Wunsch nach einem Kunstunterricht, der fair, transparent, legitimiert und ernstzunehmend sein soll und einem offenen Kunstunterricht, der Raum für Kreativität, Eigeninitiative, Feinsinn und andere Aspekte bietet, die schwer zu versprachlichen und zu operationalisieren sind. In einem weiteren Schritt wird Kompetenzorientierung als Schlüssel zu fairem, transparentem, erlernbarem kunstorientiertem Unterricht diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hinführung und Problematisierung
- 2.1 Verortung des intuitiven Standpunkts im wissenschaftlichen Diskurs
- 2.2 Künstlerische Bildung nach Buschkühle
- 3. Die Kunstorientierung vor dem Hintergrund des Benotungszwangs
- 3.1 Benotung als Legitimationshilfe - Aussagen einer Kunstlehrerin
- 3.2 Fairness vs. Feinsinn? Oder: Kriterienorientierung vs. Ästhetische Bildung?
- 4. Kompetenzorientierung als Schlüssel?
- 5. Folgerungen für die methodische Rahmung
- 5.1 Das Projekt
- 5.2 Die Werkstattarbeit
- 5.3 Das Prozessportfolio
- 5.4 Folgen für den Unterricht und die Lehrperson
- 6. Leistungsbeurteilung
- 6.1 Einordnung
- 6.2 Das Forschungsdesiderat
- 7. Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen der Benotung im Kunstunterricht an regulären Schulen, insbesondere im Kontext der kunstpädagogischen Ausbildung an Kunsthochschulen. Das Ziel ist es, die Problematik an der Schnittstelle zwischen Studium und Schulpraxis zu beleuchten, vor dem Hintergrund des wissenschaftlichen Diskurses zu diskutieren und einen möglichen Lösungsweg aufzuzeigen. Die Arbeit analysiert verschiedene kunstpädagogische Ansätze und ihre Auswirkungen auf die Bewertungspraxis.
- Die Problematik der Benotung im kunstorientierten Unterricht
- Der Spannungsbereich zwischen fairer Bewertung und der Förderung von Kreativität und Feinsinn
- Kompetenzorientierung als Ansatz für eine transparente und faire Bewertung
- Offene, prozessbasierte Konzeptionen im Kunstunterricht
- Geeignete Bewertungsmethoden für prozessorientierten Kunstunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit befasst sich mit der Herausforderung, einen kunstorientierten Kunstunterricht, wie er an Kunsthochschulen vermittelt wird, mit dem notengebundenen System regulärer Schulen zu vereinbaren. Sie fokussiert auf die Problematik der Bewertung und sucht nach einem Lösungsansatz, der sowohl den künstlerischen Freiraum der Schüler*innen als auch die Notwendigkeit einer fairen und transparenten Leistungsbeurteilung berücksichtigt. Die Einleitung skizziert den eigenen intuitiven Standpunkt der Autorin und kündigt die Auseinandersetzung mit relevanten kunstpädagogischen Theorien an.
2. Hinführung und Problematisierung: Dieses Kapitel beleuchtet den Unterschied zwischen der künstlerischen Praxis an Kunsthochschulen und den Anforderungen des schulischen Kontextes. Es wird die Schwierigkeit herausgestellt, die eigene künstlerische Position mit dem notenorientierten System der Schule zu vereinbaren, insbesondere hinsichtlich der Wahl einer geeigneten Bewertungsmethode. Der Abschnitt verweist auf die Arbeit von Peez und deren Kritik an der Diskrepanz zwischen kunstpädagogischer Ausbildung und schulischer Praxis. Die zentrale Forschungsfrage der Arbeit wird im Hinblick auf die Bewertung künstlerischer Praxis formuliert.
3. Die Kunstorientierung vor dem Hintergrund des Benotungszwangs: Dieses Kapitel untersucht den Konflikt zwischen dem Wunsch nach einem fairen und transparenten Kunstunterricht und der Notwendigkeit, die Leistungen der Schüler*innen zu bewerten. Anhand von Aussagen einer Kunstlehrerin wird das Spannungsfeld zwischen den Anforderungen an Fairness, Transparenz und Legitimität einerseits und der Förderung von Kreativität, Eigeninitiative und Feinsinn andererseits deutlich. Es werden die Grenzen der Kriterienorientierung im Kontext ästhetischer Bildung diskutiert.
4. Kompetenzorientierung als Schlüssel?: Dieses Kapitel untersucht, inwieweit Kompetenzorientierung einen Lösungsansatz für die Problematik der Leistungsbewertung im Kunstunterricht bietet. Es wird diskutiert, ob und wie sich durch eine klare Definition und Überprüfung von Kompetenzen ein fairer und transparenter, gleichzeitig aber auch kunstorientierter Unterricht gestalten lässt. Der Fokus liegt hier auf der Übertragbarkeit von an Kunsthochschulen gelehrten Kompetenzen in den Schulkontext.
5. Folgerungen für die methodische Rahmung: Dieses Kapitel präsentiert methodische Ansätze, die eine offene und prozessorientierte Gestaltung des Kunstunterrichts ermöglichen. Es werden das Projekt, die Werkstattarbeit und das Prozessportfolio als geeignete Unterrichts- und Bewertungsformen vorgestellt. Die Bedeutung dieser Methoden für die Leistungsbewertung wird analysiert, ebenso wie die daraus resultierenden Anforderungen an die Lehrkraft.
6. Leistungsbeurteilung: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Frage nach der optimalen Bewertungsform für den beschriebenen Kunstunterricht. Unter Bezugnahme auf Peez’ Kategorisierung von Bewertungsformen im Schulwesen werden die Vor- und Nachteile verschiedener Ansätze diskutiert und eine Empfehlung für ein geeignetes Verfahren im Kontext eines offenen und prozessorientierten Kunstunterrichts gegeben.
Schlüsselwörter
Kunstunterricht, Kunstpädagogik, Leistungsbeurteilung, Bewertung, Kompetenzorientierung, Prozessportfolio, faire Bewertung, Kreativität, Feinsinn, Künstlerische Bildung, Benotung, Schulpraxis, Hochschulausbildung.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Dokument?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die Titel, Inhaltsverzeichnis, Ziele und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es dient der Analyse von Themen im schulischen Kunstunterricht und der damit verbundenen Bewertungsproblematik.
Was sind die Hauptthemen der Arbeit?
Die Hauptthemen sind die Problematik der Benotung im kunstorientierten Unterricht, das Spannungsfeld zwischen fairer Bewertung und der Förderung von Kreativität und Feinsinn, Kompetenzorientierung als Ansatz für eine transparente und faire Bewertung, offene, prozessbasierte Konzeptionen im Kunstunterricht sowie geeignete Bewertungsmethoden für prozessorientierten Kunstunterricht.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Herausforderungen der Benotung im Kunstunterricht an regulären Schulen, insbesondere im Kontext der kunstpädagogischen Ausbildung an Kunsthochschulen. Ziel ist es, die Problematik an der Schnittstelle zwischen Studium und Schulpraxis zu beleuchten, vor dem Hintergrund des wissenschaftlichen Diskurses zu diskutieren und einen möglichen Lösungsweg aufzuzeigen.
Welche Kapitel werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel: Einleitung, Hinführung und Problematisierung, Die Kunstorientierung vor dem Hintergrund des Benotungszwangs, Kompetenzorientierung als Schlüssel?, Folgerungen für die methodische Rahmung, Leistungsbeurteilung, sowie Zusammenfassung und Fazit.
Was wird im Kapitel "Hinführung und Problematisierung" thematisiert?
Dieses Kapitel beleuchtet den Unterschied zwischen der künstlerischen Praxis an Kunsthochschulen und den Anforderungen des schulischen Kontextes. Es wird die Schwierigkeit herausgestellt, die eigene künstlerische Position mit dem notenorientierten System der Schule zu vereinbaren, insbesondere hinsichtlich der Wahl einer geeigneten Bewertungsmethode.
Welche methodischen Ansätze werden im Kapitel "Folgerungen für die methodische Rahmung" vorgestellt?
In diesem Kapitel werden das Projekt, die Werkstattarbeit und das Prozessportfolio als geeignete Unterrichts- und Bewertungsformen vorgestellt, die eine offene und prozessorientierte Gestaltung des Kunstunterrichts ermöglichen.
Was sind die Schlüsselwörter der Arbeit?
Die Schlüsselwörter sind: Kunstunterricht, Kunstpädagogik, Leistungsbeurteilung, Bewertung, Kompetenzorientierung, Prozessportfolio, faire Bewertung, Kreativität, Feinsinn, Künstlerische Bildung, Benotung, Schulpraxis, Hochschulausbildung.
Welchen Konflikt untersucht das Kapitel "Die Kunstorientierung vor dem Hintergrund des Benotungszwangs"?
Dieses Kapitel untersucht den Konflikt zwischen dem Wunsch nach einem fairen und transparenten Kunstunterricht und der Notwendigkeit, die Leistungen der Schüler*innen zu bewerten. Es wird das Spannungsfeld zwischen den Anforderungen an Fairness, Transparenz und Legitimität einerseits und der Förderung von Kreativität, Eigeninitiative und Feinsinn andererseits deutlich.
Was wird im Kapitel "Leistungsbeurteilung" behandelt?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Frage nach der optimalen Bewertungsform für den beschriebenen Kunstunterricht. Unter Bezugnahme auf Peez’ Kategorisierung von Bewertungsformen im Schulwesen werden die Vor- und Nachteile verschiedener Ansätze diskutiert und eine Empfehlung für ein geeignetes Verfahren im Kontext eines offenen und prozessorientierten Kunstunterrichts gegeben.
- Arbeit zitieren
- Sofia Zafiridou (Autor:in), 2021, Offene prozessbasierte Konzeptionen im Kunstunterricht, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1571473