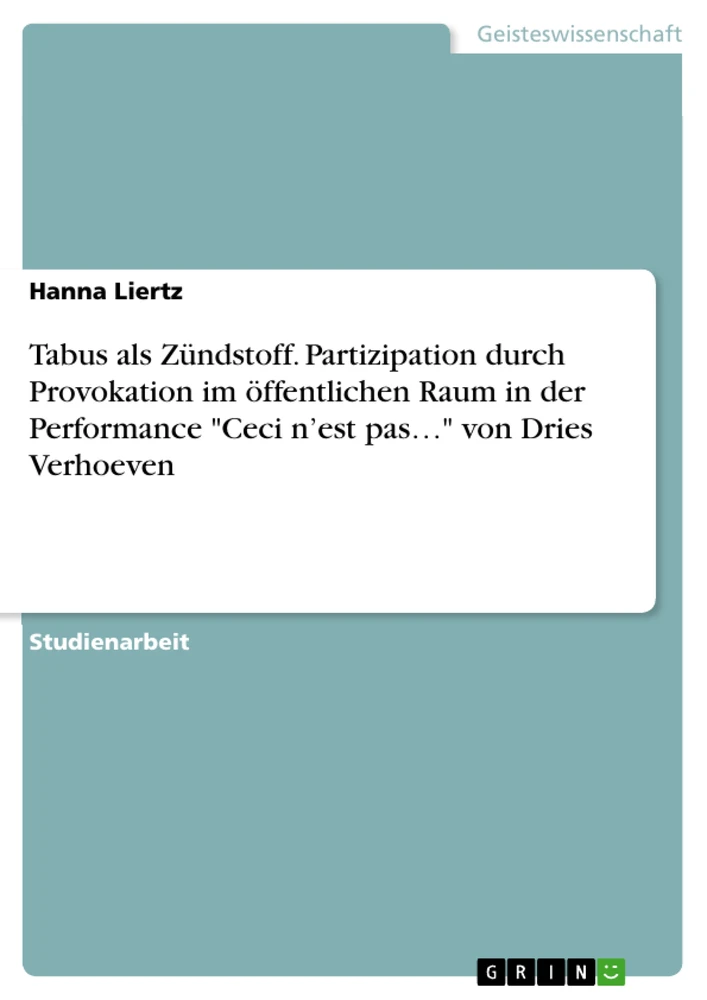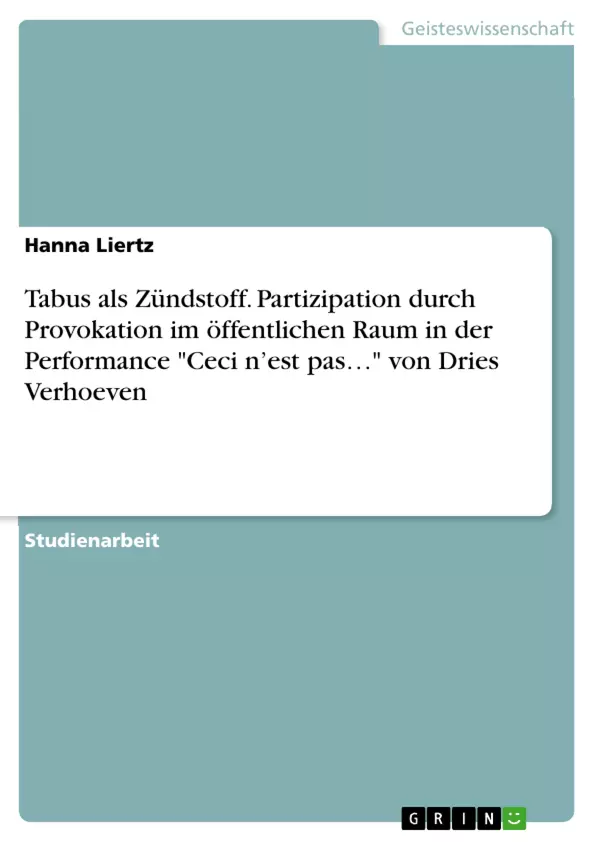Um die Wirkungsmacht auszuweiten, zeichnen sich in der darstellenden Kunst Bestrebungen ab, das Publikum nicht nur von außen teilhaben zu lassen, sondern direkt in das Geschehen miteinzubeziehen. Gerade die Performance-Kunst wendet sich von der traditionellen Vorstellung der distanzierten ZuschauerIn im abgetrennten Raum ab und strebt hin zu einer Öffnung von Raum und Handlung. Ein Tabubruch kann hier zum Zündstoff werden. Damit sich dieser nicht nur auf den Kunstraum beschränkt, wird in der Performance-Kunst oft der geschützte Rahmen eines Museums oder Theaters verlassen und stattdessen der öffentliche Raum zur Plattform gemacht. Auf diese Weise kann einerseits mehr, zum Teil nicht kunstaffines, Publikum erreicht werden, andererseits kann hier ein Tabubruch anders wirken.
Ein Beispiel hierfür ist die Performance "Ceci n`est pas…" des niederländischen Performance-Künstlers Dries Verhoeven, die erstmals 2013 in Utrecht gezeigt wurde und seitdem in verschiedenen europäischen Städten zu sehen ist. Im Stadtzentrum wird ein Glaskasten aufgebaut, in dem an zehn Tagen jeweils ein oder zwei Personen für einige Stunden gezeigt werden. Mit Rollläden, Heizung, Klimaanalage, Toilette sowie Essen und Trinken ausgestattet, bietet der schalldichte Glaskasten genug Komfort, um den PerformerInnen einen mehrstündigen Aufenthalt darin zu ermöglichen. Bei diesen handelt es sich größtenteils um LaiInnen aus der jeweiligen Stadt, die Dries Verhoeven beispielsweise über Facebook findet. Sie stehen jeweils symbolhaft für ein tabubelastetes Thema in der Gesellschaft. So sind beispielsweise ein schwangeres Mädchen im Teenageralter, eine nackte ältere Dame, eine transsexuelle Person, ein angeketteter dunkelhäutiger Mann und ein betender Muslim zu sehen. Da es in dieser Arbeit hauptsächlich um die Seite der RezipientInnen geht, wird die Tatsache, dass mit LaiInnen gearbeitet wird, nur am Rande Erwähnung finden. Jeder Tag hat einen Übertitel, wie Ceci n’est pas la nature oder Ceci n’est pas une mère, womit einerseits auf das behandelte Thema angespielt, andererseits die Assoziation mit der berühmten Bildunterschrift Ceci n’est pas une pipe des surrealistischen Malers René Magritte herausgefordert wird. An der Seite des Glaskastens befindet sich ein kurzer Text, der das jeweilige Thema des gezeigten Bildes‘ aufgreift und damit einen Kontext bietet.
Inhaltsverzeichnis
- Tabus und Tabubrüche in Gesellschaft und Kunst
- Eingriff der Performance-Kunst in den öffentlichen Raum
- Nutzung des öffentlichen Raums
- Störung im öffentlichen Raum in Ceci n'est pas ...
- Darstellung von tabuisierten Inhalten in Ceci n'est pas...
- Tabubrüche als Partizipationsanstoß in Ceci n'est pas...
- Interaktion mit den PerformerInnen durch den Blick
- Diskussion als Teilnahme am öffentlichen Diskurs
- Tabus als Zündstoff
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle von Tabubrüchen in der Performance-Kunst, insbesondere im Bezug auf die Partizipation des Publikums. Der Fokus liegt auf der Performance "Ceci n'est pas..." von Dries Verhoeven und deren Einbezug des öffentlichen Raums als Bühne für Provokation und gesellschaftliche Auseinandersetzung.
- Definition und gesellschaftliche Funktion von Tabus
- Der öffentliche Raum als performativer Schauplatz
- Die Rolle der Provokation in der Performance-Kunst
- Partizipation durch Interaktion und Diskussion
- Tabubrüche als Katalysator gesellschaftlicher Veränderung
Zusammenfassung der Kapitel
Tabus und Tabubrüche in Gesellschaft und Kunst: Dieses Kapitel beleuchtet die Definition und Geschichte des Begriffs "Tabu", seine Funktion in gesellschaftlichen Strukturen und seine Bedeutung für individuelle und kollektive Identität. Es wird der Unterschied zwischen offenen und heimlichen Tabus erklärt und die Rolle von "Tabugebern", "Tabunehmern" und "Tabuwächtern" herausgestellt. Der Text analysiert den Tabubruch als Motor gesellschaftlicher Entwicklung und seine Bedeutung in der Kunst als Mittel zur Infragestellung von Normen und zur Erzeugung neuer Denkweisen. Die Rezipienten der Kunst werden als Teil des Prozesses angesehen, da sie dem Künstler eine gewisse Freiheit zur schonungslosen Darstellung der Wahrheit einräumen. Die Kunst selbst bietet so einen geschützten Raum, in welchem Tabus gebrochen werden können, während im Alltag die Regeln weiterhin gelten.
Eingriff der Performance-Kunst in den öffentlichen Raum: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Besonderheiten der Performancekunst und ihren Wechsel von geschützten Räumen hin zu öffentlichen Orten als Bühne. Es wird der Unterschied der Wirkung eines Tabubruchs in einem traditionellen Kunstraum im Vergleich zum öffentlichen Raum beleuchtet. Die Nutzung des öffentlichen Raums als performativer Schauplatz stellt eine bewusste Strategie dar, ein breiteres, potentiell nicht-kunstaffines Publikum zu erreichen und eine intensivere Wirkung des Tabubruchs zu erzielen. Die Störung des öffentlichen Raumes wird als Mittel zur Provokation und zur Initiierung einer öffentlichen Diskussion über Tabuthemen verstanden.
Darstellung von tabuisierten Inhalten in Ceci n'est pas...: Dieses Kapitel beschreibt, wie die Performance "Ceci n'est pas..." von Dries Verhoeven tabuisierte Inhalte darstellt und auf diese Weise zum Dialog anregt. Die genaue Natur dieser Inhalte wird nicht explizit benannt, aber ihre Wirkung und ihre Bedeutung für die gesamte Performance werden ausführlich analysiert. Hier geht es um die künstlerische Umsetzung von Tabubrüchen und deren Wirkung auf das Publikum.
Tabubrüche als Partizipationsanstoß in Ceci n'est pas...: Dieses Kapitel analysiert die Mechanismen, durch die "Ceci n'est pas..." die Partizipation des Publikums fördert. Es werden sowohl die Interaktion durch den Blick, als auch die Beteiligung an einer öffentlichen Diskussion als Formen der Partizipation betrachtet. Die Analyse geht auf die spezifischen Strategien der Performance ein, die eine aktive Beteiligung des Publikums ermöglichen und ermutigen und wie diese Partizipation auf das Verständnis und die Wirkung der Tabubrüche einwirkt.
Schlüsselwörter
Tabu, Tabubruch, Performance-Kunst, öffentlicher Raum, Partizipation, Provokation, Ceci n'est pas..., gesellschaftliche Normen, Identität, Diskurs.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema der Analyse?
Die Analyse untersucht die Rolle von Tabubrüchen in der Performance-Kunst, insbesondere im Bezug auf die Partizipation des Publikums. Der Fokus liegt auf der Performance "Ceci n'est pas..." von Dries Verhoeven und deren Einbezug des öffentlichen Raums als Bühne für Provokation und gesellschaftliche Auseinandersetzung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und gesellschaftliche Funktion von Tabus, der öffentliche Raum als performativer Schauplatz, die Rolle der Provokation in der Performance-Kunst, Partizipation durch Interaktion und Diskussion, sowie Tabubrüche als Katalysator gesellschaftlicher Veränderung.
Was behandelt das Kapitel "Tabus und Tabubrüche in Gesellschaft und Kunst"?
Dieses Kapitel beleuchtet die Definition und Geschichte des Begriffs "Tabu", seine Funktion in gesellschaftlichen Strukturen und seine Bedeutung für individuelle und kollektive Identität. Es erklärt den Unterschied zwischen offenen und heimlichen Tabus und stellt die Rolle von "Tabugebern", "Tabunehmern" und "Tabuwächtern" heraus. Weiterhin wird der Tabubruch als Motor gesellschaftlicher Entwicklung und seine Bedeutung in der Kunst als Mittel zur Infragestellung von Normen und zur Erzeugung neuer Denkweisen analysiert.
Worauf konzentriert sich das Kapitel "Eingriff der Performance-Kunst in den öffentlichen Raum"?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Besonderheiten der Performancekunst und ihren Wechsel von geschützten Räumen hin zu öffentlichen Orten als Bühne. Es wird der Unterschied der Wirkung eines Tabubruchs in einem traditionellen Kunstraum im Vergleich zum öffentlichen Raum beleuchtet. Die Nutzung des öffentlichen Raums als performativer Schauplatz stellt eine bewusste Strategie dar, ein breiteres, potentiell nicht-kunstaffines Publikum zu erreichen und eine intensivere Wirkung des Tabubruchs zu erzielen.
Was wird im Kapitel "Darstellung von tabuisierten Inhalten in Ceci n'est pas..." untersucht?
Dieses Kapitel beschreibt, wie die Performance "Ceci n'est pas..." von Dries Verhoeven tabuisierte Inhalte darstellt und auf diese Weise zum Dialog anregt. Die genaue Natur dieser Inhalte wird nicht explizit benannt, aber ihre Wirkung und ihre Bedeutung für die gesamte Performance werden ausführlich analysiert. Es geht um die künstlerische Umsetzung von Tabubrüchen und deren Wirkung auf das Publikum.
Wie fördert "Ceci n'est pas..." die Partizipation des Publikums?
Das Kapitel "Tabubrüche als Partizipationsanstoß in Ceci n'est pas..." analysiert die Mechanismen, durch die "Ceci n'est pas..." die Partizipation des Publikums fördert. Es werden sowohl die Interaktion durch den Blick, als auch die Beteiligung an einer öffentlichen Diskussion als Formen der Partizipation betrachtet. Die Analyse geht auf die spezifischen Strategien der Performance ein, die eine aktive Beteiligung des Publikums ermöglichen und ermutigen.
Welche Schlüsselwörter werden in der Analyse verwendet?
Die Analyse verwendet folgende Schlüsselwörter: Tabu, Tabubruch, Performance-Kunst, öffentlicher Raum, Partizipation, Provokation, Ceci n'est pas..., gesellschaftliche Normen, Identität, Diskurs.
- Arbeit zitieren
- Hanna Liertz (Autor:in), 2019, Tabus als Zündstoff. Partizipation durch Provokation im öffentlichen Raum in der Performance "Ceci n’est pas…" von Dries Verhoeven, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1569380