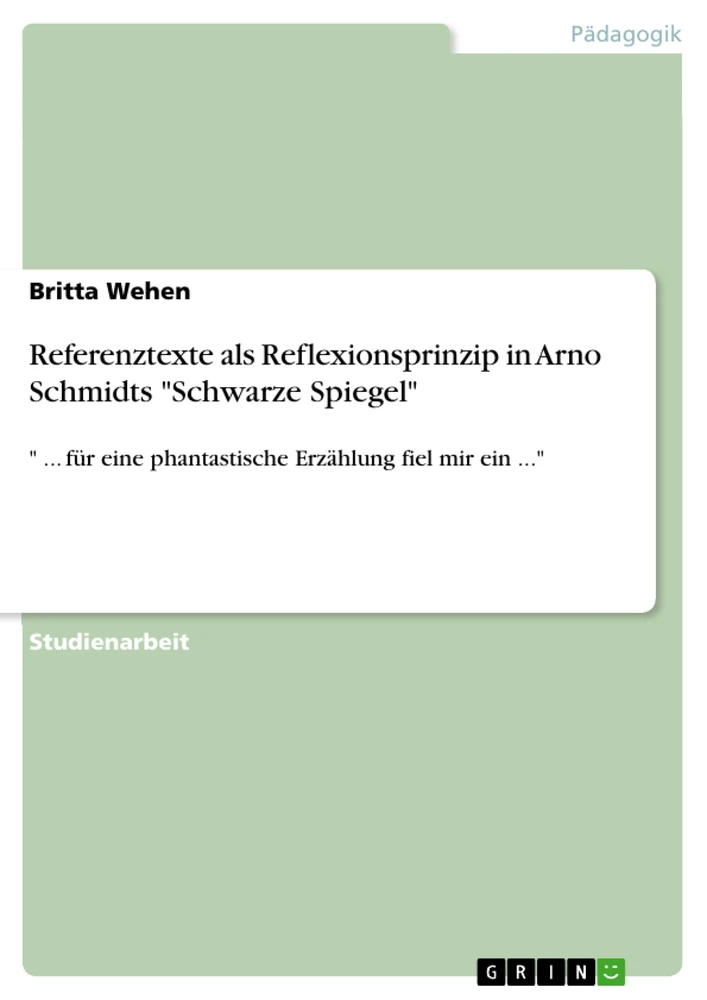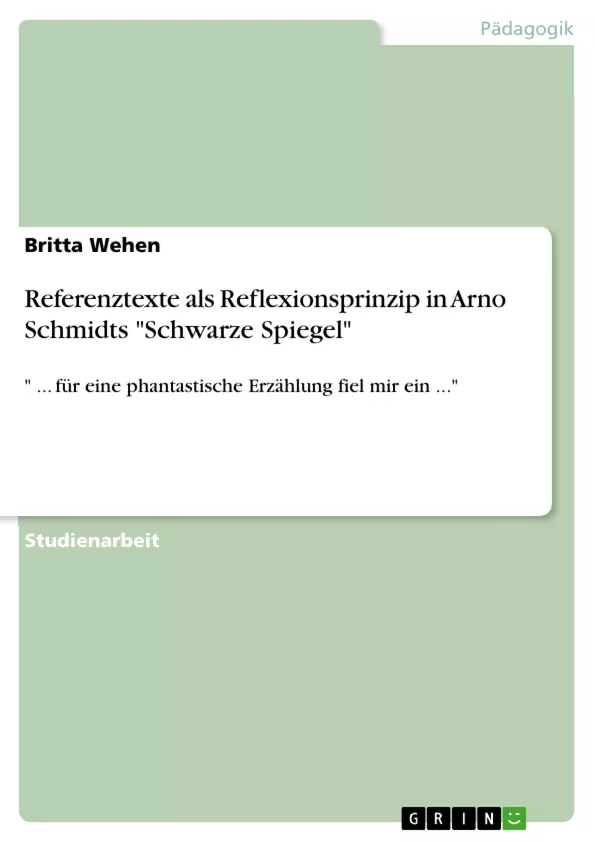„(1.5.1960) / Lichte? (ich hob mich auf den Pedalen) –: – Nirgends. (Also wie immer seit den fünf Jahren). / Aber: der lakonische Mond längs der zerbröckelten Straße (von den Rändern her haben Grad und Quecken die Teerdecke aufgebrochen, so daß nur in der Mitte noch zwei Meter Fahrbahn bleiben: das genügt ja für mich!) / Weiter treten: starrt die spitze Silberlarve aus m Wacholder – also weiter –“
So unvermittelt setzt das Geschehen von Arno Schmidts „Schwarze Spiegel“ ein. Ein namenloser Ich-Erzähler ist einer der letzten Überlebenden eines Dritten Weltkrieges und durchstreift die Lüneburger Heide. Von seiner einsamen Existenz berichtet er in Tagebuchform und hält in seinem Bericht immer wieder inne, um Versatzstücke aus Literatur, Philosophie, Kunst, Religion oder Kultur im Allgemeinen einzustreuen. Die Zahl der Verweise ist dabei enorm, kaum ein Satz kommt ohne inhaltliche oder strukturelle Anspielung aus, immer wieder werden Titel und Autoren erwähnt. Dass „Ego“ tatsächlich auch fremde Texte zitiert, bleibt in der Regel unmarkiert und fällt nur geübten und belesenen Rezipienten ins Auge. Die Referenztexte sind daher in ihrer Art auch sehr heterogen, für den Fortgang der Handlung haben sie keine unmittelbare Bedeutung. Wozu aber werden dann diese Textreferenzen aufgebaut?
Inhaltlich eng verwandt mit dem Begriff der „Textreferenz“ ist der Begriff der „Intertextualität“, der erstmalig von Julia Kristeva eingeführt wurde. Der Begriff der Textreferenz ist dem engeren Verständnis von Intertextualität am nächsten, da hierbei der Grad der Intertextualität betrachtet wird und nicht nur wörtliche Zitate einbezogen werden, sondern komplexe Strukturen, die durch die Menge aller Textreferenzen gebildet werden. Textreferenz kann also in bestimmten Texten aufgebaut werden, muss aber nicht auf jeden literarischen Text zutreffen.
Intertextuelle Anspielungen bzw. Textreferenzen können darüber hinaus selbstreflexiv sein.
Was also heißt Selbstreflexion überhaupt und welche Möglichkeiten hat eine Erzählung, ihren eigenen Status und die Regeln ihrer Produktion und Rezeption zu reflektieren?
Wie kann die Selbstreflexion für eine funktionale Analyse eines Erzähltextes detaillierter aufgeschlüsselt werden und welche Funktionen erfüllen in diesem Zusammenhang die zahlreichen Textreferenzen in Arno Schmidts Erzählung, die doch „ständig herumliegen“?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Terminologische Überlegungen: Selbstreflexion im narratologischen Sinn
- Erzähltheoretische Voraussetzungen in Schmidts „Schwarze Spiegel“
- Die Funktion der Referenztexte
- Formale und inhaltliche Klassen von Referenztexten
- „Akustischer Abfall“ - Schlagertitel
- Postkarten und Briefe
- Die phantastische Erzählung Achamoth
- Professor Stewarts „Man, an Autobiography“
- „Meine Ansicht“ – Die Rede von Ego
- Die Kindheitserinnerungen des Erzählers
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Seminar „Reflexion des Mediums Literatur“ untersucht die Funktion von Referenztexten in Arno Schmidts „Schwarze Spiegel“. Der Fokus liegt auf der Analyse der komplexen Selbstreflexion der Erzählung und der Rolle, die die zahlreichen Textreferenzen dabei spielen.
- Selbstreflexion in literarischen Texten
- Die Funktion von Referenztexten als Reflexionsprinzip
- Die Bedeutung von Intertextualität in „Schwarze Spiegel“
- Die verschiedenen Arten von Referenztexten in der Erzählung
- Die Rolle der Referenztexte für den Aufbau der Erzählung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Leser in das Thema des Seminars und die Besonderheiten von Arno Schmidts „Schwarze Spiegel“ ein. Sie beschreibt den namenlosen Ich-Erzähler, seine einsame Existenz und die zahlreichen Textreferenzen in der Erzählung.
- Terminologische Überlegungen: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriff der Selbstreflexion im narratologischen Sinn. Es werden verschiedene Formen der Selbstbezüglichkeit beschrieben, die von intertextuellen Anspielungen bis hin zur Reflexion des eigenen Schreibakts reichen.
- Erzähltheoretische Voraussetzungen in Schmidts „Schwarze Spiegel“: Das Kapitel beleuchtet die narratologischen Besonderheiten von „Schwarze Spiegel“ und erläutert die grundlegenden Elemente der Selbstreflexion in der Erzählung.
- Die Funktion der Referenztexte: Dieses Kapitel widmet sich den verschiedenen Arten von Referenztexten in Schmidts Erzählung. Es analysiert die formalen und inhaltlichen Klassen der Textreferenzen und untersucht ihre Funktion innerhalb des Textes.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen der Selbstreflexion, Intertextualität und Textreferenz. Besonderer Fokus liegt auf der Analyse der Funktion von Referenztexten in Arno Schmidts „Schwarze Spiegel“ als Reflexionsprinzip.
- Quote paper
- Britta Wehen (Author), 2010, Referenztexte als Reflexionsprinzip in Arno Schmidts "Schwarze Spiegel", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/156157