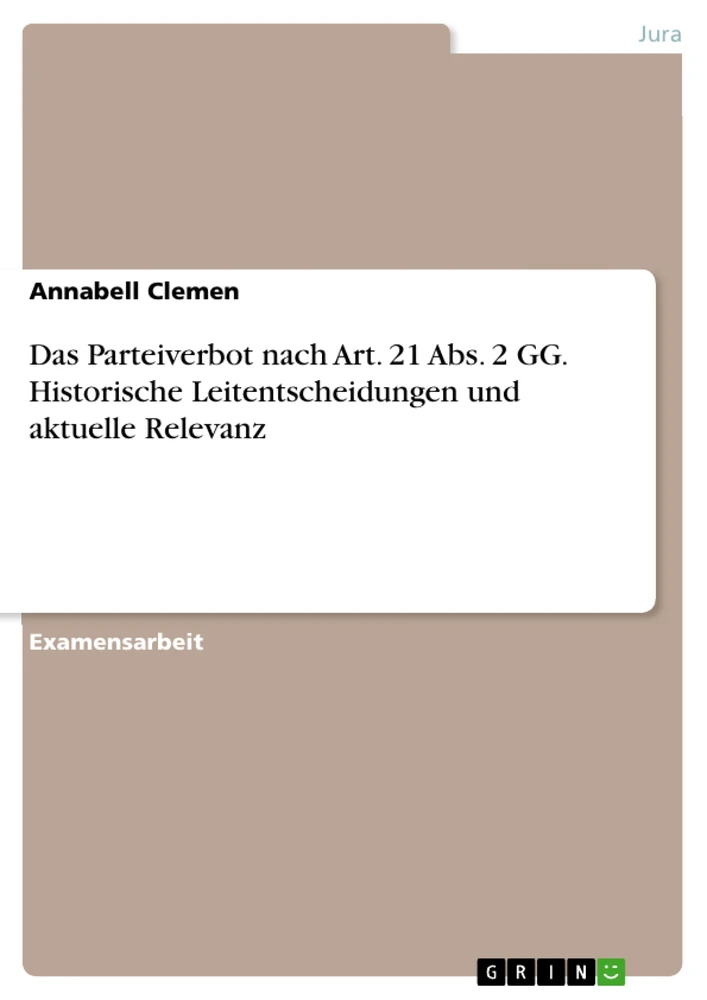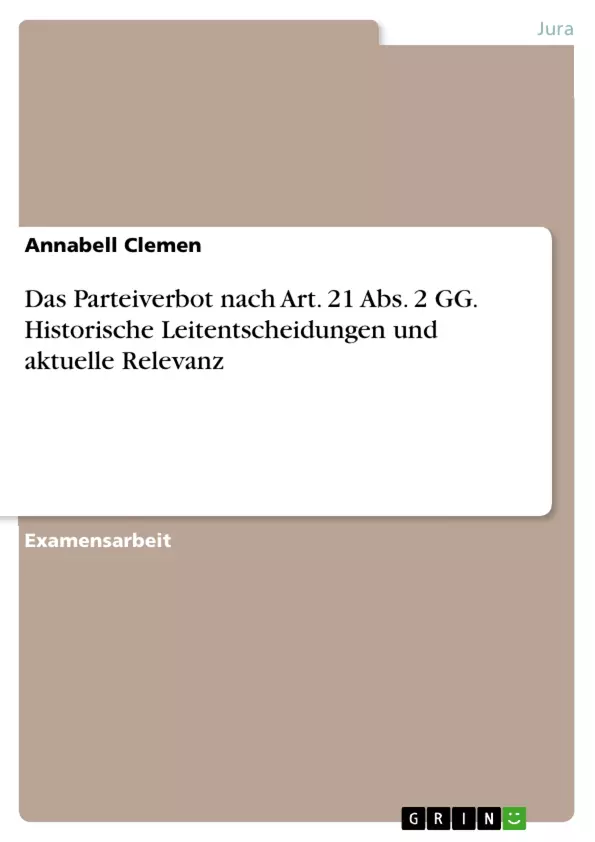Im Mittelpunkt der Arbeit stehen die BVerfGE 2, 1 und BVerfGE 5, 85 als Leitentscheidungen zum Parteiverbot aus den Gründungsjahren der bundesrepublikanischen Demokratie. Diese bilden bis heute den einzigen rechtsgeschichtlichen Vergleichspunkt für einen Verbotsausspruch und sind so angesichts gegenwärtiger hitziger Diskussionen über eine mögliche Verfassungswidrigkeit der AfD von höchster Bedeutung. Zugleich wird eine Untersuchung der Weiterentwicklung der Rechtsprechung in BVerfGE 144, 20 vorgenommen, um feststellen zu können, welche Bedeutung den in den Leitentscheidungen aufgestellten Grundsätzen für künftige Parteiverbote zukommen kann.
Inhaltsverzeichnis
- A) Einleitung
- B) Die Verfassungsrechtliche Verankerung des Parteiverbotes
- C) Das Parteiverbotsverfahren
- 1. Der Ablauf des Verfahrens
- 2. Die Verbotswirkungen
- D) Der Zeitgeschichtliche Hintergrund der Verbotsentscheidungen
- I. Die Sozialistische Reichspartei (SRP)
- II. Die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD)
- E) Die Rechtsprechung der Leitentscheidungen BVerfGE 2, 1 und BVerfGE 5, 85
- I. Die verfassungsrechtliche Legitimation von Art. 21 II GG
- II. Die materiellen Voraussetzungen des Art. 21 II GG
- 1. „Partei“
- 2. „Freiheitliche demokratische Grundordnung“
- 3. „Gefährdung des Bestandes der Bundesrepublik Deutschland“
- 4. „Beseitigen oder Beeinträchtigen“
- 5. „Darauf-Ausgehen“
- 6. „nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger“
- III. Die Anwendung der rechtlichen Grundlagen in der Praxis
- 1. Die Verbotsentscheidung zur SRP
- 2. Die Verbotsentscheidung zur KPD
- F) Das Parteiverbot in der Rechtsprechung nach 1956
- I. Weitere Verbotsverfahren in der Geschichte Deutschlands
- II. Die Weiterentwicklung der Rechtsprechung im NPD-Urteil
- 1. Die Änderung der Auslegung des „Darauf-Ausgehens“
- 2. Die Konkretisierung der weiteren Tatbestandsmerkmale
- G) Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die Leitentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum Parteiverbot nach Artikel 21 Absatz 2 GG, insbesondere die Urteile zu SRP und KPD. Ziel ist es, die verfassungsrechtlichen Grundlagen des Parteiverbots, den Ablauf des Verfahrens und die historische Einbettung in den Kontext der Nachkriegszeit zu beleuchten. Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Rechtsprechung bis nach 1956.
- Verfassungsrechtliche Grundlagen des Parteiverbots (Art. 21 Abs. 2 GG)
- Ablauf des Parteiverbotsverfahrens
- Historischer Kontext der Verbotsentscheidungen (SRP und KPD)
- Materielle Voraussetzungen für ein Parteiverbot
- Entwicklung der Rechtsprechung zum Parteiverbot nach 1956
Zusammenfassung der Kapitel
A) Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Seminararbeit ein und skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit. Sie dient als Überblick über die folgenden Kapitel und stellt den Kontext der Analyse der Leitentscheidungen zum Parteiverbot dar.
B) Die Verfassungsrechtliche Verankerung des Parteiverbotes: Dieses Kapitel befasst sich mit der verfassungsrechtlichen Grundlage des Parteiverbots gemäß Artikel 21 Absatz 2 GG. Es analysiert den Wortlaut und die Intention der Norm im Kontext des Grundgesetzes und diskutiert die Bedeutung des Parteiverbots für die freiheitlich-demokratische Grundordnung.
C) Das Parteiverbotsverfahren: Hier wird der Ablauf eines Parteiverbotsverfahrens detailliert beschrieben. Es werden die verschiedenen Verfahrensschritte, die beteiligten Akteure und die rechtlichen Grundlagen erläutert. Die Bedeutung der Verbotswirkungen für die betroffene Partei wird ebenfalls behandelt.
D) Der Zeitgeschichtliche Hintergrund der Verbotsentscheidungen: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Kontext der Verbotsentscheidungen gegen die SRP und die KPD. Es analysiert die jeweiligen politischen Hintergründe, die Aktivitäten der Parteien und deren Bedeutung für die junge Bundesrepublik Deutschland. Der Fokus liegt auf den Gefährdungspotenzialen für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die zu den Verboten führten.
E) Die Rechtsprechung der Leitentscheidungen BVerfGE 2, 1 und BVerfGE 5, 85: Dieser zentrale Teil analysiert die beiden wegweisenden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu den Parteiverboten. Es werden die verfassungsrechtliche Legitimation des Art. 21 II GG, die materiellen Voraussetzungen eines Verbots und deren Anwendung in der Praxis im Detail untersucht. Die Urteile zur SRP und KPD werden im Kontext der jeweiligen Umstände und Argumentation des Gerichts eingeordnet.
F) Das Parteiverbot in der Rechtsprechung nach 1956: Das Kapitel beschreibt die Weiterentwicklung der Rechtsprechung zum Parteiverbot nach den Entscheidungen zu SRP und KPD. Es wird die Bedeutung weiterer Verbotsverfahren und die Modifizierung der Auslegung von Art. 21 II GG im Lichte des NPD-Urteils untersucht. Der Schwerpunkt liegt auf der Anpassung der Rechtsprechung an veränderte politische und gesellschaftliche Bedingungen.
Schlüsselwörter
Parteiverbot, Artikel 21 Absatz 2 GG, Bundesverfassungsgericht, SRP, KPD, Freiheitliche demokratische Grundordnung, Gefährdung des Staats, Rechtsprechung, Verfassungsrecht, Verbotsverfahren.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Dokument?
Dieses Dokument ist eine Vorschau einer Seminararbeit zum Thema Parteiverbot nach Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes (GG). Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was ist der thematische Schwerpunkt der Seminararbeit?
Der thematische Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Leitentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zum Parteiverbot, insbesondere der Urteile zur Sozialistischen Reichspartei (SRP) und der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD).
Welche verfassungsrechtlichen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die verfassungsrechtlichen Grundlagen des Parteiverbots gemäß Artikel 21 Absatz 2 GG. Dies beinhaltet die Analyse des Wortlauts und der Intention der Norm im Kontext des Grundgesetzes.
Wie wird das Parteiverbotsverfahren beschrieben?
Das Dokument beschreibt den Ablauf eines Parteiverbotsverfahrens, einschließlich der Verfahrensschritte, der beteiligten Akteure und der rechtlichen Grundlagen. Es behandelt auch die Verbotswirkungen für die betroffene Partei.
Welcher historische Kontext wird betrachtet?
Die Seminararbeit beleuchtet den historischen Kontext der Verbotsentscheidungen gegen die SRP und die KPD. Dies umfasst die Analyse der politischen Hintergründe, der Aktivitäten der Parteien und ihrer Bedeutung für die junge Bundesrepublik Deutschland.
Welche Leitentscheidungen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Entscheidungen des BVerfG, insbesondere die Urteile BVerfGE 2, 1 (SRP-Urteil) und BVerfGE 5, 85 (KPD-Urteil). Die verfassungsrechtliche Legitimation des Art. 21 II GG und die materiellen Voraussetzungen eines Verbots werden im Detail untersucht.
Wie wird die Rechtsprechung nach 1956 berücksichtigt?
Das Dokument beschreibt die Weiterentwicklung der Rechtsprechung zum Parteiverbot nach den Entscheidungen zu SRP und KPD. Es wird die Bedeutung weiterer Verbotsverfahren und die Modifizierung der Auslegung von Art. 21 II GG, insbesondere im Lichte des NPD-Urteils, untersucht.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Parteiverbot, Artikel 21 Absatz 2 GG, Bundesverfassungsgericht, SRP, KPD, Freiheitliche demokratische Grundordnung, Gefährdung des Staats, Rechtsprechung, Verfassungsrecht, Verbotsverfahren.
- Arbeit zitieren
- Annabell Clemen (Autor:in), 2024, Das Parteiverbot nach Art. 21 Abs. 2 GG. Historische Leitentscheidungen und aktuelle Relevanz, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1559690