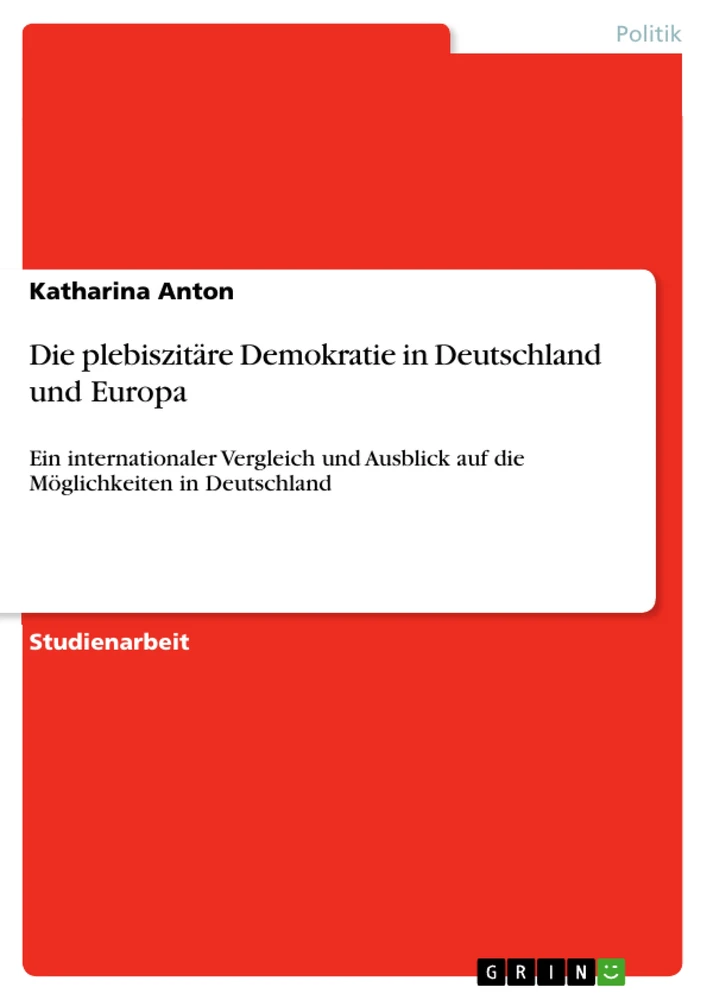In dieser Arbeit wird untersucht, welche Maßnahmen in Deutschland möglich sind, um die Bevölkerung stärker an politischen Prozessen zu beteiligen. Dafür wird zunächst die Entwicklung der repräsentativen und plebiszitären Demokratie in Deutschland (in groben Zügen) skizziert, sowie ein Blick auf den heutigen Stand plebiszitärer Elemente geworfen. Es folgt eine Betrachtung der direktdemokratischen Elemente in den EU-Mitgliedsstaaten Schweiz, Frankreich und Italien, um von dort aus mögliche Rückschlüsse zu ziehen und einen Ausblick auf die Möglichkeiten in Deutschland zu geben.
Artikel 20, Absatz 2 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland besagt, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgehe: „Sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.“ Dieser Formulierung nach könnte man darauf schließen, dass die plebiszitären Elemente dem System der repräsentativen Demokratie in etwa gleichberechtigt gegenüber stehen. Dem ist aber nicht so. Nach einer langen Entwicklung der Demokratie in Deutschland, geprägt durch schwere Rückschläge in der Vergangenheit, sind heute die Wahlen das einzige plebiszitäre Element, das nicht nur im Grundgesetz festgeschrieben ist, sondern auch umgesetzt wird. Die Skepsis gegenüber Plebisziten scheint selbst heute noch bei einem Großteil der politischen Klasse festzusitzen. Dies zeugt nicht zuletzt auch von mangelndem Vertrauen in die Bevölkerung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklung der repräsentativen und plebiszitären Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland
- Der Parlamentarische Rat 1948/49
- Die Enquete-Kommission Verfassungsreform
- Die Verfassungsreform im Zuge der Wiedervereinigung: GVK
- Das Element der plebiszitären Demokratie in Deutschland aktuell
- Das Element der plebiszitären Demokratie in anderen europäischen Staaten
- Plebiszitäre Elemente in der Schweiz
- Plebiszitäre Elemente in Frankreich
- Plebiszitäre Elemente in Italien
- Ausblick: Welche Möglichkeiten gibt es für Plebiszite in Deutschland?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten einer stärkeren Beteiligung der Bevölkerung an politischen Prozessen in Deutschland. Sie analysiert die historische Entwicklung der repräsentativen und plebiszitären Demokratie in Deutschland und vergleicht die Situation mit anderen europäischen Ländern. Der Fokus liegt auf der Erforschung der Gründe für die Zurückhaltung gegenüber Plebisziten und der Bewertung möglicher zukünftiger Entwicklungen.
- Historische Entwicklung der repräsentativen und plebiszitären Demokratie in Deutschland
- Analyse der Gründe für die Skepsis gegenüber Plebisziten in der deutschen Politik
- Vergleich der Situation in Deutschland mit anderen europäischen Staaten
- Bewertung der Legitimität und Effektivität plebiszitärer Elemente
- Möglichkeiten für zukünftige Reformen des politischen Systems in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die zentrale Forschungsfrage: Wie kann die Bevölkerung in Deutschland stärker an politischen Prozessen beteiligt werden? Sie verweist auf Artikel 20, Absatz 2 des Grundgesetzes, der die Staatsgewalt beim Volk verortet, und stellt die Diskrepanz zwischen dieser Formulierung und der tatsächlichen Praxis heraus. Die Arbeit skizziert den methodischen Ansatz, der die historische Entwicklung der repräsentativen und plebiszitären Demokratie in Deutschland, den aktuellen Stand plebiszitärer Elemente sowie einen Vergleich mit anderen europäischen Staaten umfasst. Der Ausblick fokussiert sich auf mögliche zukünftige Entwicklungen in Deutschland.
Entwicklung der repräsentativen und plebiszitären Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland: Dieses Kapitel beschreibt die historische Entwicklung der Demokratie in Deutschland und die damit verbundene Skepsis gegenüber Plebisziten, die als „Phobie“ bezeichnet wird. Es werden die Gründe für diese Skepsis beleuchtet, die eng mit der Geschichte der Weimarer Republik und der Angst vor einer Destabilisierung des politischen Systems verbunden sind. Das Kapitel analysiert wichtige Meilensteine der Verfassungsgeschichte, darunter der Parlamentarische Rat 1948/49, die Enquete-Kommission Verfassungsreform und die Verfassungsreform im Zuge der Wiedervereinigung, um die anhaltende Zurückhaltung gegenüber plebiszitären Elementen zu verdeutlichen.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten einer stärkeren Beteiligung der Bevölkerung an politischen Prozessen in Deutschland. Sie analysiert die historische Entwicklung der repräsentativen und plebiszitären Demokratie in Deutschland und vergleicht die Situation mit anderen europäischen Ländern.
Was sind die Themenschwerpunkte der Arbeit?
Die Themenschwerpunkte umfassen die historische Entwicklung der repräsentativen und plebiszitären Demokratie in Deutschland, die Gründe für die Skepsis gegenüber Plebisziten, einen Vergleich mit anderen europäischen Staaten, die Bewertung der Legitimität und Effektivität plebiszitärer Elemente sowie Möglichkeiten für zukünftige Reformen des politischen Systems in Deutschland.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist die Erforschung der Gründe für die Zurückhaltung gegenüber Plebisziten und die Bewertung möglicher zukünftiger Entwicklungen im Hinblick auf eine stärkere Bürgerbeteiligung in Deutschland.
Welche Kapitel sind in der Arbeit enthalten?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zur Entwicklung der repräsentativen und plebiszitären Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland, ein Kapitel zum Element der plebiszitären Demokratie in Deutschland aktuell, ein Kapitel zum Element der plebiszitären Demokratie in anderen europäischen Staaten (Schweiz, Frankreich, Italien) und einen Ausblick auf mögliche Plebiszite in Deutschland.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die zentrale Forschungsfrage: Wie kann die Bevölkerung in Deutschland stärker an politischen Prozessen beteiligt werden? Sie verweist auf Artikel 20, Absatz 2 des Grundgesetzes und skizziert den methodischen Ansatz.
Was beschreibt das Kapitel zur Entwicklung der Demokratie in der BRD?
Dieses Kapitel beschreibt die historische Entwicklung der Demokratie in Deutschland und die damit verbundene Skepsis gegenüber Plebisziten. Es analysiert wichtige Meilensteine der Verfassungsgeschichte, darunter der Parlamentarische Rat 1948/49, die Enquete-Kommission Verfassungsreform und die Verfassungsreform im Zuge der Wiedervereinigung.
- Quote paper
- Katharina Anton (Author), 2014, Die plebiszitäre Demokratie in Deutschland und Europa, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1559609