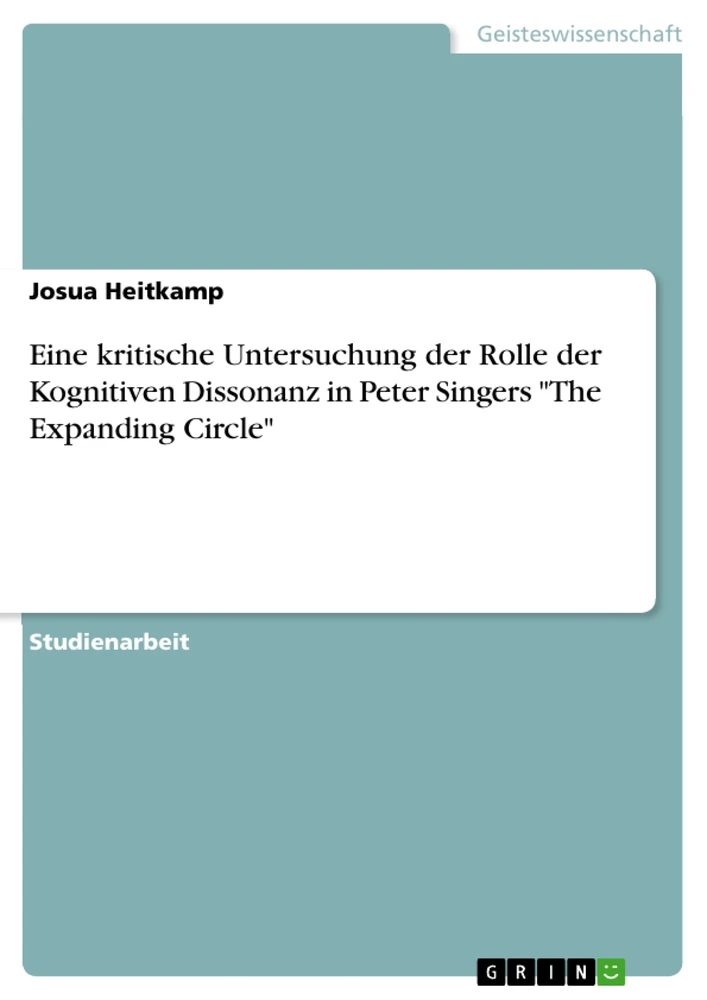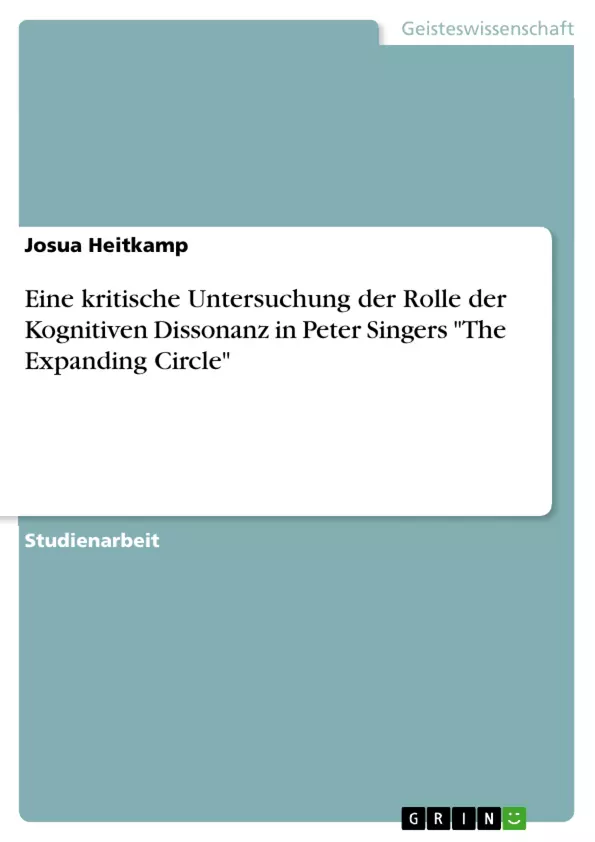Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Peter Singers "The Expanding Circle" und legt ihr Augenmerk auf Singers Verwendung und Einordnung des aus der Psychologie stammenden Begriffs der Kognitiven Dissonanz in einen philosophischen Kontext. Die kritische Betrachtung wird stellenweise begleitet durch eigene Erklärungsversuche und kritische Beispiele. Die Untersuchung erstreckt sich dabei über das fünfte und sechste Kapitel (Reason and Genes und A new Understanding of Ethics), da der Begriff der Kognitiven Dissonanz das erste Mal im fünften Kapitel erwähnt wird und die vorherigen Kapitel für dessen Betrachtung vernachlässigt werden können.
Inhaltsverzeichnis
Erste Begriffsklärung
Möglichkeiten zur Auflösung der Dissonanz
Regeln und practice what you preach
Konklusion
Literaturverzeichnis
Eine kritische Untersuchung der Rolle der Kognitiven Dissonanz in Peter Singers The Expanding Circle
Erste Begriffsklärung
Der australische Philosoph und Ethikforscher Peter Singer untersucht in dem 1981 erschienenen Buch „The Expanding Circle“ ethische Handlungsweisen und ihre Verbindung zur Soziobiologie. Meine nachfolgende Untersuchung richtet ihr Augenmerk auf Singers Verwendung und Einordnung des aus der Psychologie stammenden Begriffs der Kognitiven Dissonanz in einen philosophischen Kontext. Die kritische Betrachtung wird stellenweise begleitet durch eigene Erklärungsversuche und kritische Beispiele. Die Untersuchung erstreckt sich dabei über das fünfte und sechste Kapitel (Reason and Genes und A new Understanding of Ethics), da der Begriff der Kognitiven Dissonanz das erste Mal im fünften Kapitel erwähnt wird und die vorherigen Kapitel für dessen Betrachtung vernachlässigt werden können.
Das Unterkapitel Ambivalence 1 des fünften Kapitels leitet Singer mit den Worten „It may not take much to see that one’s own problems are the problems of just one among many, but seeing this is not the same as acting according with it”2 ein. Hintergrund hinter dieser Handlunsgweise des Menschen ist das Phänomen der Kognitiven Dissonanz, welches Singer auf Seite 143 durch den amerikanischen Soziopsychologen Leon Festinger erklären lässt und selbst wie folgt zusammenfasst: „[It] means that if we sense an inconsistency in our beliefs, or between our beliefs and our actions, we will try to do something to eliminate the sense of inconsistency, just as when we feel hungry we will try to do something to eliminate our hunger.” Im Nachfolgenden untersucht Singer, wie diese Eliminierung des Unwohlseins bewerkstelligt werden kann und ob kognitiv dissonantes Handeln zwangsläufig zu Unwohlsein führt. Singer orientiert sich hierbei an einer Aussage des schottischen Philosophen David Hume “Reason Is and Ought Only to Be the Slave of the Passions”, welche den Verstand den Bedürfnissen unterordnet. Wäre der Verstand also wirklich nur Diener der Leidenschaften und Verlangen des Menschen, müsste zumindest zwischen diesen Harmonie und keine Dissonanz herrschen.
Mögli chkeiten zur Auflösung der Dissonanz
Singer beginnt mit dem Hinweis, dass zur Auflösung der Dissonanz nicht zwangsläufig die konfligierenden Vorstellungen oder Handlungen einer Wahrheit entspringen müssen. Hierbei stützt er sich auf den amerikanischen Sozialpsychologen Leon Festinger und den schwedischen Ökonomen Gunnar Myrdal. Um dies mit einem eigenen Beispiel zu begleiten, bedeutet es also nicht, dass die einzige Lösung für den inneren Konflikt, Zigarren zu rauchen3 und ein gesundes Leben führen zu wollen, das Einstellen des Rauchens ist; das durch diesen Konflikt verursachte Unwohlsein kann auch auf findigeren Wegen bekämpft werden. Möglich wäre auch, die konfligierende Überzeugung (Zigarren rauchen zu wollen) zu akzeptieren, oder andererseits auch das Interesse an einer Überzeugung fallenzulassen (nach einem gesunden Leben zu streben). Auf den ersten Blick scheint beides weder überzeugend noch rational, allerdings begründet Singer die Möglichkeiten damit, dass „Human beings are not the perfectly rational creatures they would be if they strove for truth and consistency at all times“4. Ein vielleicht zu einfacher Ausweg, wie ich finde und zeigen will.
Komplexer wird die Thematik in einem größeren Raum. Entscheide ich mich alleine in meinem Wohnzimmer gegen meine Gesundheit und für das Zigarre rauchen, ist es einfacher, den Konflikt zu überwinden und sich dem Genuss hinzugeben. Wie sieht es allerdings in einem öffentlichen Raum aus? Entsteht ein Konflikt, wenn ich als Zigarrenraucher das Rauchen an öffentlichen Plätzen wie Bushaltestellen, Jahrmärkten oder Stehkaffees ablehne und verurteile? Singer schlägt hierfür eine Lösung vor, die er selbst als Heuchelei betitelt, sein Urteil aber dadurch entschärft, dass Heuchelei eine natürliche Rolle in der Verfolgung der eigenen Interessen spielt. „One can adopt one set of principles in private and a different set in public without any inconsistency”5, soweit erhält Singer meine und wahrscheinlich auch allgemeine Zustimmung, seine Fortführung sehe ich aber etwas kritisch, „all one has to do is make one’s overriding principle the pursuit of self-interest, and then use ethical reasoning in public situations for the purpose of impressing others with one’s impartiality, but not as a real guide to one’s actions”. Man strebe also immer dem eigenen Interesse nach und in der Öffentlichkeit erhebe man die Fremdwahrnehmung als höchstes Gut. – Sicher funktioniert das, um einen Konflikt verschiedener Werte zu verhindern, allerdings wirkt es auf mich sehr pessimistisch und kurzsichtig. Ich möchte dies an meinem bereits eingeführten Beispiel erläutern. Wenn ich das Rauchen in der Öffentlichkeit auf Höflichkeit meiner Mitmenschen gegenüber ablehne, selbst in meinen Privaträumen aber rauche, kann ich durch diese Handlung nicht die Gesellschaft beeindrucken, es sei denn, ich würde dies laut und wiederholt kommunizieren. Wenn ich sogar ein Rauchverbot an öffentlichen Orten wünsche, würde dies noch mehr die Möglichkeit beschneiden, durch mein nicht Rauchen hervorzustechen. Es würde mich gleichermaßen erfüllen, das Rauchen an öffentlichen Orten verboten zu wissen, wie in meinem eigenen Haus rauchen zu können. Ich würde gerne auch in einem Kaffee gemütlich zur Tageszeitung eine Zigarre rauchen, befürworte trotzdem ein Verbot. Ein Konflikt liegt eigentlich auf der Hand, trotzdem leide ich unter diesem nicht. Lösbar durch Singers Vorschlag scheint das Problem nicht.
Letztendlich unterstellt Singer diesem Vorgehen selbst keine langfristigen Erfolgschancen. „Nevertheless […] a life of systematic hypocrisy is likely to be uncomfortable. To present a false face in public, to be constantly on guard instead of open and spontaneous […] all this brings disharmony into one’s life.”6 Also ist dieser Lösungsvorschlag vielmehr ein Abschnitt auf dem Weg zu einer befriedigenderen Lösung. Da der Mensch ein soziales Wesen sei und für ein rein selbstzentriertes Handeln zu viel Sympathie für seine Mitmenschen aufbringe, wäre eine andere Option, die Disharmonie zwischen privaten und öffentlichen Ansichten zu reduzieren. Wie könnte ich das aber in meinem Beispiel versuchen? Bevor ich mich wieder meinem Zigarre rauchenden - Rauchen verbieten wollenden, beispielhaften selbst zuwende, möchte ich Singers Ausführungen, bis zum Ende seines Kapitels wiedergeben.
Er fährt fort mit dem hedonistischen Paradoxon, welches besagt, dass diejenigen, die das Streben nach ihrem Vergnügen als höchste Maxime ansetzen, weniger vergnüglich sind, als diese, die nicht danach streben. So findet sich das Glück in einem erfüllten, nach etwas anderem strebenden Leben von allein, während das Streben nach immer mehr Erfüllung zu einem unglücklichen Leben führen soll. „Hence, these philosophers claim, if we want to lead a happy life, we should not seek happiness directly, but should find a larger purpose in life, outside ourselves.”7 Auch wenn Singer eine Generalisierung in dieser Aussage anerkennt, hält er daran fest, dass der Mensch ein Wesen ist, welches dazu bedingt ist, nach höheren Zielen als seine eigene Bedürfniserfüllung zu streben: „Perhaps, having developed into beings with purposes, we are naturally driven to seek larger purposes, which give meaning and significance to our lives.“8 Hierin könnte nun endlich eine adäquate Antwort auf den Beispielkonflikt liegen. Der Wunsch nach dem Rauchverbot ist in diesem Fall nämlich nicht egoistisch begründet und soll nicht das Streben nach dem eigenen Glück befördern. Es dient auch nicht der Selbstdarstellung. Indem ich selbst in meinen privaten Räumen rauche, aber das Rauchen in der Öffentlichkeit ablehne, entsteht kein Widerspruch, wenn ich beide Absichten unter das gleiche Ziel unterordne: Ein selbstbestimmtes Leben für jedermann. Mit diesem Ziel als Absicht für beide Wünsche entsteht kein Konflikt. Ich selbst rauche, weil mir danach beliebt und ich mein Belieben selbstbestimmt über meine Gesundheit in diesem Fall werte, wünsche für alle anderen aber die Möglichkeit, in der Öffentlichkeit gegen ihren selbstbestimmten Willen keinem gesundheitsschädlichen Rauch ausgesetzt zu sein.
Letztendlich scheint Singers Vorschlag, die konfligierenden Willen unter einem anderen Willen unterzuordnen und zu vereinigen, doch erfolgreich; allerdings ist es zu einfach, dafür den Egoismus und das Streben nach höchster persönlicher Freude einzusetzen. Unter einem höheren Ziel, das auch der Natur des Menschen entspricht, scheint der Vorschlag aber möglich. „The impartial standpoint of ethics has the advantage of drawing us beyond concern with our own interests, to wider purposes in which we can find deeper fulfillment and a more meaningful life.”9 Mit dem gewählten Ziel der Selbstbestimmung ist in meinem Beispiel also schon ein unparteiischer Standpunkt eingenommen, unter das sich beide Interessen unterordnen lassen.
Dennoch merkt Singer an, dass der menschliche Hang zum egoistischen Handeln stark sein kann, auch wenn die Mehrheit eine Orientierung an ethischen und unparteiischen Prinzipien bevorzugt. Neue Konflikte bestehen zwischen der eigenen Moral und dem Egoismus. In meinem gewählten Beispiel könnte ein Mensch bei Regen unter der vollen Bushaltestelle das Verlangen haben, eine Zigarette zu rauchen, obwohl er weiß, dass er seinen Mitmenschen damit schadet. Hier gibt Singer meinem Raucher ein Werkzeug an die Hand: den Verstand. „In social creatures who reason, this ambivalence [zwischen Egoismus und Altruismus] can take the form of a conflict between our self-centered desires and our desire to act in accordance with the stadards of public justification that we invoke as a member of a group.”10
Ein wichtiger Punkt, der in dieser Arbeit bisher außer Acht gelassen wurde, nun aber die Aussage unterstreichen kann. Was als ethisches und richtiges oder altruistisches Verhalten angesehen wird, bestimmt die Gruppe, in der sich das handelnde Individuum befindet. Versetzt man meinen Raucher an eine Bushaltestelle in die 1920er Jahre, in denen die Anzahl der Raucher in der Gesellschaft und die Akzeptanz für das Rauchen bedeutend höher war, wäre es zwar altruistisch von diesem auf das Rauchen in dieser Situation zu verzichten, allerdings würde die Gesellschaft es nicht als ethisch wertvoll ansehen. Mit Hilfe des Verstands, ist der Mensch laut Singer aber in der Lage, dieses Verhalten ausfindig zu machen und zu verfolgen. „Whether particular people with the capacity to take an objective point of view actually do take this objective viewpoint into account when they act will depend on the strength of their desire to avoid inconsistency between the way they reason publicly and the way they act.”11 Damit ist bei Singer der Verstand eben nicht wie bei Hume der Sklave des Verlangens. Sondern das Verlangen, den Verstand als Werkzeug für die Lösung eines Konflikts zu gebrauchen, steht im Vordergrund. „Reason is not powerless. [It] leads us to develop and expand our moral concerns, drawing us on toward an objective point of view. […] The shape of human ethical systems is an outcome of the attempt of human societies to cope with this tension between collective reasoning and the biologically based desires of individual human beings.”12 Somit beendet Singer dieses Kapitel mit einer optimistischeren Lösung für dissonante Handlungsabsichten, als sich nur dem Egoismus unterzuordnen.
Regeln und practice what you preach
Während der vorherige Absatz und Hauptteil der Arbeit Lösungen für kognitiv dissonantes Verhalten und Absichten aufgezeigt hat, soll an dieser Stelle kurz auf Regeln und ihre Ausnahme eingegangen werden.
Da der Mensch eben nicht immer rational seine Entscheidungen fällt und ein Hang zum egoistischen Handeln hat, bilden Regeln die allgemeine Grundlage für menschliche Interaktion. Wüsste man zum Beispiel nicht, dass Verkäufer dazu verpflichtet sind, einem keine Lügen über ein Produkt zu erzählen, oder dass Bänker, Anwälte und Ärzte an gewisse Regeln gebunden sind und uns die Wahrheit sagen, könnte kein Vertrauen und Ordnung in der Gesellschaft herrschen. Werden diese Regeln dann zu Gesetzen, die für jeden Bürger gleichermaßen gelten, fühlt man sich sicher und beruhigt. Gewissermaßen nehmen einen dadurch Regeln die moralische Entscheidung ab oder erleichtern sie zumindest. „Rules encouraging reciprocity and discouraging cheating build on a natural human tendency to reciprocate good or evil done to us: they serve to increase the benefits we can all obtain through helping others and receiving their help in turn.”13
Wie die Geschichte aber gelehrt hat, können Regeln und Gesetze nicht blind, ohne eigene Moral oder Verstand gebraucht werden. So gibt es für diese auch Ausnahmen, die wiederum zu neuen Spannungen und Konflikten führen. So kann es auch ein, zwar wenig überzeugender, Ausweg aus der Kognitiven Dissonanz der mentale Vorbehalt (mental reservation) sein. Als Beispiel hierfür nennt Singer einen Fall aus Charles McFaddens 1967 erschienene Medical Ethics, indem einem Arzt geraten wird, einem fiebernden Patienten bei der Frage nach seiner Temperatur zu antworten, dass diese normal sei, selbst macht sich der Arzt, den mentalen Vorbehalt, dass dies der Wahrheit bei einem stark Kranken entspricht. Singer selbst bezeichnet dieses Vorgehen als „dishonest nonsense“14. Meiner Meinung nach, eine adäquate Beschreibung; auch wenn in diesem Fall im exakten Wortsinn nicht gelogen wurde, handelt es sich weder um sinnvolles, noch ethisch rechtfertigbares Verhalten. Singer führt aus und beschreibt Regeln als „social creations, normally useful and normally to be obeyed but always ultimately subject of critical scrutiny from the standpoint of impartial concern for all”15.
So kann es auch sinnvoll und richtig sein, etwas andere öffentlich zu vertreten, als man selbst verfolgt. Singer gibt hier das Beispiel des unfair(?) bewertenden Professors, der jemanden aufgrund einer schlechten Leistung nicht durchfallen lässt und der somit motiviert und befähigt ist, weiterhin seinen Studiengang zu verfolgen. Dieses Vorgehen kann laut Singer richtig sein. Falsch sei es allerdings, dies öffentlich zu machen. Den Studenten würde es dann nicht motivieren, andere würde versuchen das Vorgehen auszunutzen und die Universitätsleitung würde dies auch nicht begrüßen. Singer spricht in diesem Fall von einem Paradoxon, da die Handlung selbst eine richtige ist und erst durch das Veröffentlichen dieser richtigen Handlung eine falsche aus ihr wird, er zitiert den britischen Philosophen Henry Sidgwick mit den Worten „the opinion that secrecy may render an action right which would not otherwise be so, should itself be kept comparativly secret“16.
Aber bedeutet das nicht, dass die alte Regel practice what you preach, zumindest im Umkehrschluss preach what you practice ihre Gültigkeit verliert? Bin ich dann vielleicht auch moralisch verpflichtet, ein von mir begangenes Verbrechen nicht zu melden, wenn ich als Person des öffentlichen Lebens oder als ehrenamtlicher Mitarbeiter Menschen helfe und das Bekanntwerden des Verbrechens oder meine Inhaftierung mir diese Möglichkeit nehmen würde? Auf freiem Fuß könnte ich weiterhin Gutes tun und die Leben anderer Menschen verbessern, andererseits bleibt so die Gerechtigkeit aus. Es stellt sich die Frage, bei welchen Regeln nun die Grenze gezogen werden soll und ob die Öffentlichkeit nicht doch ein Recht hat, von Regel- und Gesetzesbrüchen zu erfahren, letztendlich müsste diese den höheren Zweck auch anerkennen und gutheißen, damit der Regelbruch moralisch vertretbar ist.
Konklusion
Singer verdeutlicht in seiner Betrachtung der Kognitiven Dissonanz die Komplexität von moralischen Konflikten und liefert auch durchdachte Lösungsansätze, um diesen inneren Konflikten zu begegnen. Problematisch erscheint mir hierbei aber die Möglichkeit der unendlichen Schichtung von Interesse und Interessensebenen. Hat man die Absicht, kann man jede moralisch bewertbare Handlung und jeden Konflikt in einer Zwiebel verpacken und Schicht für Schicht ins moralisch unbedenkliche rücken. Zwar verstehe ich seinen Stadtpunkt, keine endgültige Lösung für moralische Konflikte zu benennen und sehe in seinen beiden Werkzeugen: Regeln und Ratio, einen nicht von der Hand zu weisende Möglichkeit zur Konfliktlösung, doch zeigt gerade das Ende der Betrachtung auf, dass diese Werkzeuge oft zu ungenau sind und auch mit Singers Methoden der Soziobiologie der Konflikt nicht zufriedenstellend gelöst werden kann.
Vielleicht ist dies aber auch der philosophisch genau richtige Schluss aus diesem stark soziobiologisch geprägten Werk, dass es trotz der Unterstützung anderer moderner Wissenschaften keine endgültige Antwort auf ethische Probleme und Fragen gibt und eben diese Wissenschaften auch nur Aufschluss über weitere Werkzeuge liefern können. Mit seinen abschließenden Worten „When we know more, we will truly be able to claim that we are no longer the slaves of our genes”17, würde ich in diesem Kontext nicht mitgehen. Mag es der gekränkte Philosoph in mir sein, vertrete ich trotzdem den Standpunkt, dass Jahrhunderte alte Fragen wie moralische Konflikte auch in Zukunft nicht durch modernere Wissenschaft gelöst werden können. Auch wenn wir unsere Gene verstehen können, bleibt für mich eine Befreiung von dem, was sie verursachen fraglich.
Literaturverzeichnis:
Primärliteratur:
Singer, Peter (2011): The Expanding Circle: Ethics, Evolution, and Moral Progress. Revised edition. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
[...]
1 Zur besseren Übersicht werden Kapitel und Unterkapitel aus Singers Werk in dieser Arbeit kursiv gesetzt. Zitate werden der allgemeinen Zitation nach in Anführungszeichen gesetzt und im englischen Original behalten. Bei Übersetzungen für die Untersuchung im eigenen Text wird bei Zweideutigkeiten mit der naheliegendsten und wohlwollendsten Übersetzung des Originals ins Deutsche gearbeitet.
2 Seite 140.
3 In diesem Beispiel geht es um die gesundheitsschädliche Wirkung des Rauchens und ein nicht Sucht gesteuertes Interesse am Konsum. Das Beispiel eines Nikotinabhängigen wäre für die Kognitive Dissonanz unpassend; ein Genuss- oder Gelegenheitsraucher ist aber passend.
4 Seite 143.
5 Seite 144.
6 Seite 144f.
7 Seite 145.
8 Seite 145f.
9 Seite 146.
10 Seite 146.
11 Seite 143ff.
12 Seite 147.
13 Seite 159
14 Seite 165.
15 Seite 165.
16 Seite 166.
17 Seite 173.
- Quote paper
- Josua Heitkamp (Author), 2024, Eine kritische Untersuchung der Rolle der Kognitiven Dissonanz in Peter Singers "The Expanding Circle", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1558827