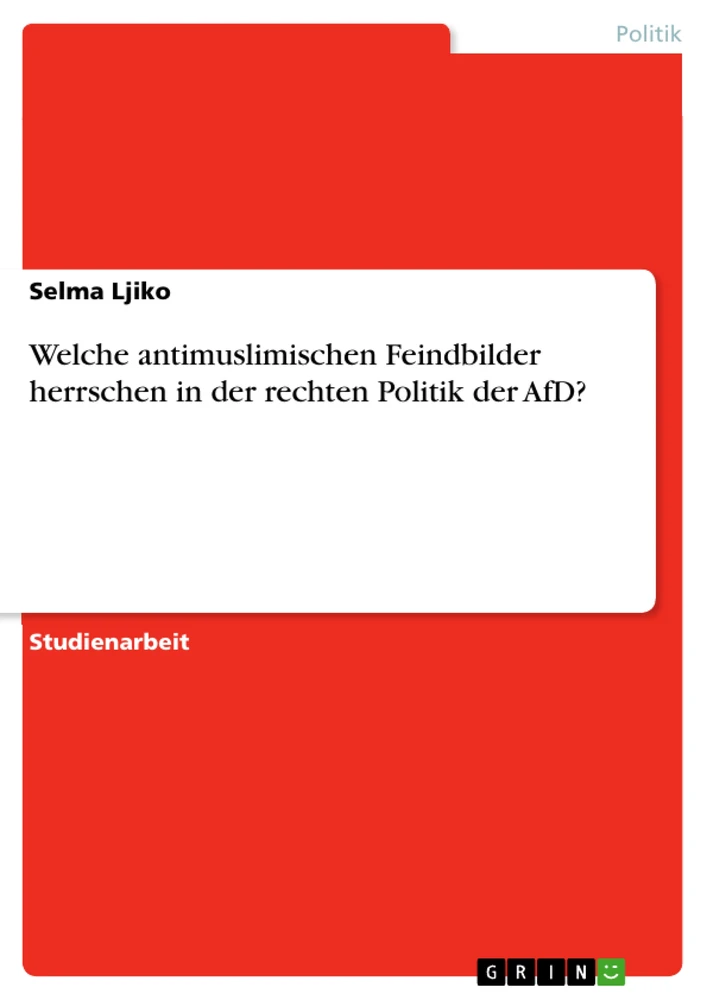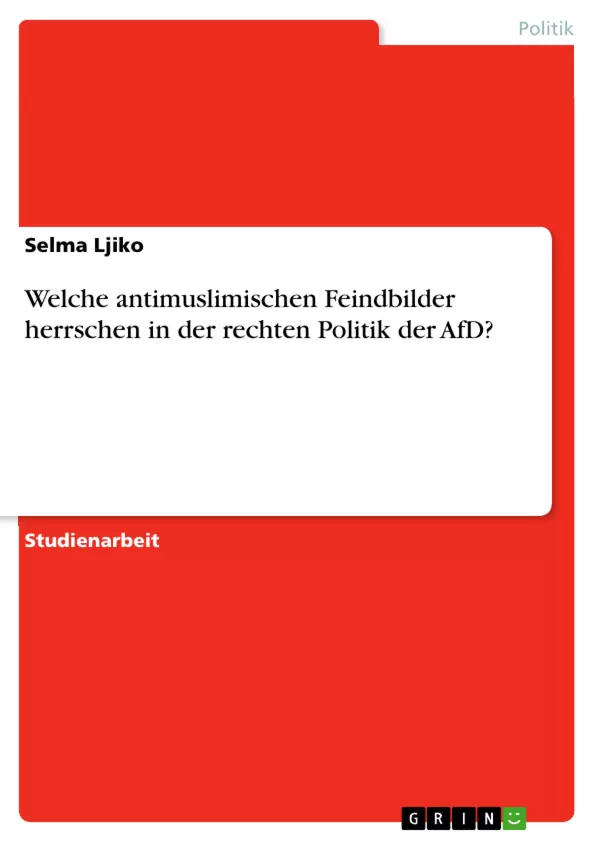Die vorliegende Seminararbeit untersucht die spezifischen Feindbilder, die innerhalb der rechtspopulistischen Politik der AfD gegenüber Muslim*innen und dem Islam verbreitet werden. In einem umfassenden theoretischen Rahmen werden die Phänomene des Rechtsextremismus und Rechtspopulismus erläutert und deren Relevanz für die politische Verortung der AfD beleuchtet.
Ein zentraler Fokus der Arbeit liegt auf der Analyse von islamischen Feindbildern und der Untersuchung des antimuslimischen Rassismus, wie er sich in den Wahlplakaten und der Öffentlichkeitsarbeit der AfD manifestiert. Durch die Anwendung der Methodik der Dokumentenanalyse und der dekolonialen Auswertungsmethode des Border Thinkings wird aufgezeigt, wie die AfD mithilfe von Stereotypen und Diskriminierungen eine bestimmte Sichtweise auf den Islam und dessen Anhänger*innen konstruieren kann.
Die Arbeit schließt mit einer kritischen Reflexion über die Auswirkungen dieser Diskurse auf die gesellschaftliche Wahrnehmung von Muslim*innen in Deutschland und den daraus resultierenden Herausforderungen für die Religions- und Glaubensfreiheit. Ziel ist es, einen Beitrag zur Diskussion über die politischen Entwicklungen der AfD zu leisten und die Notwendigkeit für politische und aktivistische Maßnahmen zur Bekämpfung solcher Feindbilder zu betonen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theoretische Ansätze
2.1. Rechtsextremismus und Rechtspopulismus
2.2. Politische Verortung der AfD
2.3. (Islamische) Feindbilder
2.4. AfD, Islamfeindlichkeit und Antimuslimischer Rassismus
3. Methodologie
4. Plakatanalyse
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis
7. Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
Antimuslimische Ressentiments finden heutzutage nicht nur in der Bevölkerung Deutschlands Fuß, sondern werden auch in der politischen Szene bis hin zu staatlichen Organisationen in ausgeprägter Form vertreten. Ein aktuelles Beispiel dafür wäre das Innenministerium Bayerns. Im Rahmen einer Kampagne veröffentlichte dieses im September 2024, ein welches einerseits warnen, andererseits abschrecken soll. Um auf die hier entstandene Problematik aufmerksam zu machen, wird knapp der Inhalt skizziert: Zu Beginn ist eine junge Frau zu sehen. Auf ihrem Smartphone sieht sie sich ein Video von einem islamischen Prediger mit Vollbart und Gebetskappe an. Hierbei erscheint die Frage „Dürfen sich Musliminnen schminken?“ auf dem Bildschirm. Im nächsten Abschnitt spielt düstere Musik, das Gesicht des Predigers läuft rot an, er verzieht seine Mimik und lacht boshaft. Die Frau wird nun in den großen Mund und Rachen des Mannes verschlungen. Kurz darauf trägt die eben gezeigte Frau ein Kopftuch, verschleiert ihr Antlitz und heiratet einen älteren muslimischen Mann. In der letzten Szene ist die junge Frau mit Tränen in den Augen in einer Küche neben weiteren verschleierten Frauen. Der Schriftzug "Die Salafismus-Falle" erscheint, begleitet von der Warnung: "Es geht schneller, als du denkst."
Bereits nach kurzer Zeit erhielt das Bayerische Innenministerium mehrfach Kritik bezüglich des veröffentlichten Videos, welches aktuell nicht mehr vorhanden ist. Die Kommentare kamen nicht nur aus der muslimischen Community in Deutschland, beziehungsweise aus dem Ausland, sondern auch von mehreren Bürgerinnen und Bürgern, die sich nicht mit der Religion des Islams identifizieren. Auch von Seiten der Politik wurden Beschwerden geäußert. Das Video würde islamfeindliche und rassistische Stereotype darstellen als auch Volksverhetzung betreiben. Menschen muslimischen Glaubens würden als barbarisch, aggressiv und frauenfeindlich dargestellt. Problematisch daran ist, dass das Video rassistische und antimuslimische Züge aufweist, obwohl Deutschland als Demokratie das Recht auf Religionsfreiheit vertritt. Im deutschsprachigen Raum erhält die Religion und ihre Anhänger immer mehr Relevanz, da die Bürgerinnen und Bürger des Öfteren damit konfrontiert werden. Die Sichtbarkeit des Islams steigt stetig in der Öffentlichkeit und ist nicht mehr mit dem homogenen, traditionellen Islam der ehemaligen Gastarbeiter aus der Türkei zu vergleichen. Der Glaube zeigt in Deutschland immer mehr Facetten, da die Musliminnen und Muslime ursprünglich aus unterschiedlichsten Ländern kommen und dadurch die verschiedenen Abzweigungen und Strömungen des Islams hierzulande vertreten. Auch die Zahl der konvertierten Bürgerinnen und Bürger ist nicht zu übersehen, was ebenfalls für die Heterogenität der Minderheit in Deutschland spricht. Stereotypisierende und undifferenzierte Darstellungen der Musliminnen und Muslime, wie in dem Video des bayerischen Innenministeriums, fördern negative Einstellungen zum Islam bei den Rezipienten solcher Videos und Bilder. Obwohl die Zahl der Muslime und Musliminnen hierzulande nicht mehr wegzudenken ist, wird in den Medien oder der Politik ein islam- oder muslimfeindliches Bild repräsentiert. Durch die Informationsdefizite über den Islam bei vielen Bürgerinnen und Bürger werden Halbwahrheiten als Tatsachen anerkannt. Das Vertrauen liegt weiterhin in der Berichterstattung der Politik und Meiden, wodurch eine eigene Recherche nach sachlich fundierten Fakten über den Islam nicht mehr als notwendig erscheint. Vor allem die Partei Alternative für Deutschland vertritt und äußert antimuslimische und islamfeindliche Ansichten, sei es an Parteitagen, in Wahlprogrammen, an Vorträgen oder auf Wahlplakaten. Gezielt werden Musliminnen und Muslime, als auch der Islam als ‚fremd‘ dargestellt und als seien sie in Deutschland nicht zugehörig. Die Ausgrenzungen im Alltag von Musliminnen und Muslimen, vor allem in der Gesellschaft und der Politik, kommen immer häufiger vor, weshalb diese zu untersuchen sind. Um antimuslimischen Ressentiments entgegenzuwirken, ist die Aufgabe der Wissenschaft, aber auch der Öffentlichkeit und von einzelnen Bürgerinnen und Bürgern aufmerksam auf die Problematik zu machen. Diskriminierungen und Ausgrenzungen jeder Art sind mit den Werten und Gesetzen des Grundgesetzes nicht zu vereinbaren. Somit müssen islamfeindliche und antimuslimische Positionen in der Gesellschaft benannt, analysiert und behandelt werden.
Die vorliegende Arbeit soll darlegen, wieso der Anstieg der Partei Alternative für Deutschland (AfD) eine Gefahr für die Bevölkerung in Deutschland darstellt. Insofern stellt sich die Frage, welche antimuslimischen und islamfeindlichen Ressentiments in der extrem rechten Politik der AfD herrschen. Zuerst werden theoretisch die elementaren Begriffe und Phänomene, wie Rechtspopulismus oder Antimuslimischer Rassismus beleuchtet, die zur Untersuchung der Thematik relevant sind. Im nächsten Teil der Arbeit wird aufgezeigt, welches Material zur qualitativen Analyse aufbereitet wurde und dass in diesem Zusammenhang die empirische Auswertungsmethode des Border Thinking eine gute Wahl wäre. Den größten Abschnitt dieser wissenschaftlichen Arbeit übernimmt die empirische Analyse des Materials welches zum Schluss mit einem Fazit abgerundet wird.
2. Theoretische Ansätze
2.1. Rechtsextremismus und Rechtspopulismus
Rechtsextremismus steht für eine bestimmte Erscheinungsform, die von der Glorifizierung ethnischer Zugehörigkeit und der Ideologie der Ungleichwertigkeit geprägt ist. Des Weiteren kommen der politische Autoritarismus und die gesellschaftliche Identität, welche dabei inhaltlich in einer rechten Form artikuliert werden (Pfahl-Traughber, 2019, S. 3). Eine grundsätzliche Abweichung von einer „politischen Mitte“ ist bedingt durch den Pluralismus völlig legitim. Daher geht es darum, dass die erwähnten Grundprinzipien einer modernen Demokratie und offenen Gesellschaft negiert werden (ebd.). Rechtsextremismus beginnt nicht erst bei der direkten Systemverneinung. Schon das Absprechen von Grundrechten für Individuen oder die Relativierung der totalitären NS-Diktatur laufen auf eine solche politische Positionierung hinaus (Pfahl-Traughber, 2019, S. 4). Und auch eine gewaltlose und legalistische Ausrichtung einer politischen Bestrebung steht nicht notwendigerweise für eine demokratische Orientierung, halten sich doch die meisten Extremisten formal an Recht und Gesetz und warten eher auf einen günstigen politischen Moment zu einer gewaltbereiten Umorientierung (ebd.). Und dann gilt noch, dass der Nationalsozialismus nur eine Ideologie-familie des Rechtsextremismus ist. Auch unter Berufung auf den Deutschnationalismus oder die konservative Revolution können die Grundlagen moderner Demokratie und offener Gesellschaft ablehnen.
Grundsätzliche Züge von ideologischen Ausprägungen und einer rechten Orientierung lassen sich hier festlegen. Es herrscht eine „Wir gegen die da draußen"- Mentalität. Den „Eingeborenen" eines Staates werden mehr politische und soziale Rechte zugeschrieben als jenen, die es nicht sind (Lewandowsky et al., 2016, S. 251). Rechtspopulismus zeichnet sich vor allem „durch die Postulierung eines diffusen Bedrohungsszenarios aus, das den Verlust politischer Souveränität mit der Erosion der eigenen Identität durch kulturell „Fremde“ parallelisiert“ (ebd.). Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind in rechtspopulistischen Parteien immanent. Unterschiedlich ist jeweils die Ungleichheit aus einer kulturellen, vor allem religiösen Komponente oder eher Ethnischen. Im westeuropäischen Raum bilden sich vor allem Ängste vor dem angeblich demokratiefeindlichen Islam, der aus überwiegend orientalischen Gebieten in die homogene Werteordnung der westlichen Demokratien eingreife. Rechtspopulistische Parteien setzen sich gerade deshalb ständig für einen umfassenden Zuwanderungsstopp ein und/oder bestehen auf Assimilierung als Verbesserungsoption zur als gescheitert empfundenen multikulturellen Gesellschaft (ebd. S. 252).
2.2. Politische Verortung der AfD
Die erwähnten Positionen beschreiben die hier fokussierte Partei vollends. Die Alternative für Deutschland ist die erfolgreichste Partei im Hinblick auf schnelle und nachhaltige Beeinflussung der öffentlichen Debatten und Wahlerfolge, obwohl es über Jahrzehnte hinweg für unwahrscheinlich gehalten wurde, dass sich eine rechtspopulistische Partei dauerhaft im deutschen Parteiensystem verankern könne. Die AfD wurde 2013 gegründet. Diesem Schritt gingen insbesondere die Aktivitäten des Ökonomieprofessors Bernd Lucke voraus, der die von der Bundesregierung mitgetragene EU-Finanz- und Rettungspolitik gegenüber Griechenland vehement kritisiert hatte (Pfahl-Traughber, 2019, S. 4 – 5). Neben ihr existieren auch die Sozialistische Reichspartei Deutschlands (SRP), die Nationaldemokratisch Partei Deutschlands (NPD), die Republikaner (REP) oder die Deutsche Volksnation (DVU), die zwar auch von konservativen Positionen profilieren, aber anders als der AfD ist diesen Parteien nie der Einzug in den Bundestag gelungen (Cremer, 2024, S. 35). Letztere hat die europakritische Position im deutschen Parteisystem geboten, die bislang wohl fehlte. Denn einen Effekt, den sie erzielte, ist vermutlich, dass die längst gespaltene deutsche Gesellschaft gezwungen wurde, sich intensiver mit sich selbst und politischen Versprechungen zu befassen. Es schien ganz so, als würde die Partei Reputationslücken schließen und politische Alternativen anbieten, denn sie bereicherte sich an der Ungeduld und dem Zorn in weiten Teilen der Gesellschaft. Bei den Bundestagswahlen 2017 und bei den Europawahlen 2019 erreichte die sächsische AfD übrigens das stärkste Ergebnis aller Parteien. Ihre Politikfelder sind geprägt durch eine völkisch-nationalistische Ideologie, denn sie lehnt das gesellschaftliche Gleichheitsprinzip ab und spricht in ihren Programmen einer ethnozentrisch-autoritären Weltsicht das Wort (Mustafa, 2022, S.28). In ihrem Wahlprogramm ist ganz klar die deutsche Sprache als Zentrum der Identität verordnet und durch die Forderung einer übergreifenden deutschen Leitkultur statt Multikulturalismus, wird ihre monokulturelle Ordnung aufrechterhalten (Alternative für Deutschland, 2016). Doch insbesondere die Agitation gegen Muslim:innen und den Islam in Verbindung mit einer starken Betonung deutschnationaler Identität sprechen dafür, die AfD als rechtsextremistische Partei einzustufen, „zumal die Übergänge zwischen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus fließend sind“ (Mustafa, 2022, S. 38). Antimuslimische Narrative ziehen sich wie ein roter Faden durch Programme der AfD, häufig widmet sie der Ablehnung des Islams eigene Kapitel in ihren Programmen. Mit der Radikalisierung der AfD über die Jahre hat auch der Verfassungsschutz im Januar 2019 die gesamte Partei zum „Prüffall“ (Schroeder & Weßels, 2020, S. 99) erklärt und einzelne Organe wie die Bundesjugendorganisation „Junge Alternative“ und dem rechts Stehenden „Flügel“, zum „Verdachtsfall“ angeordnet. Im März 2021 bestätigt das Verwaltungsgericht Köln zusätzlich die Einstufung der Partei als Beobachtungsobjekt und als rechtsextremistischen Verdachtsfall. Und nachdem die AfD 2022 Berufung beim Oberverwaltungsgericht des Landes Nordrhein-Westfalen gegen dieses Urteil eingelegt hat, bestätigte das Bundes-verwaltungsgericht dieses Jahr, dass eine Revision nicht zugelassen wird (Cremer, 2024, S. 14). Die Beschwerde der Partei blieb erfolglos.
2.3. (Islamische) Feindbilder
Insbesondere zeigt die Partei ihre Skepsis zum Islam, als auch Musliminnen und Muslimen durch antiislamische Feindbilder auf (Çakir, 2019, S. 77), doch was versteht man darunter? Im Sinne des Psychologen Gert Sommer sind Feindbilder soziale Interpretationen für gesellschaftliche oder politische Geschehnisse. Es kann sich dabei um Bilder handeln, die sich im Sinne von negativen Vorurteilen gegen bestimmte Völker, Ideologien oder Gruppen richten. Feindbilder können auch aus realen Fakten entspringen, dennoch sind an dieser Stelle die negativen Bewertungen verstärkt, so wie die unterschiedlichen Ausprägungen des Feindbilds (Sommer, 2022, S. 4). Der Feind wird negativ bewertet, als böse und minderwertig verstanden. Durch die Schuldzuschreibung bei Krisen oder negativen Ereignissen in der Gesellschaft, ist der Feind der Sündenbock und seine negativen Eigenschaften werden ständig hervorgehoben. Die Selbstreflexion über das eigene Handeln denjenigen, die ein Feindbild projizieren, ist oft eingeschränkt, da ihr Fokus sich immer nur auf den Feind richtet. Besonders das Gefühl der Bedrohung kann dazu führen, dass dem Gegner sogar die Menschlichkeit abgeschrieben wird (ebd., S. 6 – 15). Zu den Funktionen von Feindbildern gehören folgende individuelle und gesellschaftliche Aspekte: Die Gruppenbildung gegen den angeblichen Feind erzeugt ein verstärktes Wir-Gefühl, Zugehörigkeit und Identität. Die Herkunft der eigenen politischen oder kulturellen Ängste wird mit der Existenz des Feindes begründet. Auch gesellschaftlich werden komplexe innerstaatliche oder internationale Konflikte reduziert, und von ihnen abgelenkt. Die Bedrohung geht vom Feind aus, wodurch es zu einer Ignoranz der Vielschichtigkeit der staatlichen und gesellschaftlichen Probleme führt. Insbesondere durch die Verbreitung von Fehlinformationen über den Feind kann es zur Manipulation der Öffentlichkeit und der Bevölkerung kommen (ebd. S. 16).
Die Ursprünge des islamischen Feindbilds sind vielschichtig. Zuerst wurde der Islam als Religion der friedlichen Wüstenbewohner, der Beduinen, auf der Arabischen Halbinsel betrachtet. Im europäischen Mittelalter verzerrte sich dennoch das Bild des islamisch-geprägten Morgenlandes und des eigenen christlichen Abendlandes in Mitteleuropa. Durch die Expansion des Islams bis hin zum Süden Spaniens sah sich das christliche Volk als bedroht. Die Entstehung zu einer Weltreligion veranlasste das Spalten der gegensätzlichen Parteien und die Hervorhebung der religiösen Unterschiede (Oeser, 2016, S. 52 – 57, S. 87). Das Islambild des ‚muslimischen Anderen‘ als Tyrannen und aggressiven Barbaren, die einer ketzerischen Religion angehören, fand somit schon im 12. und 13. Jahrhundert Fuß. Während der Kreuzzüge wurden Musliminnen und Muslime nicht nur als religiöse Feinde abgewertet, sondern auch als Fremde ethnisiert, etwa als Türken, Araber oder Sarazenen. Mit der Rückeroberung der Iberischen Halbinsel von den Christen, war Europa nun ein christlicher, weißer Kontinent, der sich als ‚rassisch rein‘ identifiziert, anderen Bevölkerungsgruppen überlegen sei und sich vom muslimischen ‚Anderen‘ abgrenzt (Hafez, 2019, S. 27, S. 31). Heute spielen solche historischen Stereotype in das Islambild mit ein, welche durch die negative Medien- und Berichterstattung über die Religion verstärkt werden. Ebenso betrachten viele Europäer dadurch den Islam als bedrohliche, politische Ideologie, zumal er mit negativen Eigenschaften wie Terrorismus, Kriminalität, Unterdrückung von Frauen, oder ein niedriges Bildungsniveau öffentlich in den Kontext gebracht wird (Winkler, 2018, S. 161 – 162; Röther, 2019, S. 28).
2.4. AfD, Islamfeindlichkeit und Antimuslimischer Rassismus
Viele dieser Aspekte des Islambildes greift die Partei AfD in ihrer politischen Denkweise und Position auf. Die konstante Zunahme der Musliminnen und Muslime in Deutschland und der damit einhergehende Multikulturalismus in den letzten Jahren stellt für zahlreiche Anhänger der AfD ein Problem dar. Bereits im Jahre 2016 positionierte sich die Partei islampolitisch, indem sie die Praktiken der Religion einschränken möchten. Dazu gehören Verbote wie von Kopftüchern oder Gebetsrufe, und das Abschaffen von Lehrstühlen der islamischen Theologie in Deutschland. Sie begründen ihre Politik mit dem Argument, dass der Islam nicht mit dem Grundgesetz zu vereinbaren ist, und dementsprechend nicht zu Deutschland passt, sodass die angebliche Islamisierung der Bundesrepublik eine große Gefahr ist (Röther, 2019, S. 121; Çakir, 2019, S.88). Die Abgrenzung der Partei von der als negativ angesehen Gruppe, den Musliminnen und Muslimen, erzeugt ein identitätsstiftendes Moment: Die AfD sehnt sich nach einer ursprünglichen Umgebung ohne den Einfluss von ‚Fremden‘, da dies mit Ängsten vor dem Unbekannten verbunden ist. Darüber hinaus geht diese Einstellung Hand in Hand mit einem Überlegenheitsgefühl gegenüber den Betroffenen, welches sich aus westlichem, kolonialem Denken entwickelte (Schuppener et al., 2021, S. 224; Freise, 2017, S.160). Zudem werden die Fremden, für alle weitere Probleme in Deutschland, wie die sozialen Ungleichheiten oder das Versagen des Staates, in der Politik der AfD als Projektionsfläche und Sündenbock genommen (Schaeffer, 2018, S. 119). Dies zeigt, dass der Islam, als auch Musliminnen und Muslime als Feindbild der AfD benannt werden.
Um diese Art der Feindlichkeit und Ressentiments zu der Gruppe zu definieren, können die Begriffe Islamfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus erwähnt werden (Mustafa, 2023, S. 23 – 24). Beide Formulierungen beschreiben die Menschenfeindlichkeit, welche die Gruppe der Musliminnen und Muslime erfahren. Die Islamfeindlichkeit bezieht sich dennoch eher auf die Erniedrigung des Islams als Religion. (Uçar & Walker, 2019, S. 10). Hier wird die Lebensweise der Religionsgemeinschaft angezweifelt, was in extremer Form gefährlich werden kann, da diese Einstellung Hass und Gewalt katalysieren. Diese Auffassung spricht gegen die „grundlegenden Prinzipien der demokratischen Gesellschaft“ (Spielhaus, 2021, S. 85). Da aber nicht nur Musliminnen und Muslime Opfer von diesen Ressentiments sind, wird in der Forschung der Begriff ‚antimuslimischer Rassismus‘ präferiert. Hier muss erwähnt werden, dass heute nur selten die Formulierung ‚Rassismus‘ sich auf biologischen und vererbbaren Merkmalen bezieht, sondern auf die „kulturelle bzw. religiöse Prägung als Quasirasse“ (Spielhaus, 2021, S. 87). Menschen werden hier aufgrund ihrer angeblichen Herkunft aus muslimischen Regionen oder Ländern ethnisiert. Der Islam und ihre Anhänger werden als eine ethnische Gruppe homogenisiert, als auch auf wenige Wesensmerkmale reduziert und das ohne die Berücksichtigung derer Individualität und Heterogenität. Dabei ist es belanglos, ob das jeweilige Individuum tatsächlich ein Muslim ist. Somit liegt Antimuslimsicher Rassismus vor, sobald dem fremdbestimmten Muslim negative Eigen-schaften zugeschrieben werden und er aufgrund dessen physische oder verbale Gewalt erfährt und als „anders“ oder geringwertig kategorisiert wird (Spielhaus, 2021, S. 94; Cheema, 2021, S. 37 – 38). Das Argument der Unvereinbarkeit der fremden ‚muslimischen‘ Kultur mit der eigenen ‚deutschen Leitkultur‘ soll diese Abwehr und Ablehnung gegen Muslimminen und Muslimen rechtfertigen (Çakir, 2019, S. 82 – 85). Um diese diskriminierenden Phänomene zu analysieren, soll im Folgenden eine dekoloniale Perspektive eingenommen werden.
3. Methodologie
Auch in den letzten Monaten erhielt die Partei AfD immer mehr Zulauf von Bürgerinnen und Bürgern aus den unterschiedlichsten Gruppen in Deutschland. Die Wählerstimmen steigen auf Länder-, als auch auf Bundesebene, wodurch die Partei einen immer größeren Einfluss auf unsere Demokratie und Politik hat. Als Folgereaktion verbreitet sich der antimuslimische Rassismus kontinuierlich in Deutschland, was für die hier lebenden Musliminnen und Muslime beunruhigend ist. Auch für uns Forscherinnen dieser Arbeit erregt die potenzielle, politische Zukunft Deutschlands Besorgnis, da wir als muslimische, kopftuchtragenden Frauen mit Migrationshintergrund ein Störfaktor für die AfD und ihre Unterstützerinnen und Unterstützer bilden. Mithilfe des Internets, wie den Sozialen Medien und von zahlreichen Wahlplakaten vermehrt sich die Präsenz der AfD in der Öffentlichkeit. Um repräsentativ die AfD in Bezug auf das Thema Islam und Musliminnen und Muslime abzubilden, wählten wir aus einem Pool von zahlreichen Wahlplakaten ein prägnantes aus. Hierbei recherchierten wir im Internet, als auch in verschiedenen Literaturen, wie beispielsweise von Schuppener, und verglichen die Affiche der Wahlkämpfe aus den mehreren Jahren, in denen die Partei nun schon tätig ist. Im Endergebnis entschieden wir uns für ein Wahlplakat zu den Bayerischen Landtagswahlen aus dem Jahre 2018. Auch wenn dieses nicht da aktuellste ist, stellt es ebenfalls die heutige Einstellung der Partei noch dar, zumal der Fokus auf dem Islam und Muslime steht. Ebenso entschieden wir uns für das Dokument „Wahlplakat“, da diese auf den öffentlichen Straßen ein auffälliges Merkmal sind, indem die Partei AfD besonders kurz, klar und präzise ihre politischen Botschaften an die breite Masse bringen kann (Schuppener et al., 2021, S. 81). Des Weiteren bezieht sich das ausgewählte Plakat auf das Thema Schule und Bildung, was uns als Studentinnen des Fachs Pädagogik ebenfalls zur Forschung dazu motivierte. Uns ist bereits bewusst, dass Schule und Bildung starke Instrument sind, welche auch falsch verwendet werden, so wie es die Geschichte Deutschlands zeigt. Junge Schülerinnen und Schüler oder Bürgerinnen und Bürger können schnell beeinflusst werden, wie beispielsweise mit dem ausgewählten Plakat. Auf den ersten Blick scheint es harmlos, doch bei genauerer Analyse können diskriminierende Strukturen aufgewiesen werden. Welche antimuslimischen Feindbilder der AfD durch das Wahlplakat herauszufiltern sind, werden daher analysiert.
Im Sinne der qualitativen Sozialforschung wird in unserem Fall die Methode der Doku-mentenanalyse durchgeführt. Die zu untersuchenden Materialien können bei dieser Methode Schriften, Bilder, aber auch Plakate sein. Insbesondere sind solche Dokumente ein Produkt von Akteuren der Gesellschaft, die über ein Thema informieren und über dieses kommu-nizieren möchten. Die in diesem Prozess entstandenen Materialien gelten als Repräsentation der sozialen Realität (Universität Leipzig, o.D.). Auch die AfD bildet mithilfe ihrer Wahlplakate ihre aktuelle, subjektive Wirklichkeit ab. Aus diesem Grund wäre das bereits vorhandene Material für eine ausführliche Dokumentenanalyse geeignet. Dazu behelfen wir uns der dekolonialen Auswertungsmethode des Border Thinkings, die der argentinischen Wissen-schaftler Walter D. Mignolo ausbaute. Um den Ausgangspunkt der Methode besser zu verstehen, wird der theoretische Hintergrund dazu beleuchtet. Wie bereits vielen bewusst ist, wurden in der Vergangenheit der Weltgeschichte zahlreiche Völker und Länder insbesondere im Interesse Europas befallen und kolonialisiert. Im 16. Jahrhundert profitierten die ‚weißen, europäischen Völker‘ von der Ausbeutung des globalen Südens durch Sklaverei, Zwangs-arbeit und das Exploitieren von Ressourcen wie Gold und Silber (Tlostanova & Mignolo, 2009, S. 133). Heute sind Kolonien aufgelöst, doch von einer Ausgeglichenheit der Mächte ist nicht zu sprechen, da die damaligen hegemonialen Machtstrukturen noch Auswirkungen auf die aktuelle Realität haben. Kurz gesagt: Unter der Kolonialität meinen wir dementsprechend die fortbestehende Wirkung der damaligen Machtverhältnisse und Weltordnung, die sich im 16. Jahrhundert etablierten. Von dem Phänomen der Kolonialität sind nicht nur die politischen Spektren betroffen, sondern auch soziale Organisationen, Wissen, bis hin zu ganzen Systemen (Kastner & Waibel, 2012, S. 19). Diese postkolonialen Erscheinungen basieren auf ein eurozentristischen, westliches Wissen, welches als die Norm und universell galt, wohingegen Wissensproduktionen die nicht der hegemonialen Vorstellungen des Westens entsprachen, also von den Subalternen, sich nicht etablieren konnten (Mignolo, 2011, S. 13). Um aber der Kolonialität entgegenzuwirken und eine dekoloniale Perspektive einnehmen zu können, muss nach Mignolo erkannt werden, dass kein Wissen neutral und universell ist. Jeder Mensch, also jeder Körper und auch Gedanke ist in einem geopolitischen und historischen Raum eingebettet, der sich auf sein Leib, seine Seele und somit seine Wissensproduktion auswirkt. Deshalb ist bei jedem Wissen und übertragen auf die Forschung, jedes Dokument, beeinflusst durch das Subjekt, welches es generierte. Ebenso spielen die Fragen wo, wann und warum das Wissen oder Dokument entstand, eine ebenbürtige Rolle (Mignolo, 2009, S. 160). Mignolo fordert in diesem Sinne gegenüber dem bestehenden, hegemonialen Wissenssystemen einem Widerstand, den epistemischen Ungehorsam, wodurch Wahrheiten neu zu ordnen sind, und nicht mehr aus einer privilegierten, eurozentristischen Perspektive entstehen können, sondern auch von den sozusagen Unterlegenen (Kastner & Waibel, 2012, S. 25 – 29). Diese Subjekte werden als Subalterne definiert: Sie sind Menschengruppen, die einer herrschenden Hegemonie, und somit den politischen und sozioökonomischen Macht-verteilungen, unterworfen sind. Im Sinne der Kolonialität, kann hier von den Kolonialisierten gesprochen werden, oder eben von denjenigen Individuen, welchen der Zugang zur Wissensproduktion oder politischen Teilhabe verwehrt und erschwert wird. Auch die räumliche Entfernung vom Epizentrum der Macht und des Wissens, wie Europa und Amerika, intensiviert das Ungleichgewicht zwischen den Subalternen und den Hegemonialmächten (Cooperaxion, o.D.). Die Trennlinie, oder eher der Raum, an dem die Hierarchien und die koloniale Differenz durch die Erfahrungen und die Perspektive der Subalterne aufgedeckt werden, nennt man Grenze. Das Denken in diesen Grenzen stellt subalternes Wissen wieder her und lässt die Betroffenen ihr Empfinden und Wissen aus ihrer Geo- und Körperpolitik schildern (Mignolo, 2000, S.ix). Dementsprechend sind die kolonialen Subjekte aktive Teilnehmer und nicht mehr diejenigen, denen Macht und Aufmerksamkeit verwehrt wird. Ebenso kann durch das Grenzdenken die Vielfalt und Pluriversalität der Wissenssysteme und ihre Ursprünge aufgedeckt werden (Kastner & Waibel, 2012, S. 30). Ziel des Grenzdenkens ist es, dekoloniale Optionen, also Alternativen, zu entwickeln, die sich von der globalen Kolonialität des Wissens und der kolonialen Organisation der Gesellschaften loslösen (Mignolo, 2009, S.132). Das heißt nicht, dass nur das Wissen der Subalternen berücksichtigt wird, sondern dass eben nicht nur eine Weise möglich ist zu denken und Wissen zu produzieren (Mignolo, 2011, S. 24).
Übertragen auf die Methodologie betrachtet wir unser Material und das soziale Phänomen aus der Sicht des Subalternen, wodurch es zur Entschlüsselung der kolonialen Differenz kommt. Infolgedessen liegt der Fokus auf das Material selbst und unter welchen Umständen, also von wem, wann und wo, dieses zustande kam. Somit kann die geo- und körperpolitische Produktion des Wissens nachvollzogen werden. Abschließend werden dekoloniale Optionen und Alternativen als mögliche Lösungen vorgeschlagen. Ein Grund warum wir uns für die Methode des Grenzdenkens entscheiden haben, ist die Tatsache, dass wir beide in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, und somit zum Teil der Privilegierten im Sinne der dekolonialen Theorien gehören. Wir haben die letzten politischen Jahre Deutschlands am Leib miterlebt und können empirisch diese erfassen. Auf der anderen Seite sind wir als muslimische Frauen, die ihre Religionszugehörigkeit nicht nur im Privaten ausleben, sondern mit ihr auch in die Öffentlichkeit treten, in gewisser Weise Teil der Subalternen, bezieh-ungsweise können uns auch mit unserem Denken und Leib in die Position der Subalternen setzten. Ebenso spielt das eurozentristische Denken der kolonialen Geschichte, wie im Kapitel 2.3. aufgeführt, in den heutigen Feindbildern von Muslimen eine Rolle, da ihr Ursprung im Westen liegen, der in der Wissensproduktion eine Vormachtstellung hat. Von der AfD werden Musliminnen und Muslime als Fremde und Andere verstanden, wodurch sie die Rolle eines Subalternen gedrängt werden. Trotz dessen kann ein Wandel festgestellt werden, da immer mehr Musliminnen und Muslime in Deutschland ihre Benachteiligung und Unterlegenheit zum Ausdruck bringen. Insbesondere durch die sozialen Medien können uns die Gedanken, Gefühle und das Wissen der Subalternen, also den Muslimen, über ihre Unterlegenheit aus den Augen der AfD immer schneller erreichen. Somit werden antimuslimische Feindbilder von vielen Betroffenen erkannt und aufgezeigt, was bedeutet, dass Subalterne ihre Stimme erheben. Diese Gründe zeigen, dass die Auswertungsmethode des Grenzdenkens angemessen ist um zu untersuchen, welche antimuslimischen Feindbilder in der rechten Politik der AfD herrschen.
4. Plakatanalyse
Abb. 1: Wahlplakat der bayerischen AfD 2018
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Beim vorliegenden Plakat handelt es sich um ein Wahlplakat der Partei Alternative für Deutschland, welches zu den Landtagswahlen in Bayern im Jahre 2018 veröffentlicht wurde. Das Plakat ist horizontal ausgerichtet und kann in einen oberen, fotografischen Teil und in einen unteren, mit Schrift und Farben versehen Teil gegliedert werden. Unten rechts ist das Parteilogo der AfD abgebildet, als auch das blau-weiß karierte Wappen des Freistaats Bayern. Der Hintergrund des unteren Teils ist mit einem hellen, blauen Farbton versehen, welcher der Parteifarbe der AfD gleicht. Ziemlich mittig steht in großen, weißen Buchstaben der Schriftzug „Islamfreie Schulen!“. Etwas kleiner ist auf einem roten Hintergrund und ebenfalls mit weißen Buchstaben der Ausruf „Deutsche Leitkultur!“. Am oberen, fotografischen Teil des Plakats sind fünf Jugendliche zentriert abgebildet, die sich vermutlich in einem Schulflur bewegen. Die Gruppe strahlt durch ihre Bewegungen, Mimik, und Gestik eine Freude und Dynamik aus, da sie springen, rennen und lächeln. Die zunächst einmal zusammenhängende Gruppe kann beim genaueren Betrachten vertikal in zwei Parteien gegliedert werden: Im Vordergrund und links sind zwei junge Mädchen und ein Junge, wohingegen links und eher im Hintergrund ein weiterer Junge und ein weiteres Mädchen stehen. Nicht nur die Position der Protagonisten suggeriert diese Zuweisung, sondern auch ihre Blicke, Bewegungen und ihre äußerlichen Merkmale. In der linken Gruppe hat jede Person eine blonde oder hellere Haarfarbe als auch eine helle Hautpigmentierung. Ihre Kleidungen sind voneinander zu unterscheiden: Der Junge trägt ein blaues Hemd, so wie einen Rucksack. Die zwei Mädchen neben ihm halten sich an den Händen und tragen circa knielange, schwarzweiße Kleider, jeweils einmal kariert und einmal mit Streifen, was die Individualität der Charaktere hervorbringt. Die linke Akteurin streckt ihren Arm empor, blickt nach vorne und besitzt ein breites Lächeln, ebenso wie die weiteren beiden ihrer Gruppe. Richtet man den Blick auf den rechten Teil des Plakats, ist die zweite Partei zu sehen. Auch diese Jugendlichen scheinen aktiv und beschwingt, sind dennoch in ihrer Position und Körperhaltung eher zurückhaltend. Ihre Arme sind jeweils im unteren Bereich ihres Körpers gehalten und nur das Mädchen zeigt ein leichtes Lächeln. Sie sind eher abseits vom Geschehen und laufen hinterher. Die Kleidung der zwei Charakteren sind fast identisch, wie bei einer Schuluniform: Sie tragen ein weißes Hemd bzw. Bluse und eine schwarze Hose. Gleichermaßen zu beobachten sind ihre biologischen Merkmale, da jeweils der Junge, als auch das Mädchen dunkelbraune Haare und eine dunkle Augenfarbe haben. Im Vergleich zu der linken Gruppe, ist die Hautfarbe der rechten Gruppe um einen Ton dunkler.
Betrachtet man nun das Plakat aus der Sicht eines Subalternen, können zahlreiche Aspekte erwähnt werden, die eine koloniale Differenz zwischen den unterlegenen Muslimen und den ‚weißen und deutschen‘ Subjekten aufzeigen. Im unteren Teil des Plakats ist der Schriftzug „Islamfreie Schulen!“ in großen Buchstaben geschrieben, wodurch die Forderung danach zuerst in das Auge des Betrachters springt. Insbesondere das Verwenden eines Ausrufe-zeichens unterstreicht die Wichtigkeit der Forderung. Als Subjekt, welches sich als muslimisch identifiziert, erfährt man eine Ausgrenzung aus dem Kollektiv. Auch wenn man beispielsweise selbst diese Schulen besucht hat, die das Plakat beschreibt, wird der Gedanke vermittelt, dass man als Anhänger des Islams unerwünscht ist. Man könnte die Aussage auch so verstehen, dass nicht nur die Religion, sondern auch Musliminnen und Muslime an den deutschen Schulen nicht gerne gesehen sind. Als Subalterne kann dieses Gefühl der Ausgrenzung eine tiefe Trauer auslösen, da es belanglos ist, wie sehr man sich sehnt und bemüht zur Gesellschaft zu gehören, weil man als nicht zugehörig und würdig gesehen wird. Zumal der Ausruf „Deutsche Leitkultur!“ am Plakat unterstreicht, dass der Islam weder zu den deutschen Schulen, noch zur Kultur Deutschland gehöre. In Verbindung mit dem fotografischen Teil des Dokuments kann verstanden werden, dass das Aussehen und die Kleidung der Jugendlichen die deutsche Kultur repräsentieren. Die linke Gruppe hat hellere, biologische Merkmale, die bereits in der Vergangenheit als das Ideal Deutschlands galten. Diese Eigenschaften werden mit einer europäischen Herkunft in Verbindung gebracht, was wiederum die Vormachtstellung der ‚rein und weißen‘ Subjekten aufzeigt. Die rechte Gruppe zeigt dunklere Eigenschaften auf, die mit einer Herkunft aus dem Nahen Osten, wo insbesondere der Islam vertreten ist, in Relation gebracht wird. Eine Person, die der Gruppe der Subalterne angehört, würde die hierarchische Stellung der Gruppen erkennen und sich unterrepräsentiert und benachteiligt fühlen. Insbesondere subalterne Jugendliche in Deutschland versuchen Peers und Repräsentanten in öffentlichen Darstellungen zu finden, um sich mit diesen zu identifizieren. Man könnte meinen, dass bei dieser Affiche die rechte Gruppe Muslime darstellen sollen. Das Plakat zeigt aber eine Überlegenheit von denjenigen, die mit ihren äußeren Merkmalen nicht zum typisierten Bild von Musliminnen und Muslime passen. Sie stehen im Vordergrund, zentriert und bewegen sich dynamischer. Hier wird eine koloniale Differenz deutlich, da auch im Bild Musliminnen und Muslime als abseits des Geschehens verstanden werden und somit nicht zum Kollektiven Wir, zur Hegemonie gehören. Aus einer subalternen Perspektive würde ebenfalls die Unterschiedlichkeit der Kleidung auffallen: Wohingegen die ‚Überlegenen‘ durch verschiedenen Kleidungsstile Individualität ausstrahlen, bleiben die ‚Unterlegenen‘ in einem einheitlichen Stil und tragen weiß und schwarz. Hier könnte man hineininterpretieren, dass Muslimen und Muslime zu verallgemeinern sind und keine Heterogenität in ihrer Gruppe aufweisen. Dies kann Gefühle von Wut in den Subalternen auslösen, da man verallgemeinert und nicht als individuelles Subjekt verstanden wird. Als Zwischenresümee repräsentiert das Plakat der AfD aus der Sicht eines Subalternen eine Unerwünschtheit, Ausgrenzung, als auch eine Hierarchie zwischen der eurozentristischen Machtstellung der Deutschen und der Musliminnen und Muslimen, die eben nicht zu der Gruppe dazugehören.
Viele dieser Interpretationen können als antimuslimische Feindbilder benannt werden. Somit liegt im nächsten Schritt der Fokus auf das vorliegende Material selbst und unter welcher Voraussetzung sich im Sinne des Grenzdenkens dieses herausbildete. Das wissende Subjekt, welches das Plakat in die Öffentlichkeit brachte, ist die Partei AfD, welche 2013 aus einer europakritischen Motivation heraus gegründet wurde. Im Laufe der Zeit wandelte sich ihr Wahlprogramm zu einer eher islamkritischen Position, die sich auf die Themen Integration und Migration bezieht. Mit ihrer Präsenz im Bundestag hat die Partei in Deutschland ein Mitspracherecht, wie das Leben hier gestaltet wird und welches politische Wissen an die Bürgerinnen und Bürger überbracht wird. Somit haben Wissensproduktionen der AfD ein gewisses Gewicht, da sie sich durch die Zunahme an Wählern immer mehr legitimieren konnte. Die Wichtigkeit der deutschen Sprache als auch die Forderung nach einer übergreifenden, deutschen Leitkultur werden nicht nur mündlich von der AfD in die Öffent-lichkeit getragen. Durch Wahlplakate, wie unser vorliegendes Dokument, drückt sie ihre Standpunkte kurz und prägnant aus. Wie in unserem Beispiel wird im Sinne der Geopolitik eine eurozentristische Perspektive eingenommen, da insbesondere diejenigen, die den ursprünglichen Merkmalen eines Europäers entsprechen, die Protagonisten des Plakates sind. Dem gegenüberzustellen sind die benachteiligten und machtlosen Subalterne, die Musliminnen und Muslime, welche nicht Teil des Geschehens sind, beziehungsweise nur einen kleinen Raum einnehmen. Hier wird ein islamisches Feindbild suggeriert: Da Muslimminen und Muslime nicht Teil der ‚reinen, weißen‘ Deutschen sind, gehören sie nicht zu Deutschland und sind die ‚Fremden‘ und ‚Anderen‘. Auch den Multikulturalismus lehnt die Partei ab, da sie hier, als auch in ihren Wahlprogrammen, eine deutsche Leitkultur allgemein, als auch in den Schulen fordern. Im Zusammenhang mit dem Schriftzug „Islamfreie Schulen!“ wird eine antimuslimische, rassistische Position verkündet, da der Islam als eine Kultur ethnisiert und homogenisiert wird. Der Islam würde unvereinbar mit der deutschen Kultur sein, obwohl deutsche oder in Deutschland lebende Muslime von einer Heterogenität geprägt sind. Die Verallgemeinerung der Gruppe und das Bezeichnen dieser als fremd ist eines der zahlreichen islamischen Feindbilder, die die AfD bewerben. Zusammenfassend produziert die AfD Wissen aus einer überlegenen Machtstellung, was ihnen in gewisser Weise erlaubt, diese auch in ihren Wahlplakaten zu übernehmen. Aus dieser Position heraus meinen sie die Autorität zu haben, entscheiden zu dürfen, wer zu dem selbst definierten „Wir“ gehört und wer als ‚Fremder‘ ausgegrenzt wird, was als ein islamisches Feindbild benannt werden kann. Dieses Denken zeigt eine koloniale Differenz zwischen ihnen und den subalternen Musliminnen und Muslimen auf.
Die AfD möchte das Wissen vermitteln, dass in den deutschen Schulen kein islamischer Religionsunterricht stattfinden soll. Die Islamkunde soll im Gegensatz zum christlichen Religionsunterricht verboten werden, da dieser nicht mit der Deutschen Kultur und den Werten des christlichen Abendlandes zu vereinbaren sei. Musliminnen und Muslime hingegen würden nicht die Werte aus der eurozentristischen Perspektive vertreten, wodurch das anti-muslimische Feindbild als unmoderne mit niedrigem Bildungsniveau auf die Gruppe projiziert wird. Solch eine Wissensgenerierung ist mit den Aspekten des Rechtspopulismus zu vergleichen: Den Eingeborenen stehen mehr Rechte zu, da sie den Religionsunterricht erhalten dürfen, den sie auch möchten. Die Forderungen der Partei kann auch als Wunsch nach totalem Ausschluss des Islams an den Schulen verstanden werden, wie jegliche Symbole, die beispielsweise Musliminnen und Muslimen tragen. Nach der Veröffentlichung des unser zu untersuchenden Wahlplakats, äußerte sich der damalige Landesvorsitzende der AfD Bayern hierzu: „Muslimischen Kindern müssen wir an den Schulen die Werte der freiheitlichen-demokratischen Grundordnung und eben nicht die des Islams lehren“ (Sichert, o.D.). Ebenso sollen junge Muslime den Ethikunterricht besuchen, „wo sie mit Anders-gläubigen wie Juden, Atheisten etc. gemeinsam über die Werte der westlichen Welt diskutieren“ (Sichert, o.D.). Aus der Perspektive der AfD profitieren die subaltere Muslime von den ‚islamfreien Schulen‘, da ihnen die allgemeingültigen Werte beigebracht werden und sie nicht in einen separaten Unterricht zu unterbringen sind. Dies ist äußert problematisch, da einerseits nur die westlichen Werte als die fortschrittlichsten und universell verstanden werden, wodurch andererseits alternative Denkmuster und Werte negiert werden. Das Verständnis der AfD über ein westliches, universelles Gedankengut fußt auf ihrer hegemonialen Stellung, was die koloniale Differenz zwischen ihnen und den Muslimen aufzeigt. Mittels des Wahlplakats verharmlost die AfD diese problematische und rassistische Anschauung durch eine dynamische, freudige und unschuldige Darstellung der Jugendlichen als gemeinsame, gleichberechtigte Gruppe. Wie aber schon in dieser Analyse begründet, sind beim genaueren Hinsehen wieder Hierarchien zwischen den muslimischen Subalternen und den quasi überlegenen Deutschen zu erkennen. Abschließend ist hier zu erwähnen, dass es sich um eine geplante Vorgehensweise der Partei aus ihrer hegemonialen Position handelt, um die muslimische Minderheit immer mehr durch politische Einschränkungen an den Rand der Gesellschaft zu drängen. Solche Diskriminierungen werden legitimiert mit dem Vorwand der Beschützung der Deutschen Werte die eben Teil der Deutschen Leitkultur sind.
Das Wahlplakat intendiert sich an die allgemeine Bevölkerung zu richten, um antimuslimische Ideen unter das Volk zu bringen. Es richtet sich auch an die Bürgerinnen und Bürger, die rechtsextreme, rechtspopulistische und antimuslimisch rassistische Einstellungen aufweisen. Herrschende antimuslimische Feindbilder der Gesellschaft werden somit von der Partei aufgegriffen, was für eine Repräsentation der politischen Einstellung der Wähler sorgt. Im Umkehrschluss erhält die AfD immer mehr Zuspruch und Stimmen, wodurch ihnen als Partei in unserer repräsentativen Demokratie mehr Wahlsitze im Bundestag oder Landtag zustehen. Damit ist die Partei in einer überlegenen Position, da sie über die aktuellen bildungspolitischen Gesetzeslagen und Regelungen mitbestimmen dürfen. Insbesondere Musliminnen und Muslime wird somit verwehrt, aus ihrer benachteiligten Position heraustreten zu können, da die AfD aus ihrer islamkritischen Politik heraus über die Subalterne sprechen, anstelle von mit ihnen. Als Beispiel dafür kann benannt werden, dass kein Mädchen auf dem vorliegenden Wahlplakat ein Kopftuch trägt, was von zahlreichen muslimischen Frauen selbstbestimmt als religiöses Symbol getragen wird. Die AfD meint dazu, dass ein Verbot von Kopftüchern an den Schulen „für viele Mädchen, denen es vom Elternhaus aufgezwungen wird, auch ein Stück Freiheit“ (Sichert, o. D.) wäre. Hier wird von der Partei vermutet, dass dies die Situation der Subalternen beschreibt, was aber meistens nicht der Fall ist. Das antimuslimische Feindbild der unterdrückten Frau im Islam wird von der AfD suggeriert, weswegen sie alle Musliminnen von ihrem Leid befreien müssten. Die Partei wäre in diesem Fall der angebliche Held der Subalternen, da sie diese aus ihrer unterlegenen Situation befreien. Was aber tatsächlich die Wünsche der Musliminnen und Muslime sind, wird nicht berücksichtigt, was wiederum eine koloniale Differenz zwischen den gegensätzlichen Gruppen aufzeigt.
Da die AfD in zahlreichen Medienformen vertreten ist, und dort auch eine große Anzahl der Menschen erreichen kann, profitieren sie selbst, aber auch die unterschiedlichen Medien-vertreter beispielsweise finanziell von ihrer Wissensweitergabe. Auch dass die AfD von öffentlichen Mitteln und Spenden unterstützt wird zeigt, dass ihre rechtspopulistischen und antimuslimisch rassistische Gedanken von der öffentlichen Meinung gefördert werden. Aus diesem Grund ist es von großer Bedeutung, dass dekoloniale Optionen entwickelt werden. Hiermit können die hegemonialen Strukturen entdeckt und die Machtungleichheiten abgebaut werden. Subalterne sollten nicht ruhig bleiben und ihre Stimme erheben, indem sie Politiker der Alternative, als auch ihre dazugehörigen Unterorganisationen und Partner kontaktieren. Die plakatierte und suggerierte Menschenfeindlichkeit gegenüber Musliminnen und Muslime muss aufgezeigt werden. Es handelt sich um islamische Feindbilder, die gefüttert, generiert und weitervermittelt werden aus dem Gefühl der Überlegenheit der AfD, ähnlich wie beim Kolonialismus. Somit müsste das Ablehnen der Partei, indem diese nicht gewählt und finanziell gefördert wird, ein Zeichen gegen die vorherrschende koloniale Differenz setzen und ein Selbstreflexionsprozess bei den Anhängern der Partei auslösen. Ebenso sollte die stärkere Unterstützung von deutschen politischen und sozialen Organisationen, die auch von muslimischer Subalternen gegründet sind, eine dekoloniale Optionen darstellen, da dadurch nicht nur der Fokus auf der eurozentristischen Perspektive steht, sondern auch auf die der Unterlegenen. Mithilfe dieser Organisationen wird die Öffentlichkeit schneller erreicht, wodurch ebenfalls antimuslimische Feindbilder in der Gesellschaft abgebaut werden können. Auch sollten die muslimische Subalterne durch Zusammenarbeit und Trainings bestärkt werden, damit sie immer mehr in die Mitte der Gesellschaft rücken und tatsächlich als gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger gelten. Trotz dessen spielen antimuslimiche Feindbilder nicht nur in den Wahlplakaten der AfD eine Rolle, sondern verdeckter auch in zahlreichen weiteren politischen und staatlichen Organisationen. Das Benennen und Aufzeigen dieser Problematiken ist die Aufgabe jeder, wie beim Beispiel des bayerischen Innenministeriums aus der Einleitung dieser Arbeit.
5. Fazit
Der klare antimuslimische Diskurs fungiert wie ein Sprachrohr für verzerrte Unzufriedenheit, in dem Fall die einer größeren Menschengruppe, da die Partei ohne Wählerstimmen nicht so weit kommen würde. Das lässt sie aber nicht dadurch legitimieren. Antimuslimische Feindbilder müssen in politischen Debatten thematisiert werden, um beispielsweise Fragen wie „Warum tragen muslimische Frauen ein Kopftuch?“ nachzugehen, als dass man sie mit Zwang und Unterdrückung klischiert. Allgemein gilt: damit das „Fremde“ nicht fremd bleibt, muss ein aufrichtiges Interesse daran bestehen, solche Ressentiments aus dem Weg zu räumen, indem man Gespräche mit Subalternen sucht, andernfalls zeugt dies von Arroganz. Vor allem, weil die politische und gesellschaftliche Entwicklung ihr Potenzial zu einem rechten dominanten Zweig in Deutschland seit nun einiger Zeit ausschöpft, erregen die entwickelnden Wahlprogramme, die erzielten Wahlergebnisse und auch rechtspopulistischen Reden, große Besorgnis. Sie bedeuten eine wachsende Gefahr für die heterogene Gesellschaft in Deutschland heutzutage, da die Religions- und Meinungsfreiheit vieler sehr eingeschränkt wäre. Das Ganze versteht sich als Teufelskreislauf. Da, nach jeder Aktion eine Reaktion folgt, werden auch in diesem Fall harte Konsequenzen erfolgen, indem sich eine erneute Unzufriedenheit und Frustration über das Volk breit machen wird. Das ist bei einer derartigen Ausgrenzungsform unumgänglich. Zu Schluss soll in diesem Kontext auf eine jüngste Dokumentation der Arbeitergemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) aufmerksam gemacht werden, in der ein Blick in die Zukunft durch KI (Chat GPT) generiert wird. Auf folgende Frage, soll diese dann fiktive Szenarien erstellen: „Wie sehe Deutschland unter einer AfD Regierung aus?“. Wenn die AfD beispielsweise ihr Konzept zur Deislamisierung durchsetzt, würden Moscheen geschlossen werden und Kinder in einem Land aufwachsen, in dem sie für ihren Glauben verurteilt und deswegen bedroht werden. Das ist nicht nur ein Eingriff in die Glaubens- und Religionsfreiheit eines Individuums, sondern auch ein klarer Eingriff in die angeborenen rechte eines jeden Menschen, wie die unantastbare Würde. Eine solche Forderung wie „Islamfreie Schulen!“ ist nicht mit dem deutschen Grundgesetz Artikel 4 vereinbar, in dem die Glaubensfreiheit und die ungestörte Religionsausübung als unverletzlich festgehalten sind. Die Bemühung um die Einhaltung des Grundgesetztes kann als Versuch verstanden werden, die Kluft zwischen Subalternen und den hegemonialen/kolonialen Mächten aufzuarbeiten. Diese Arbeit sollte ihren Zweck, die politischen Entwicklungen der AfD zu untersuchen, erfüllen und einen Ausblick auf diese nicht auslassen, aber allein eine solche Arbeit wie die Vorliegende wird nicht zu einer brisanten Veränderung beitragen, diese müssen definitiv auf politischem und aktivistischem Wege stattfinden.
6. Literaturverzeichnis
Alternative für Deutschland (2016) Grundsatzprogramm für Deutschland. Abgerufen am 14. Dezember 2024, von https://www.afd.de/grundsatzprogramm/
Çakir, N. (2019). Das Eigene und das Fremde – zwischen Heterophobie und Rassismus. In B. Uçar & W. Kassis (Hrsg.), Antimuslimischer Rassismus und Islamfeindlichkeit (S. 77–102). Universitätsverlag Osnabrück Vandenhoeck & Ruprecht.
Cheema, S.N. (2021). Antimuslimischer Rassismus tötet. Aber vorher grenzt er aus. Wie das Feindbild »Muslim« verfestigt wurde – und Muslime und Nichtmuslime zu Opfern werden. In K. Bozay, O. Mangitay, S. Güner & F. Göçer (Hrsg.), Damit wir atmen können: migrantische Stimmen zu Rassismus, rassistischer Gewalt und Gegenwehr (S. 35–42). PapyRossa Verlag.
Cooperaxion. Stiftung für nachhaltige Entwicklung und interkultureller Austausch (o.D.) Glossar. Von A wie Alfred Escher bis V wie Versklavte. Abgerufen am 10. Dezember 2024, von https://bern-kolonial.ch/glossar
Cremer, H. (2024). Je länger wir schweigen, desto mehr Mut werden wir brauchen. Wie gefährlich die AfD wirklich ist. Berlin Verlag.
Freise, J. (2017). Kulturelle und religiöse Vielfalt nach Zuwanderung: Theoretische Grundlagen–Handlungsansätze–Übungen zur Kultur-und Religionssensibilität. Wochenschau Verlag.
Hafez, F. (2019). Feindbild Islam: Über die Salonfähigkeit von Rassismus. Böhlau Verlag.
Kastner, J. & Waibel, T. (2012) Einleitung: Dekoloniale Optionen. Argumentation, Begriffe und Kontexte dekolonialer Theoriebildung In Mignolo, W. D. (2012). Epistemischer Ungehorsam. Rhetorik der Moderne, Logik der Kolonialität und Grammatik der Dekolonialität (J. Kastner & T. Waibel, Übers.). Verlag Tura + Kant.
Lewandowsky, M., Giebler, H. & Wagner, A. (2016) Rechtspopulismus in Deutschland. Eine empirische Einordnung der Parteien zur Bundestagswahl 2013 unter besonderer Berücksichtigung der AfD, Politische Vierteljahresschrift, Nomos, Vol. 57.(S. 247–275). Abgerufen am 15. November 2024, von https://doi.org/10.5771/0032-3470-2016-2-247%0A
Mignolo, W. (2000). Local histories/global designs: Coloniality, subaltern knowldges, and border thinking. Princton University Press. Abgerufen am 08. Dezember 2024, von https://www.studon.fau.de/file5726921_download.html
Mignolo, W. D. (2009). Epistemic Disobedience, Independent Thought and Decolonial Freedom. Theory, Culture & Society, 26(7–8), (S.159–181).
Mignolo, W. D. (2011). The Darker Side of Western Modernity: global futures, decolonial options. Duke University Press. Abgerufen am 08. Dezember 2024, von https://www.studon.fau.de/file5726853_download.html
Mustafa, I. (2022). Islam und antimuslimischer Rassismus in Parteisystem und Bundestag: Eine diskursanalytische Studie des offiziellen Diskurses zwischen 2015- 2021. Universität Erfurt, Philosophische Fakultät. Abgerufen am 14. Dezember 2024, von https://www.deutsche-islam-konferenz.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Studien/mustafa-islam-u-antimuslimischer-rassismus.pdf?__blob=publicationFile&v=2
Mustafa, I. (2023). Der Islam gehört (nicht) zu Deutschland. Islam und antimuslimischer Rassismus in Parteiensystem und Bundestag. transcript Verlag.
Oeser, E. (2016). Die Angst vor dem Fremden. Die Wurzeln der Xenophobie. (2. Aufl.). Theiss Verlag.
Pfahl-Traughber, A. (2019). Die AfD und Rechtsextremismus - eine Analyse aus politikwissenschaftlicher Perspektive. Springer Verlag
Röther, C. (2019). Islamismus von außen. Religionswissenschaftliche Analyse der islamkritischen Szene Deutschlands. Ergon Verlag.
Schaeffer, U. (2018). Fake statt Fakt: Wie Populisten, Bots und Trolle unsere Demokratie angreifen. Deutscher Taschenbuch Verlag.
Schroeder, W. & Weßels, B. (2020). Die Alternative für Deutschland. Sozial Extra 44, (S.97–101. Springer Verlag. Abgerufen am 15. Dezember 2024, von https://link.springer.com/article/10.1007/s12054-020-00268-5
Schuppener, G., Demčišák, J., & Fraštiková, S. (2021). Selbstdarstellungen von rechtspopulistischen Parteien (Deutschland, Österreich, Slowakei). Leipziger Universitätsverlag.
Sichert, M (o.D.) Der Spiegel fragte uns zu den islamfreien Schulen, wir antworten wie folgt. Abgerufen am 14. Dezember 2024, von https://afdbayern.de/der-spiegel-fragte-uns-zu-den-islamfreien-schulen-wir-antworten-wie-folgt/
Sommer, G. (2022). Feindbilder. In C. Cohrs (Hrsg.), Handbuch Friedenspsychologie, (S. 3–34). Abgerufen am 05. Dezember 2024, von https://archiv.ub.uni-marburg.de/es/2022/0059/pdf/42_Feindbilder.pdf
Spielhaus, R. (2021). Antimuslimischer Rassismus. In K. Fereidooni & S. Hößl (Hrsg.), Rassismuskritische Bildungsarbeit: Reflexionen zu Theorie und Praxis (S. 84–98). Frankfurt am Main: Wochenschau Verlag.
Tlostanova, M., & Mignolo, W. D. (2009). Global coloniality and the decolonial option. Kult, 6 (Special Issue), (S.130–147). Abgerufen am 08. Dezember 2024 von https://www.studon.fau.de/file5726844_download.html
Uçar, B., & Walker, V. (2019). Muslime in Europa: Zur Relation von Integration und Religion. In B. Uçar & W. Kassis (Hrsg.), Antimuslimischer Rassismus und Islamfeindlichkeit (S. 9–56). Universitätsverlag Osnabrück Vandenhoeck & Ruprecht.
Universität Leipzig (o.D.) Methodenportal. Dokumentenanalyse. Abgerufen am 05. Dezember 2024, von https://home.uni-leipzig.de/methodenportal/dokumentenanalyse/
Winkler, K. (2018). Islam in der Schule: Zur Frage des Umgangs mit Religion und religiöser Symbolik im Bildungssystem. In R. Ceylan & H. H. Uslucan (Hrsg.) Transformation religiöser Symbole und religiöser Kommunikation in der Diaspora: Sozialpsychologische und religionssoziologische Annäherungen an das Diskursfeld Islam in Deutschland (S. 157–178). Springer VS.
7. Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Themenplakate der bayerischen Alternative für Deutschland im Jahre 2018. Abgerufen am 14. Dezember 2024, von https://afdbayern.de/themenplakate/
[...]
- Arbeit zitieren
- Selma Ljiko (Autor:in), Ilayda Sena Sari (Autor:in), 2024, Welche antimuslimischen Feindbilder herrschen in der rechten Politik der AfD?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1558572