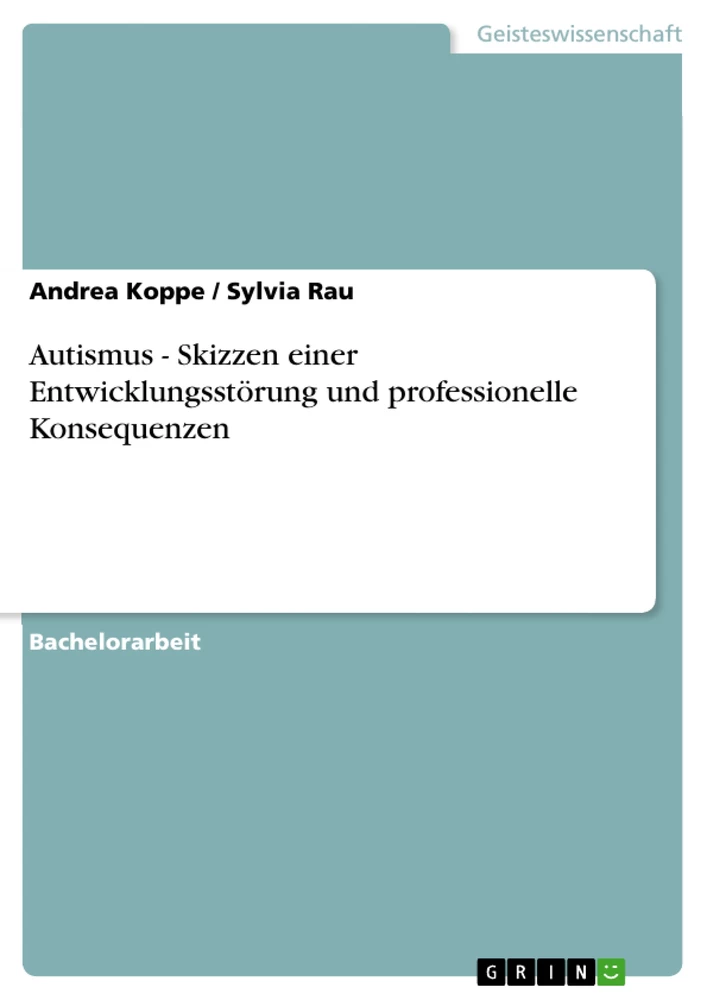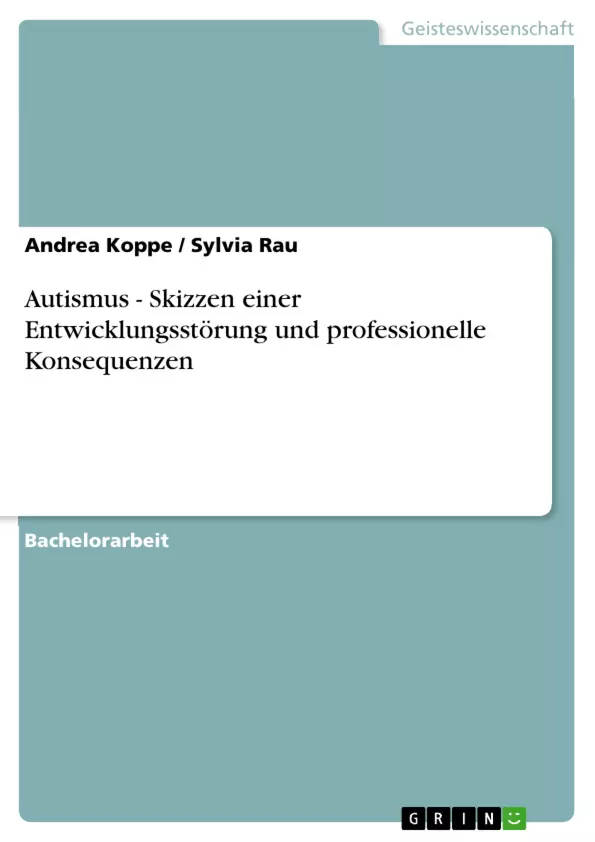Autismus ist eine Entwicklungsstörung von medizinischem Krankheitswert, die mit
zunehmendem Interesse verfolgt wird. Zahlreiche Publikationen verdeutlichen
dies.
Die Notwendigkeit, weitere Aspekte dieser fremdartig erscheinenden psychischen
Störung zu erfahren, ist auch der steigenden Zahl Erkrankter zuzuschreiben
(Aarons und Gittens, 13). Die Betroffenen werden auf Grund dieser tiefgreifenden
Störung an einem konfliktfreien Zugang zur menschlichen Gesellschaft gehindert.
Auch die Eltern und Angehörigen der an Autismus erkrankten Kindern und
Jugendlichen sowie die Menschen, die in den Einrichtungen mit autistischen
Menschen arbeiten, sind einer erheblichen Belastung ausgesetzt.
Die Integration in den Kindereinrichtungen (Kindergarten, Schule) erfordert unter
anderem von den Pädagogen Interesse, sich umfassendes Wissen anzueignen,
um sich mit gelebter Professionalität den autistischen Menschen anzunehmen.
Die Arbeit und der Umgang mit autistischen Kindern in unseren Einrichtungen und
die damit verbundenen Anforderungen an das ganze Pädagogenteam haben den
Impuls zur Wahl dieser Thematik für unsere Arbeit gegeben. Eine gute Qualität in
der praktischen Arbeit bei der Integration autistischer Menschen in die
Gesellschaft und das Schulsystem kann nur auf der Grundlage der theoretischen
Auseinandersetzung mit diesem Thema erfolgreich stattfinden. Die theoretischen
Erkenntnisse ermöglichen uns ein Verstehen der Ängste, Wünsche und
Hoffnungen der Betroffenen. Dies wiederum trägt in hohem Maß zum Verständnis
für die Andersartigkeit der Erkrankten sowie zur Offenheit und Toleranz im
Umgang mit diesen bei und kann bei der täglichen Arbeit mit autistischen KindernDie Auseinandersetzung mit diesen und anderen Fragestellungen zur Problematik
des Autismus ist Inhalt unserer Arbeit und soll einen zukunftsbezogenen Beitrag
für unsere pädagogische Arbeit mit autistischen Kindern leisten. Die Bearbeitung
der Fragestellungen stützt sich auf Basisliteratur zu Autismus und Integration
sowie auf Internetquellen und Befragungen zum Thema.
Als Einstieg in diese Thematik werden wir nach einem historischen Abriss im
Hauptteil umfassende Erläuterungen zu dem Krankheitsbild Autismus geben. Das
theoretische Basiswissen zum Thema Autismus-Spektrum-Störungen (ASS)
umfasst im Anschluss daran den Begriff und die Klassifikation des Autismus als
tiefgreifende Entwicklungsstörung...
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung und Fragestellung
- 2 Autismus im Kontext der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen
- 2.1 Historische Hintergründe
- 2.2 Zum Begriff des Autismus und Klassifikation
- 2.2.1 Begriffsklärung
- 2.2.2 Autismus-Spektrum-Störungen
- 2.3 Symptomatik
- 2.4 Ätiologie
- 2.4.1 Genetik
- 2.4.2 Neurobiologie
- 2.4.3 Neuropsychologie
- 2.5 Diagnostik, Differentialdiagnostik und Komorbidität
- 2.5.1 Diagnostik
- 2.5.2 Differentialdiagnostik
- 2.5.3 Komorbidität
- 2.6 Epidemiologie
- 3 Professionelle Entwicklungshilfen und Fördermöglichkeiten
- 3.1 Lovas
- 3.2 TEACCH
- 3.3 Integration
- 3.3.1 Begriffsbestimmung
- 3.3.2 Rechtliche Grundlagen
- 3.3.3 Ziele und Aufgaben
- 3.3.4 Rahmenbedingungen
- 3.3.5 Integrierende Begleitung
- 4 Befragung von Professionellen und Eltern zum Veränderungserleben des TEACCH-Ansatzes
- 4.1 Ziel der Methode
- 4.2 Beschreibung des Vorgehens
- 4.3 Beschreibung der Methode
- 4.4 Ergebnisse
- 4.5 Zusammenfassende Bewertung der Fragebogenergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht Autismus als tiefgreifende Entwicklungsstörung. Ziel ist es, die professionellen Konsequenzen aus den Erkenntnissen über Autismus aufzuzeigen und verschiedene Fördermöglichkeiten zu beleuchten. Die Arbeit basiert auf wissenschaftlicher Literatur und einer empirischen Untersuchung.
- Autismus als tiefgreifende Entwicklungsstörung
- Diagnostik und Klassifizierung von Autismus
- Professionelle Fördermöglichkeiten (z.B. Lovas, TEACCH)
- Integration von autistischen Kindern
- Auswertung einer Befragung zu den Erfahrungen mit dem TEACCH-Ansatz
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung und Fragestellung: Diese Einleitung führt in das Thema Autismus ein und beschreibt die Forschungsfrage der Arbeit. Sie benennt den Fokus auf die Auswirkungen der Störung und die daraus resultierenden professionellen Handlungsansätze. Die Einleitung skizziert den Aufbau und die Methodik der Arbeit, um den Leser auf die folgende detaillierte Auseinandersetzung mit Autismus vorzubereiten. Sie stellt einen roten Faden dar, der die einzelnen Kapitel miteinander verbindet und die Gesamtzielsetzung der Arbeit verdeutlicht.
2 Autismus im Kontext der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über Autismus, beginnend mit historischen Hintergründen und Begriffsklärungen. Es differenziert zwischen verschiedenen Klassifikationen und beschreibt die Symptomatik der Störung detailliert. Die Ätiologie wird aus genetischer, neurobiologischer und neuropsychologischer Perspektive beleuchtet, gefolgt von einer Darstellung der Diagnostik, Differentialdiagnostik und Komorbidität. Abschließend wird die epidemiologische Verbreitung von Autismus-Spektrum-Störungen betrachtet, um ein ganzheitliches Verständnis der Thematik zu schaffen. Die Kapitelteile greifen ineinander und bilden ein umfassendes Bild der Störung.
3 Professionelle Entwicklungshilfen und Fördermöglichkeiten: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene professionelle Förderansätze für autistische Kinder und Jugendliche. Es werden die Methoden Lovas und TEACCH detailliert beschrieben und im Kontext ihrer Anwendungsmöglichkeiten analysiert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Integration von autistischen Kindern in den Regelunterricht. Hier werden Begriffsbestimmungen, rechtliche Grundlagen, Ziele, Aufgaben, Rahmenbedingungen und die integrierende Begleitung beleuchtet. Der Vergleich und die Gegenüberstellung der verschiedenen Methoden dienen dem Verständnis für die Vielfalt der Interventionen bei Autismus.
4 Befragung von Professionellen und Eltern zum Veränderungserleben des TEACCH-Ansatzes: Dieses Kapitel beschreibt eine empirische Studie, die sich mit den Erfahrungen von Fachkräften und Eltern zum TEACCH-Ansatz beschäftigt. Es erläutert die Methodik der Befragung und präsentiert die Ergebnisse. Die Auswertung der Daten gibt Aufschluss über die Wirksamkeit des TEACCH-Ansatzes und zeigt dessen Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen und ihre Familien. Die Ergebnisse werden kritisch reflektiert und in den Kontext der bisherigen Kapitel eingeordnet.
Schlüsselwörter
Autismus, Autismus-Spektrum-Störungen (ASS), tiefgreifende Entwicklungsstörung (TE), Diagnostik, Differentialdiagnostik, Ätiologie, Fördermöglichkeiten, Integration, TEACCH, Lovas, professionelle Konsequenzen, empirische Untersuchung, Eltern, Professionelle.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Autismus - Professionelle Entwicklungshilfen und Fördermöglichkeiten
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht Autismus als tiefgreifende Entwicklungsstörung. Ihr Ziel ist es, die professionellen Konsequenzen aus den Erkenntnissen über Autismus aufzuzeigen und verschiedene Fördermöglichkeiten zu beleuchten. Die Arbeit basiert auf wissenschaftlicher Literatur und einer empirischen Untersuchung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Autismus als tiefgreifende Entwicklungsstörung, Diagnostik und Klassifizierung von Autismus, professionelle Fördermöglichkeiten (z.B. Lovas, TEACCH), Integration von autistischen Kindern und die Auswertung einer Befragung zu den Erfahrungen mit dem TEACCH-Ansatz.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: 1. Einleitung und Fragestellung; 2. Autismus im Kontext der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen; 3. Professionelle Entwicklungshilfen und Fördermöglichkeiten; 4. Befragung von Professionellen und Eltern zum Veränderungserleben des TEACCH-Ansatzes.
Was wird im Kapitel "Autismus im Kontext der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen" behandelt?
Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über Autismus, beginnend mit historischen Hintergründen und Begriffsklärungen. Es beschreibt die Symptomatik, die Ätiologie (genetisch, neurobiologisch, neuropsychologisch), Diagnostik, Differentialdiagnostik, Komorbidität und die epidemiologische Verbreitung von Autismus-Spektrum-Störungen.
Welche Fördermöglichkeiten werden im dritten Kapitel vorgestellt?
Kapitel 3 präsentiert verschiedene professionelle Förderansätze, detailliert die Methoden Lovas und TEACCH und analysiert deren Anwendungsmöglichkeiten. Ein Schwerpunkt liegt auf der Integration von autistischen Kindern im Regelunterricht (Begriffsbestimmung, rechtliche Grundlagen, Ziele, Aufgaben, Rahmenbedingungen und integrierende Begleitung).
Was ist Gegenstand des vierten Kapitels?
Kapitel 4 beschreibt eine empirische Studie, die die Erfahrungen von Fachkräften und Eltern zum TEACCH-Ansatz untersucht. Es erläutert die Methodik der Befragung, präsentiert die Ergebnisse und reflektiert deren Bedeutung im Kontext der vorherigen Kapitel.
Welche Methode wurde in der empirischen Untersuchung verwendet?
Die empirische Untersuchung basiert auf einer Befragung von Professionellen und Eltern, die ihre Erfahrungen mit dem TEACCH-Ansatz schildern. Die Arbeit beschreibt detailliert die Zielsetzung, das Vorgehen und die Auswertung der Ergebnisse dieser Befragung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Autismus, Autismus-Spektrum-Störungen (ASS), tiefgreifende Entwicklungsstörung (TE), Diagnostik, Differentialdiagnostik, Ätiologie, Fördermöglichkeiten, Integration, TEACCH, Lovas, professionelle Konsequenzen, empirische Untersuchung, Eltern, Professionelle.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht Autismus als tiefgreifende Entwicklungsstörung und möchte die professionellen Konsequenzen aus den Erkenntnissen über Autismus aufzeigen und verschiedene Fördermöglichkeiten beleuchten.
- Quote paper
- Andrea Koppe (Author), Sylvia Rau (Author), 2010, Autismus - Skizzen einer Entwicklungsstörung und professionelle Konsequenzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/155687