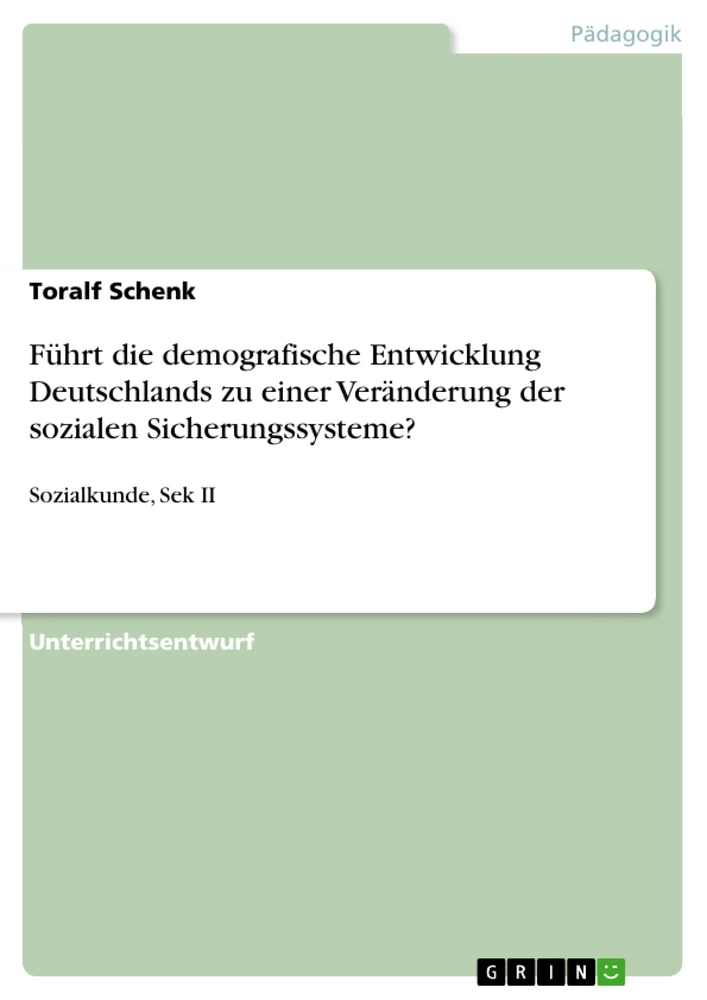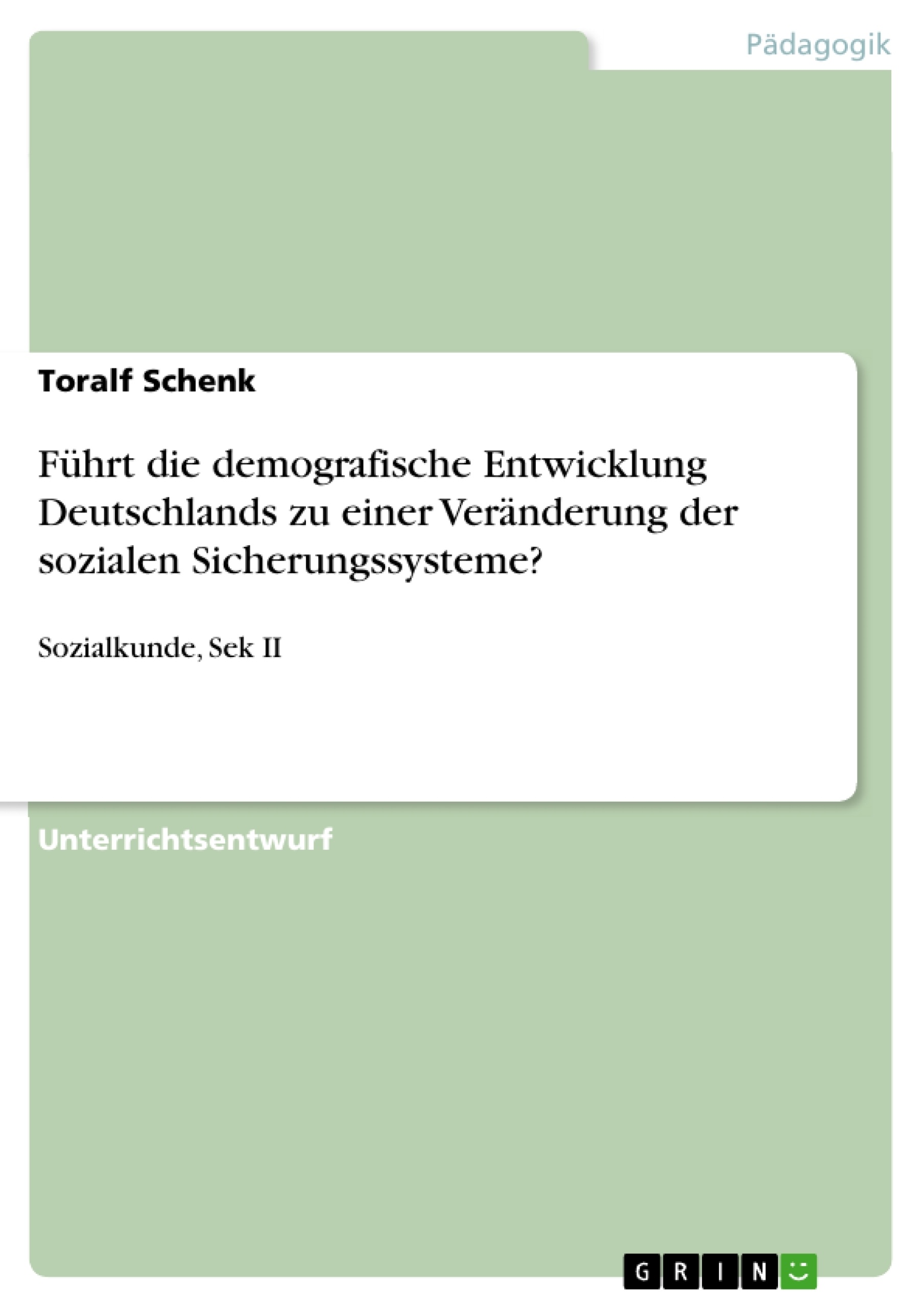Den Zusammenhang zwischen Bevölkerungsentwicklung und der damit verbundenen Belastung der Sozialsicherungssysteme als ein gegenwärtiges Schlüsselproblem sollen die Schüler kennen lernen. Sie untersuchen mit Hilfe verschiedener grafischer Darstellungen den Altersaufbau der Bevölkerung von einer „Pyramide“ (1910) über eine „zerzauste Wettertanne“ (1950/ 1999) bis hin zum „henkellosen Krug“ (2050). Bei einer „Bevölkerungspyramide“ ist jede nachfolgende Generation größer als die vorangegangene, was auf eine höhere Geburtenrate (Fertilität) hinweist, aber auch auf eine hohe Sterblichkeit, denn die Jahrgänge werden nach oben hin immer kleiner. Die „zerzauste Wettertanne“ lässt die tiefen Einkerbungen durch die beiden Weltkriege deutlich werden. Die Altersstruktur ist geprägt durch die geburtenstarken mittleren Jahrgänge und einen schwachen Sockel der unter 25 Jährigen. Der in den 60er Jahren einsetzende Geburtenrückgang wird als Pillenknick bezeichnet. Alle diese Einschnitte wirken bis in die Gegenwart fort, so dass momentan bereits für die kommenden Generationen die Väter und Mütter fehlen. Als Folge werden die jüngeren Jahrgänge immer mehr ausgedünnt, während die stärker besetzten Jahrgänge ins Rentenalter hineinwachsen. Dies führt dazu, dass der Alteraufbau mehr einem „henkellosen Krug“ gleicht, da die mittleren und jüngeren Jahrgänge zugunsten der älteren Jahrgänge abnehmen und sich so der „Altersquotient“ weiter verschlechtert.
Ausgehend von diesen Untersuchungsergebnissen suchen die Schüler nach möglichen Ursachen für diese anhaltende Entwicklung. Im engen Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung stehen auch aktuelle Herausforderungen im Bereich der Familienpolitik. „Es wird immer wieder zutreffend festgestellt, dass das System der Sozialpolitik Familien vielfach benachteiligt.“ Während etwa der Unterhalt der älteren Generationen durch sozialpolitische Umverteilung von der Gesellschaft getragen wird, obliegt der Unterhalt der Familien diesen überwiegend selbst. Zugleich profitiert aber die Gesellschaft von den verschiedenen Leistungen der Familie, nämlich allein dadurch, dass durch Kinder die Fortexistenz der Gesellschaft und der Sozialpolitik ermöglicht wird. Mit Hilfe verschiedener Fachaufsätze, Grafiken und Tabellen zur Sicherung und Zukunft der staatlichen Sozialpolitik sollen die Schüler mögliche Ursachen für die demografische Entwicklung erkennen, Auswirkungen auf die Sozialsicherungssysteme benennen und nach Lösungsstrategien suchen.
Inhaltsverzeichnis
- Bedingungsanalyse
- Innere Situation
- Äußere Situation
- Didaktisch-methodische Überlegungen und Begründungen
- Stellung der Stunde in der Stoffinheit
- Auswahl und Begründung der Inhalte
- Auswahl und Begründung der Lernziele
- Begründung der didaktischen Stufung des Unterrichts und des gewählten Methodenkonzeptes
- Geplanter Unterrichtsverlauf
- Literaturverzeichnis
- Anlagen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Stundenentwurf für die Lehrprobe im Fach Sozialkunde befasst sich mit der Frage, ob die demografische Entwicklung Deutschlands zu einer Veränderung der sozialen Sicherungssysteme führt. Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern ein grundlegendes Verständnis für die Zusammenhänge zwischen demografischem Wandel und sozialen Sicherungssystemen zu vermitteln. Der Entwurf zeigt auf, wie die demografische Entwicklung die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme beeinflussen kann und welche Anpassungsmaßnahmen in Erwägung gezogen werden müssen.
- Demografischer Wandel in Deutschland
- Soziale Sicherungssysteme in Deutschland
- Herausforderungen für die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme
- Mögliche Anpassungsmaßnahmen
- Politische und gesellschaftliche Debatten
Zusammenfassung der Kapitel
Bedingungsanalyse
Die Bedingungsanalyse befasst sich mit der inneren und äußeren Situation der Lerngruppe. Dabei wird auf die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler sowie auf die Ausstattung des Klassenzimmers eingegangen. Die Schülerinnen und Schüler zeigen sich im mündlichen Bereich stark und engagiert, während die schriftliche Leistungsfähigkeit noch ausbaufähig ist. Das Lern- und Sozialklima ist gut. Der Raum ist klein, aber ausreichend für die kleine Lerngruppe. Die Ausstattung ist jedoch spärlich.
Didaktisch-methodische Überlegungen und Begründungen
Dieser Abschnitt widmet sich der didaktischen und methodischen Planung der Unterrichtsstunde. Es werden die Stellung der Stunde in der Stoffinheit, die Auswahl der Inhalte und Lernziele, die didaktische Stufung des Unterrichts und das gewählte Methodenkonzept erläutert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themen der Arbeit sind: demografische Entwicklung, soziale Sicherungssysteme, Finanzierung, Herausforderungen, Anpassungsmaßnahmen, politische Debatten, gesellschaftliche Debatten.
- Quote paper
- Toralf Schenk (Author), 2004, Führt die demografische Entwicklung Deutschlands zu einer Veränderung der sozialen Sicherungssysteme?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/155657