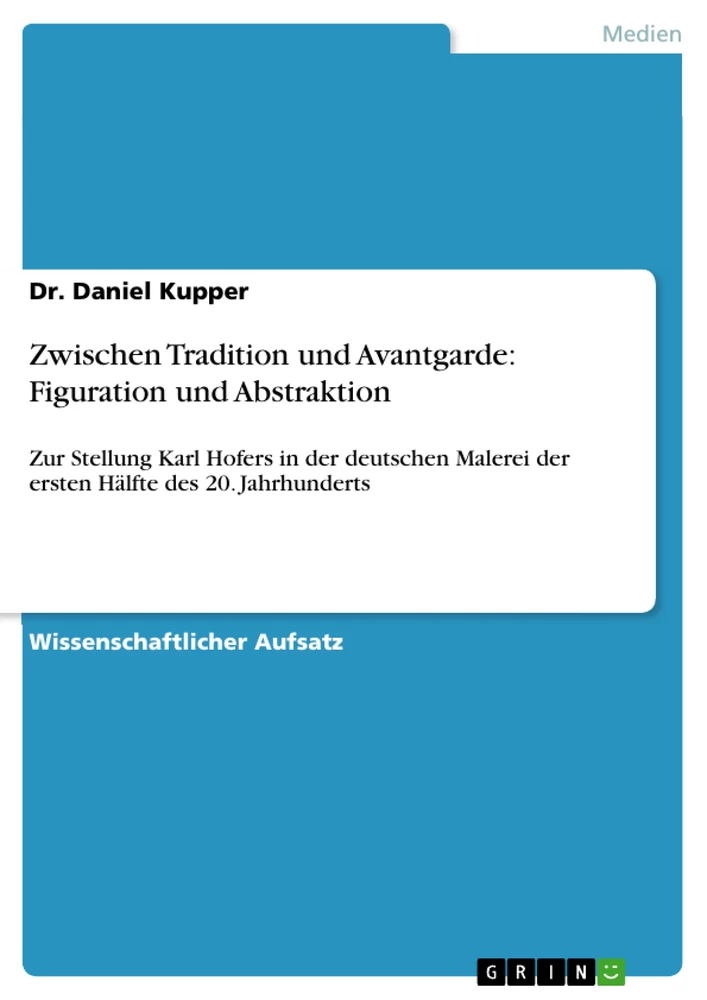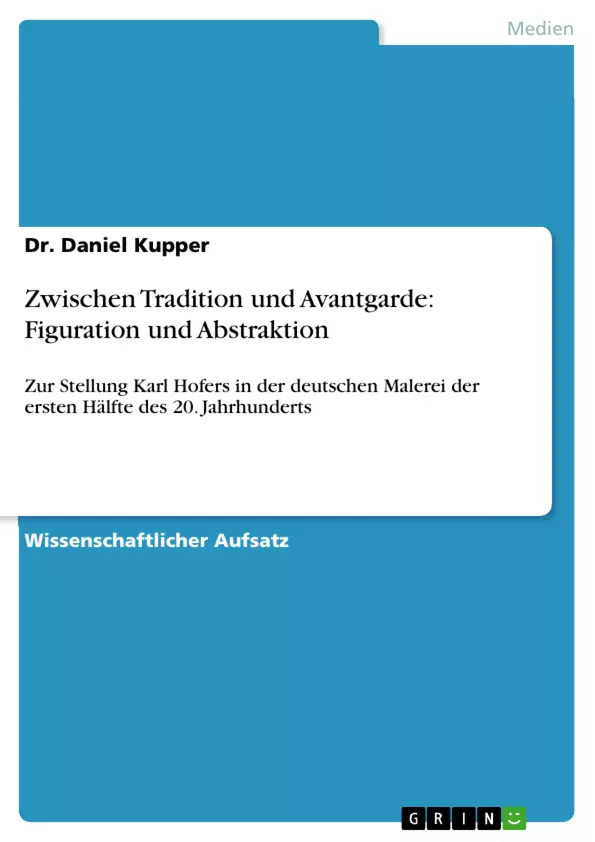Karl Hofer wurde bis ins späte 20. Jahrhundert hinein innerhalb der Kunstgeschichtsschreibung zumeist als Außenseiter betrachtet, der gegen den Strom der Zeit an einer "klassischen", plastisch-figurativen Malerei festgehalten und sich insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg gegen die nun aus Amerika nach Europa zurückschwappende Welle der abstrakten Kunst auch mit dem Wort gewehrt hat. Von einer eigentlichen oder gar intensiven Erforschung seines Werks kann nur in beschränktem Maß gesprochen werden, weil eine "eher volkstümlich geprägte Literatur zu Hofer vorherrschte." (Hartwig Garnerus)
Erst nach dem Jahrhundertwechsel (das lang ersehnte Werkverzeichnis erschien 2008) und mit einem neuen Blick auf die Entwicklung der Kunst und speziell der deutschen Malerei seit 1950 stellt sich bei der genauen Analyse heraus, dass die Malerei Hofers durch ihre feste Verwurzelung in der klassisch-idealistischen, deutsch-römischen Tradition, die durch die Natonalsozialisten missbraucht wurde und so nicht mehr bruchlos fortgeführt werden konnte, in Widerspruch zum allgemeinen Zeitgeist der Nachkriegszeit geriet. Dieser Widerspruch aber war so tief greifend und von allgemein bedeutender Natur, dass er nicht nur als Nachhall auf einige der nachfolgenden jungen deutschen Künstler gewirkt, sondern ihr Werk grundlegend geprägt hat. Damit nimmt Hofers Werk jenseits seiner bisweilen prophetischen Düsternis und enigmatischen Ikonographie eine zentrale Stellung innerhalb der deutschen figurativen Malerei im 20. Jahrhundert ein, die ohne die Frage nach dem schwierigen Umgang mit der "deutschen Kunst" und der "deutschen Tradition" insgesamt nicht zu verstehen wäre.
Inhaltsverzeichnis
- Zwischen Tradition und Avantgarde: Figuration und Abstraktion
- Zur Stellung Karl Hofers in der deutschen Malerei der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
- Der „paradiesische Traum“ des römischen Aufenthalts
- Hofer und die Deutsch-Römer
- Die Tradition der Deutsch-Römer im 19. Jahrhundert
- Das Werk Hofers als Bindeglied zwischen den Jahrhunderten
- Hofer und die Einflüsse seiner Zeit
- Die Suche nach dem Kunstgesetz
- Die beiden deutschen Wege in die Moderne
- Antiavantgardistische Reaktionen in Deutschland
- Der „politische Aufstand gegen die Moderne“
- Die Frage nach Tradition und Avantgarde nach 1945
- Das Darmstädter Gespräch über Figuration und Abstraktion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Stellung Karl Hofers in der deutschen Malerei der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie befasst sich mit der Frage, inwiefern Hofers Werk als Brücke zwischen den Traditionen des 19. Jahrhunderts und den modernen Strömungen des 20. Jahrhunderts betrachtet werden kann.
- Hofer als Vertreter einer „deutschen Tradition“
- Die Rolle der Deutsch-Römer und ihrer Einfluss auf Hofers Werk
- Hofer und die Moderne: Suche nach der Gestaltautonomie und der „schönen Gestalt“
- Der Einfluss von Marées und Fiedler
- Die Kontroverse um Figuration und Abstraktion im Nachkriegsdeutschland
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel widmet sich Hofers „paradiesischem Traum“ des römischen Aufenthalts und beleuchtet die Selbstverständlichkeit der deutschen Tradition, die erst durch die Weltkriege zerstört wurde.
- Im zweiten Kapitel wird die Tradition der Deutsch-Römer analysiert und die Frage gestellt, inwiefern sich dieser Begriff tatsächlich auf eine kohärente Künstlergruppe bezieht.
- Kapitel 3 behandelt die Bedeutung der Deutsch-Römer für die Entwicklung der deutschen Malerei im 20. Jahrhundert und zeigt Hofers Werk als Bindeglied zwischen den beiden Jahrhunderten.
- Kapitel 4 befasst sich mit den prägenden Einflüssen auf Hofers Werk, insbesondere den Einflüssen von Böcklin, Marées und Meier-Graefe.
- Kapitel 5 beleuchtet die Suche der späten Deutsch-Römer nach dem „Kunstgesetz“ und die Verlagerung von der künstlerischen Reproduktion zur Produktion von künstlerischer Wirklichkeit.
- Kapitel 6 befasst sich mit den beiden deutschen Wegen in die Moderne: der Suche nach der Gestaltautonomie bei Klee und der Betonung des „Flächen und Formgesetzen“ und der „schönen Gestalt“ im Werk Hofers.
- Kapitel 7 analysiert die antiavantgardistischen Reaktionen auf die Moderne in Deutschland und die „politische[n] Aufstand[e] gegen die Moderne“ im Nationalsozialismus.
- Kapitel 8 untersucht die Kontroverse um Figuration und Abstraktion im Nachkriegsdeutschland und das „Darmstädter Gespräch“ über den „Verlust der Mitte“.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen der deutschen Malerei im 20. Jahrhundert: Tradition, Avantgarde, Figuration, Abstraktion, Deutsch-Römer, Gestaltautonomie, Kunstgesetz, „schöne Gestalt“, Karl Hofer, Hans von Marées, Konrad Fiedler, Hans Sedlmayr, Darmstädter Gespräch, Verlust der Mitte.
- Quote paper
- Dr. Daniel Kupper (Author), 2010, Zwischen Tradition und Avantgarde: Figuration und Abstraktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/155632