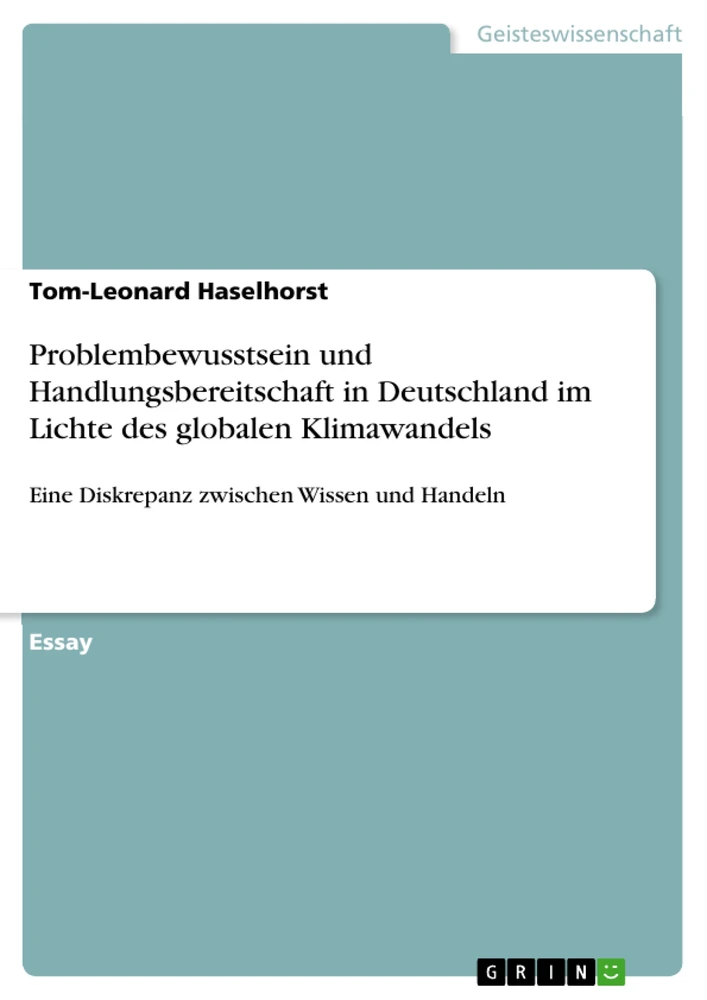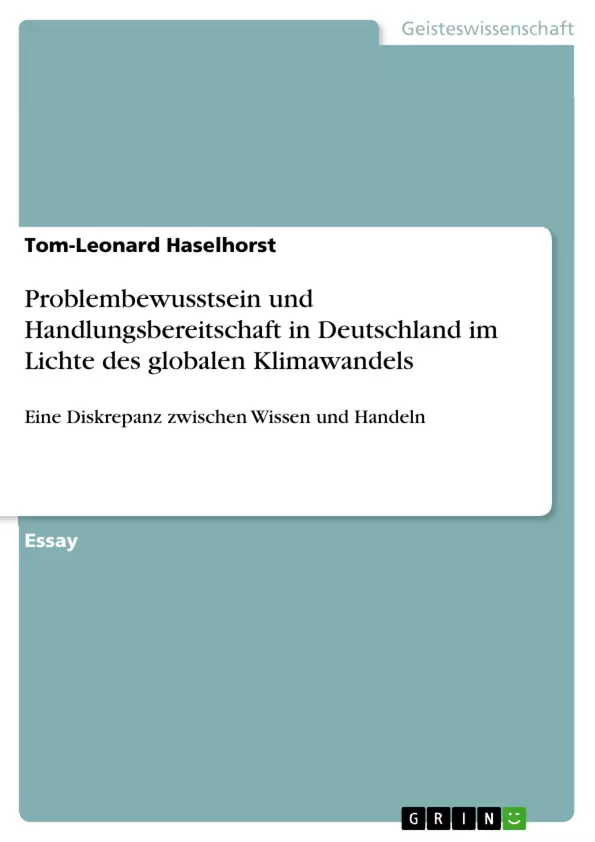Die Arbeit hat zum Ziel, Konsum- und Freizeitverhalten deskriptiv in den Kontext sozialwissenschaftlicher Komponenten wie Geschlecht, Einkommen und Bildungsniveau zu setzen, um anschließend die Frage aufzuwerfen, ob und wieso Menschen offenbar dazu tendieren, trotz der eigenen klimafreundlichen Einstellung dazu gegensätzliche Verhaltensmuster zu pflegen. Dieses als Attitude-Behaviour Gap bezeichnete Phänomen soll den Schluss der inhaltlichen Arbeit setzen, bevor in einem abschließenden Fazit noch einmal zentrale Erkenntnisse unterstrichen werden.
Der Arbeit liegt zunächst jedoch die These zugrunde, dass sich Haushalte mit höherer Bildung und besserem Wissen über die sogenannte Klimakrise auch daran angepasst klimafreundlicher verhalten als bildungsferne Haushalte.
Insgesamt muss berücksichtigt werden, dass die Ausarbeitung das hiermit behandelte, höchst komplexe Themenfeld allein schon aufgrund ihres begrenzten Volumens lediglich anreißen und grob einführen kann. Mögliche kritische Hinweise oder Ergänzungen zu Begriffen, Studien oder Forschungstexten behalte ich mir vor in den Fußnoten zu vermerken, um den Lesefluss nicht zu stören.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Der Klimawandel als zentrale gesellschaftliche Herausforderung der Moderne
- III. Konsum- und Freizeitverhalten im Lichte sozio-ökonomischer Faktoren
- III.I. Der Klimawandel und seine Dringlichkeit im Bewusstsein der Deutschen
- III.II. Konsum von Fleisch und Tierprodukten
- III.III. Konsum und Nutzung von PKWs
- III.IV. Urlaubs- bzw. Reiseverhalten
- IV. Attitude-Behaviour Gap
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Diskrepanz zwischen dem Problembewusstsein für den Klimawandel und dem tatsächlichen klimafreundlichen Handeln in Deutschland. Sie analysiert den Zusammenhang zwischen sozioökonomischen Faktoren wie Bildung und Einkommen und dem Konsum- sowie Freizeitverhalten der Bevölkerung im Hinblick auf den Klimawandel. Die Arbeit zielt darauf ab, die Ursachen für das sogenannte Attitude-Behaviour Gap zu ergründen.
- Der Klimawandel als gesellschaftliche Herausforderung
- Problembewusstsein für den Klimawandel in verschiedenen Bevölkerungsgruppen
- Einfluss sozioökonomischer Faktoren auf Konsum- und Reiseverhalten
- Analyse des Attitude-Behaviour Gaps im Kontext des Klimawandels
- Zusammenhang zwischen Wissen, Einstellung und Handeln im Bereich Klimaschutz
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Diskrepanz zwischen Problembewusstsein und Handlungsbereitschaft im Umgang mit dem Klimawandel in den Mittelpunkt. Sie betont die Bedeutung des Themas angesichts globaler Herausforderungen und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die These, dass Haushalte mit höherer Bildung und besserem Wissen über die Klimakrise sich klimafreundlicher verhalten, wird formuliert. Die begrenzte Reichweite der Arbeit aufgrund ihres Umfangs wird ebenfalls angesprochen.
II. Der Klimawandel als zentrale gesellschaftliche Herausforderung der Moderne: Dieses Kapitel beleuchtet die Auswirkungen des Klimawandels auf das menschliche Leben, basierend auf dem sechsten Sachstandsbericht des Weltklimarates. Es werden konkrete Folgen wie zunehmende Extremwetterereignisse, Bedrohung der Nahrungsmittelsicherheit und negative Auswirkungen auf die physische und mentale Gesundheit der Bevölkerung hervorgehoben. Die Dringlichkeit des Problems und die Notwendigkeit eines gegensteuernden Trends werden betont, um den Übergang zum nächsten Kapitel zu ebnen, welches die Diskrepanz zwischen Bewusstsein und Handeln thematisiert.
III. Problembewusstsein, Konsum- und Reiseverhalten nach sozio-ökonomischen Faktoren: Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen Problembewusstsein, Konsumverhalten (Fleischkonsum, PKW-Nutzung) und Reiseverhalten sowie sozioökonomischen Faktoren wie Bildung und Einkommen. Es werden Studien und Statistiken herangezogen, um den Stand des Problembewusstseins in der deutschen Bevölkerung zu beleuchten und Unterschiede zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen aufzuzeigen. Der Fokus liegt dabei auf der Darstellung von Tendenzen und der Erläuterung der komplexen Zusammenhänge.
III.I. Der Klimawandel und seine Dringlichkeit im Bewusstsein der Deutschen: Dieser Abschnitt analysiert das Problembewusstsein bezüglich des Klimawandels in der deutschen Bevölkerung anhand von Studien. Es wird ein leichter Anstieg des Problembewusstseins festgestellt, wobei jedoch deutliche Unterschiede zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen (Geschlecht, Alter, Region, Bildung, politische Einstellung) bestehen. Es werden Daten zu den unterschiedlichen Wahrnehmungsebenen vorgestellt, um den komplexen Sachverhalt zu veranschaulichen.
III.II. Konsum von Fleisch und Tierprodukten: Dieser Abschnitt befasst sich mit dem Einfluss des Konsums von Fleisch und Tierprodukten auf den Klimawandel. Es wird die hohe Umweltbelastung der Tierhaltung im Vergleich zum Verkehrssektor hervorgehoben und die Notwendigkeit einer veränderten Konsumweise im Hinblick auf nachhaltiges Handeln diskutiert. Die Zusammenhänge werden anhand von Statistiken und wissenschaftlichen Quellen erläutert.
Schlüsselwörter
Klimawandel, Problembewusstsein, Handlungsbereitschaft, Attitude-Behaviour Gap, Konsumverhalten, Freizeitverhalten, sozioökonomische Faktoren, Bildung, Einkommen, Deutschland, Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text "Inhaltsverzeichnis, Zielsetzung, Themenschwerpunkte, Zusammenfassung der Kapitel, Schlüsselwörter"?
Der Text gibt einen Überblick über eine akademische Arbeit, die sich mit dem Klimawandel als gesellschaftliche Herausforderung in Deutschland auseinandersetzt. Er enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste von Schlüsselwörtern.
Was sind die Hauptthemen der Arbeit?
Die Arbeit konzentriert sich auf den Klimawandel, das Problembewusstsein in der Bevölkerung, den Einfluss sozioökonomischer Faktoren auf das Konsum- und Reiseverhalten und die Analyse des Attitude-Behaviour Gaps (die Diskrepanz zwischen Einstellung und Verhalten) im Kontext des Klimawandels.
Was ist das Attitude-Behaviour Gap, das in der Arbeit untersucht wird?
Das Attitude-Behaviour Gap bezieht sich auf die Diskrepanz zwischen dem Bewusstsein für den Klimawandel und dem tatsächlichen klimafreundlichen Handeln der Menschen. Die Arbeit versucht, die Ursachen für diese Diskrepanz zu ergründen.
Welche Faktoren beeinflussen das Konsum- und Reiseverhalten im Hinblick auf den Klimawandel?
Die Arbeit untersucht den Einfluss sozioökonomischer Faktoren wie Bildung und Einkommen auf das Konsumverhalten (insbesondere Fleischkonsum und PKW-Nutzung) und das Reiseverhalten.
Welche Kapitel sind in der Arbeit enthalten und was sind die jeweiligen Schwerpunkte?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel:
- Einleitung: Einführung in das Thema und Formulierung der Forschungsfrage.
- Der Klimawandel als zentrale gesellschaftliche Herausforderung der Moderne: Darstellung der Auswirkungen des Klimawandels.
- Problembewusstsein, Konsum- und Reiseverhalten nach sozio-ökonomischen Faktoren: Analyse des Zusammenhangs zwischen Bewusstsein, Verhalten und sozioökonomischen Faktoren.
- Der Klimawandel und seine Dringlichkeit im Bewusstsein der Deutschen: Analyse des Problembewusstseins bezüglich des Klimawandels in der deutschen Bevölkerung.
- Konsum von Fleisch und Tierprodukten: Auswirkungen des Konsums von Fleisch und Tierprodukten auf den Klimawandel.
Welche Schlüsselwörter werden im Zusammenhang mit der Arbeit genannt?
Zu den Schlüsselwörtern gehören Klimawandel, Problembewusstsein, Handlungsbereitschaft, Attitude-Behaviour Gap, Konsumverhalten, Freizeitverhalten, sozioökonomische Faktoren, Bildung, Einkommen, Deutschland, Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein.
- Quote paper
- Tom-Leonard Haselhorst (Author), 2022, Problembewusstsein und Handlungsbereitschaft in Deutschland im Lichte des globalen Klimawandels, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1555818