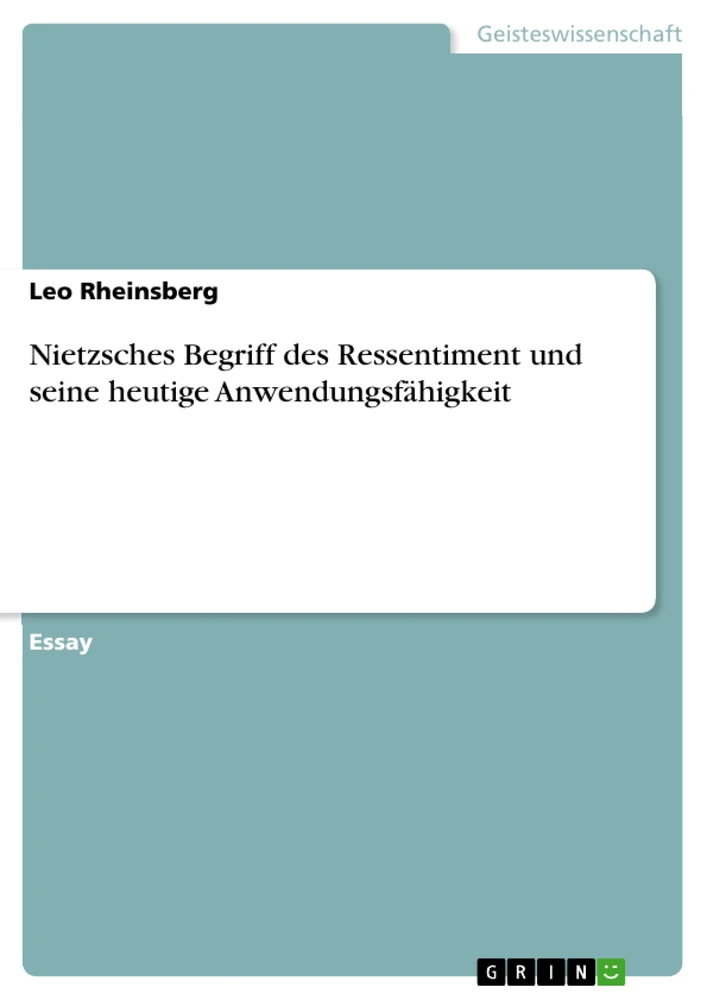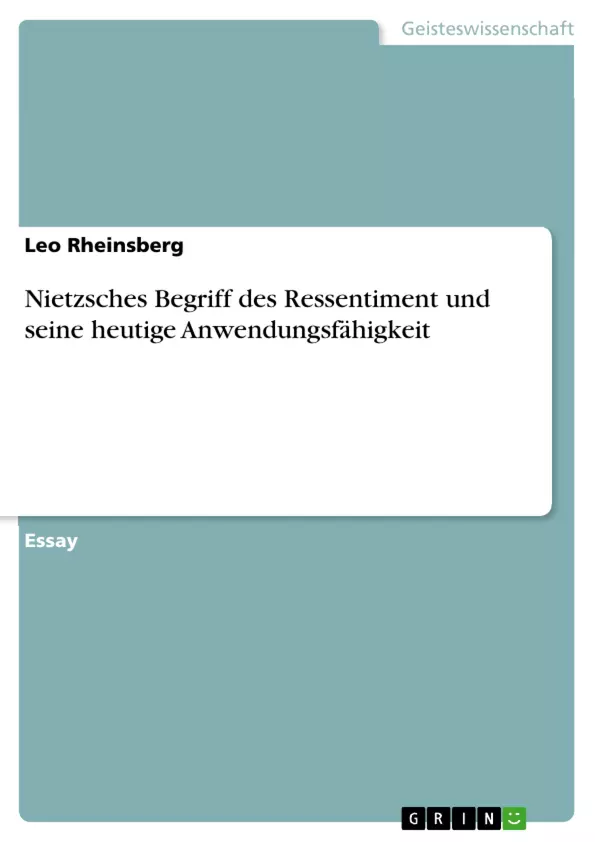Um dem Verstehen Nietzsches näher zu kommen, muss seine Art des Schaffens bedacht werden – Nietzsche ist nur Nietzsche, wenn wir sein Werk als ganzes und experimentelles betrachten und zugleich jeden Satz für sich. Vermutlich ist letzteres beinahe unmöglich und gäbe es ein Resultat auf diese Betrachtungsweise, würde es vermutlich nicht in diesen Essay passen. Somit begnüge ich mich damit punktuell zu arbeiten und den Kontext ausschnittsweise zu beachten. Meine Überlegungen gelten dabei der Relevanz, der Geschichte, der Weiterentwicklung und der heutigen Anwendbarkeit vom Begriff des Ressentiment.
Nietzsches Begriff des Ressentiment und seine heutige Anwendungsfähigkeit
Um dem Verstehen Nietzsches näher zu kommen, muss seine Art des Schaffens bedacht werden - Nietzsche ist nur Nietzsche, wenn wir sein Werk als ganzes und experimentelles betrachten und zugleich jeden Satz für sich. Vermutlich ist letzteres beinahe unmöglich und gäbe es ein Resultat auf diese Betrachtungsweise, würde es vermutlich nicht in diesen Essay passen. Somit begnüge ich mich damit punktuell zu arbeiten und den Kontext ausschnittsweise zu beachten. Meine Überlegungen gelten dabei der Relevanz, der Geschichte, der Weiterentwicklung und der heutigen Anwendbarkeit vom Begriff des Ressentiment.
Nietzsche prägte zahlreiche Begriffe, doch keiner erscheint mir für das Heute so relevant wie der Begriff des Ressentiment, das was sich in diesem verbirgt und wie dieser in der Gegenwart, welche durch zunehmende Digitalisierung geprägt ist, Anwendung findet und wirkt. Was mit der Gesellschaft seit der Entstehung des Internets geschieht, ist ein fortwährend beschleunigter Wandel. Dieser nimmt in einer solchen Geschwindigkeit zu, wie sich die Technik weiter entwickelt und wie die Digitalisierung im Alltag und Leben der Menschen zunehmend Raum einnimmt. Gleichzeitig wirken jahrhundertealte Verhältnisse der ungleichen Verteilung von Macht und Kapital mit ihren vielfältigen Begleiterscheinungen wie des wachsenden Populismus, der steigernden Polarisierung und des damit einhergehenden, global zunehmenden, Rechtsextremismus. Diese Begleiterscheinungen haben sich sich im Online-Zeitalter verschärft, genau wie die ihnen zu Grunde liegende Konzentration von Macht und Kapital (vgl. Andree & Thomsen 2020: 29f). Es handelt sich also um Verhältnisse von Ungleichheit, die seit jeher die Ausprägung von Ressentiment begünstigt haben und sogleich um eine Gegenwart, die in dieser Form ohne Ressentiment vermutlich nie entstanden wäre.
Ab 1886 mit Jenseits von Gut und Böse und der daran anschließenden noch deutlicheren (Streit-)Schrift Zur Genealogie der Moral, die 1887 erschienen ist, fokussiert sich Nietzsche auf die Herkunft und Kritik der jüdisch-christlichen Werte und ihrer Moral, die seiner Zeit in Europa vorherrschend war.
Das Wort Ressentiment kommt aus dem Französischen und steht für das Wiederfühlen von etwas zuvor im Leben schon Gefühltem. Nietzsche fügt dem Begriff in seiner Streitschrift Zur Genealogie der Moral noch seinen eigenen Sinn dieses Begriffes hinzu und entwickelt ihn als einen Chiffrebegriff zu seiner Genealogie der Moral. Nach Nietzsche ist das Ressentiment ein moralisch armseliges Gefühl, das es zu überwinden gilt.
Was steht dem Ressentiment zu Grunde, wie transportiert und wie manifestiert es sich?
Am Anfang des Ressentiment steht der nach außen verneinende und in „Abneigung gegen s i c h“ gestellte Wille zur Macht (vgl. Nietzsche 1964: 113) und dessen scheinbare Unerreichbarkeit. Der „Mensch des Ressentiment“ strebt aufgrund seiner ursprünglichen Machtlosigkeit die „indirekte Machtergreifung über das Leben der Anderen“ (ebd.: 27) an und der verlogene Wille zur Macht tritt in der „Sklaven Moral“ in Erscheinung (vgl. ebd.: 25). „Aber alle Zwecke, alle Nützlichkeiten sind nur Anzeichen davon, dass ein Wille zur Macht über etwas weniger Mächtiges Herr geworden ist und ihm von sich aus den Sinn einer Funktion aufgeprägt hat“ (ebd.: 60). Der Wille zur Macht liegt also auch dem Ressentiment zugrunde, nur eben in einer durch diejüdisch-christliche Moral vergifteten Form (vgl. ebd.: 97).
So steht Ressentiment bei Nietzsche für ein Gefühl, welches Mutlose, Schwache und Beherrschte, „denen die eigentliche Reaktion, die der Tat versagt ist“ (ebd.: 25), den Starken und Herrschenden gegenüber empfinden. Bei Nietzsche entsteht Ressentiment somit nur von „Unten“ nach „Oben“. Es wird eine eigene Minderwertigkeit empfunden auf welche der Neid folgt. Neid dem Gegenüber, was als stärker und schöner gesehen wird, wobei sogleich dieses beneidete Höherstehende (scheinbar unerreichbare) schlechtgeredet und abgewertet wird, um sich selbst mehr Wert zu geben und moralisch aufzubessern. So wird also „das R e s s e n t i ment selbst schöpferisch“ (ebd.: 25) und bringt damit eine „Umkehrung des werte-setzenden Blicks“, was als ein Kennzeichen der Sklaven-Moral gilt (vgl. ebd.: 26). Der „Mensch des Ressentiment“ hat als Grundlage für sich selbst als den „Guten“, „den Bösen“ Anderen entworfen, der ohne mit dem „Giftauge des Ressentiment“ gesehen jedoch der eigentlich „Gute“ ist, also „der Vornehme, der Mächtige, der Herrschende“ (ebd.: 28). Er denkt sich als ein „Nachbild“ und nicht als das „Original“, sein Selbst ist eine Ableitung des Anderen (vgl. ebd.: 28). Dabei ist der „Mensch des Ressentiment“ sich selbst ein Feind sowie seines Gleichen (in der „kranken Herde“) und allen anderen Menschen (vgl. ebd.: 105). In diesem Zusammenhang ist der „asketische Priester“ (der selber krank ist) der „vorherbestimmte Heiland, Hirt und Anwalt der kranken Herde“ (vgl. ebd. 104). Er ist es, der seine kranke Herde gegen die Gesunden verteidigt (vgl. ebd. 105) und auch gegen die drohende Selbstzerstörung, die der kranken Herde selbst zu eigen ist:
Er verteidigt in der Tat gut genug seine kranke Herde, dieser seltsame Hirt, - er verteidigt sie auch gegen sich, gegen die in der Herde selbst glimmende Schlechtigkeit, Tücke, Böswilligkeit und was sonst allen Süchtigen und Kranken unter einander zu eigen ist, er kämpft klug, hart und heimlich mit der Anarchie und der jederzeit beginnenden Selbstauflösung innerhalb der Herde, in welcher jener gefährlichste Spreng- und Explosivstoff, das Ressentiment, sich beständig häuft und häuft. Diesen Sprengstoff so zu entladen, dass er nicht die Herde und nicht den Hirten zersprengt, das ist sein eigentliches Kunststück. (Nietzsche 1964: 105f)
Der Mensch des Ressentiments braucht für die Rache eine Affektentladung (als „B e t ä u b u n g s - Versuch“ auf Grund seines Leids) „einen für Leid empfänglichen schuldigen Täter“ (Nietzsche 1964: 106). „Hierin allein ist, meiner Vermutung nach, die wirkliche physiologische Ursächlichkeit des Ressentiment, der Rache und ihrer Verwandten, zu finden, in einem Verlangen also nach Betäubung von Schmerz durch Affekt“ (ebd.: 106). Doch der Priester verbiegt die Richtung des Ressentiment, er drängt es zurück, indem er zum Leidenden sagt: „du selbst bist an dir allein schuld!“ (ebd.: 107). Dement - sprechend scheitert die Rache und die Demütigung wird permanent. In der fortwährenden Selbstvergiftung des leidenden Menschen nimmt das Ressentiment dauerhaft zu und so gedeiht die Ressentiment-Moral. Im Gegensatz dazu vergiftet das Ressentiment den „Vornehmen“ nicht, denn es „vollzieht und erschöpft sich nämlich in einer sofortigen Reaktion“ (ebd.: 27) - somit vergeht es direkt, wenn es doch einmal bei ihm auftritt.
Wenn Nietzsches Theorie des Ressentiment auf die Gegenwart bezogen wird zeigt sie allerdings eine Serie signifikanter Defizite. Erstens ist jener Begriff des Ressentiment ausschließlich ein negativer beziehungsweise ein herabsetzender. Die Asymmetrie, die sich darin zeigt, zeugt von Nietzsches eigenem Ressentiment gegenüber denen er den Begriff anwendet. Seine Verachtung entgegen der Masse oder dem gemeinen Volk, demokratischen Neigungen und Entwicklungen beziehungsweise im besonderen das Prinzip politischer Repräsentation, lässt wissenschaftliche Objektivität und Neutralität (oder zumindest einen Anspruch in diese Richtung) im genannten Zusammenhang vermissen. Zweitens zeigen sich in Nietzsches Demokratieverständnis große Dissonanten zum heutigen. Das was Nietzsche unter Demokratie fasst, könnte nach heutiger Definition eher einer Demokratie gleichkommen, die von Populisten oder einem populistischen Regime regiert wird. Dies entspricht einem Staat, in dem eine wütende Mehrheit von Menschen des Ressentiment politische Repräsentantinnen aufgrund ihrer Vorurteile, Neid und Rachegefühlen wählt. Sodann trifft diese beim Regieren Entscheidungen gegen Minderheiten und entzieht diesen ihre (in heutigen Demokratien üblichen) Rechte. Drittens geht Nietzsches Begriff von Ressentiment nur in eine Richtung, von der großen unteren Masse der Menschen zur herrschenden Elite oder eben von „Schwachen und Ohnmächtigen“ zu „vornehmen Menschen“ , wie er schreibt (vgl. ebd. 27f). Beim Betrachten von heutigen politischen Entwicklungen, zum Beispiel rechts-populistischen Bewegungen, zeigt sich jedoch, dass sich Negativgefühle, Hass oder auch etwas, was sich im gegenwärtigen Verständnis (siehe weiter unten im Text) von Ressentiment fassen lässt, auch zwischen Minderheiten (beziehungsweise im weitesten Sinne Machtlosen) selbst stattfindet. Rechtspopulistische Führer wie Jair Bolsonaro (Brasilien), Viktor Orbân (Ungarn), Recep Tayyip Erdogan (Türkei) und Boris Johnson (England) gehören zu den Mächtigen und Herrschenden (im Falle von Bolsonaro und Orbân auch zu den konservativ christlichen), sie sind jedoch selbst meist nicht vom Ressentiment der Massen betroffen und verstehen es, eher Machtlose und Minderheiten gegeneinander aufzuhetzen und die Gesellschaft zu spalten und somit selbst Ressentiments in der Gesellschaft zu schüren.
Viertens ist die Kirche nicht mehr so mächtig und einflussreich wie zu Nietzsches Zeit. Auch die Rolle des „asketischen Priesters“, so wie Nietzsche sie beschrieben hat (vgl. ebd. 104ff), ist nicht mehr dominant. Jene, die heute (nach unten und/oder oben gerichtete) Ressentiments schüren, zumindest in den verbreiteten rechts-populistischen Bewegungen, sind alles andere als asketisch, sie sind eher protzende und verschwenderische, charismatische Egomanen oder narzisstische Chauvinisten im Stil eines Donald Trump oder Boris Johnson.
Insofern lassen sich mit Nietzsches Ressentiment Begriff die heutigen politischen Verhältnisse nicht in ihrer Gänze analysieren. Doch es zeigen sich Parallelen bestimmter Aspekte des Begriffs, welche als Basis eines den heutigen Umständen entsprechend sinnigen Begriff des Ressentiment fungieren. Dazu gehören unter anderem die von dem Literatur- und Kulturwissenschaftler Joseph Vogl vorgestellten vier Punkte: (1) die „gebrochene Selbstaffirmation“ womit gemeint ist, dass die verneinende Abgrenzung zum Anderen erst das eigene Selbst konstruiert. (2) Die „Kultivierung von Ohnmacht“, welche durch das nicht von sich Selbst aus aktive Handeln zustande kommt und der Nichtausführung des Ersatzes, also des Reagierens auf Andere und die darin entstandene Anhäufung des Nichthandelns. Die führt zu einem inneren „Handlungsstau“, welcher eine zunehmende und permanent wiederkehrende Frustration aufbaut. (3) Die „Neigung zu Delegierung“ und die damit verbundene „Straffreudigkeit“ in der Gestalt, dass sich durch die Lähmung der eigenen Handlungsaktivität und dem damit entstandenen „Handlungsstau“ ein Drang zur Bestrafung der Anderen entfaltet, die durch eine gewählte Autorität ausgeführt werden soll. (4) Eine personalisierende Schuldzuschreibung, ohne die tiefere Auseinandersetzung mit den gegebenen Umständen, denn „[...] das Ressentiment kommt mit der Ungewissheit von Verursachungen nicht zurecht.“ (Vogl 2021: 161f).
Mit dem obigen Erklärungen des Begriffs Ressentiment kann zumindest in die negative Richtung der Begriffsanwendung, dem gegenwärtigen Verständnis und seiner Aktualität weitergedacht werden. Die neutrale Verwendung ist eine, die Nietzsche nicht beschreibt. Dabei liegt die Vermutung nahe, dass bestimmte Formen von Ressentiment bei allen Menschen auftreten und es entscheidend ist ,wie damit im Einzelfall umgegangen wird. Eine dialektische Herangehensweise im Sinne von 'um so größer die Spannung, desto größer das Potential' kann möglicherweise auch Ressentiments als Chance nutzen und sie weiterverarbeiten zur progressiven Möglichkeitsentfaltung.
Doch auch in der Verwendung im Kontext eines zu bewältigenden Missstandes kann der Begriff des Ressentiment eine konstruktive Wirkung entfalten beziehungsweise als Hilfsmittel zur Überwindung dessen, was als Grundlage für Ressentiment beschrieben ist, beitragen.
Hierbei kommt esjedoch auf die Kontingenz des Begriffes in seinem Kontext an, was darüber gesteuert wird wie klar er definiert ist und wie sich diese Definition im Zeitverlauf und den Anwendungsgebieten wechselseitig entwickelt.
Der von dem Antisemiten Martin Heidegger im Nachruf zur stärksten Kraft der Philosophie in Deutschland und der Welt gekürte Max Scheler (vgl. Heidegger 1928: 9), was sicherlich übertrieben ist, war einer derjenigen, der nach Nietzsche an dessen Verständnis von Ressentiment anknüpfte und weiter gearbeitet hat. Dabei hat sich Scheler teilweise auch schon über Umwege auf Nietzsches Ressentiment-Begriff bezogen, etwa in Bezug auf den Antisemiten Werner Sombart (vgl. Scheler 1978: 8). Scheler hatte bei allem abzulehnenden Antisemitismus und kriegsbegeisterten Nationalismus (vgl. ebd.: 3, 106) dennoch wichtige Arbeit geleistet, um den Begriff gewissermaßen noch bis heute schlüssig zur Anwendung bringen zu können. Schelers 1912 erschienene Studie zum Ressentiment im Aufbau der Moralen stellt fest, dass das Ressentiment auch außerhalb von Nietzsches Idee des unterdrückten Menschen stattfindet und dass kapitalistische Besitzverhältnisse in Verbindung mit Logiken eines Konkurrenzsystems und „Werttäuschung“ eine grundlegende Rolle spielen (vgl. ebd.: 9f, 14, 17). Die Größe der Diskrepanz zwischen formaler Gleichheit und realer Ungleichheit ist dabei mitbestimmend, welches Potential der Entstehung und der Art der Ausbildung von Ressentiment zu Grunde liegt, so Scheler (vgl. ebd.: 9f).
Wo große Unterschiede bei Vermögen, Eigentum und Macht herrschen und diese rasant zunehmen, wie gegenwärtig global zu beobachten ist (vgl. Oxfam 2021), wirkt es nach dieser Auffassung doch gerade so, dass Bewegungen und Parteien, die von Ressentiments erfüllt sind und Ressentiments schüren (scheinbar) eine notwendige Begleiterscheinung sind, oder ihnen, auch Aufgrund des Ressentiment, gar eine erhaltende Rolle des Status quo zukommt. Als Beispiele sind hier die CDU/CSU, AfD und Pegida zu nennen. Es sind vor allem rechtsnationalistische Parteien oder Bewegungen, die von diesen Umständen profitieren und dessen Individuen denken oder vorgeben zu denken, dass sie eine Antwort auf die Auswirkungen kapitalistischer Verhältnisse liefern können.
Es mutet zunächst paradox an, dass eben diese Schürenden des Ressentiments Anhängerinnen finden. Sind es doch eben diese, welche Ungleichheiten mit zu verantworten haben. Doch mit der Logik des Ressentiment ist dies teilweise erklärbar. Auch und gerade in Verbindung mit dem eingangs schon erwähnten Wandel den das Internet die letzten zwei Jahrzehnte gebracht hat. Dieser Wandel ist sehr facettenreich, komplex und von eigenen Dynamiken geprägt. Exemplarisch ist hier zu nennen: Der massive Rückgang traditioneller (Massen-)Medi- en wie Zeitung, Radio und Fernsehen, welche mehr und mehr den Onlinemedien gewichen sind, welche wiederum eine neue Art der Öffentlichkeit geschaffen haben.
Die ehemals zentralistischen und zur Partizipation nur professionell ausgebildetem Personal vorbehaltenen traditionellen Medien, boten der Öffentlichkeit eine gänzlich andere Basis und Qualität zu und von Informationen. Die jetzige Struktur des Internets bietet jedem Menschen, der Zugang zu diesem hat, mehr Möglichkeiten der Partizipation, des selbst Publizierens und eine beinahe unendliche Fülle an Informationen und Nachrichten, die im Falle der Sozialen Medien (wie etwa Facebook) nicht dem Pressekodex von Faktenlage und wissenschaftlicher Korrektheit folgen müssen. Dabei sind es gerade Falschmeldungen, Verschwörungserzählungen und negative Nachrichten, die sich am schnellsten und weitesten verbreiten und in Verbindung mit anderen Gegebenheiten der digitalen Welt (wie z.B.: Echokammern und Filterblasen) die Öffentliche Meinung mitbeeinflussen und gleichzeitig das Empfinden von eigener Ohnmacht steigern (vgl. Stöcker & Lischka 2018: 381f; vgl. Tillmann 2018: 34). Es zeigt sich also, dass all dies die Mechanismen des Ressentiments bedient, als Ressentiment-Verstärker wirkt und der Mensch gerade in der digitalen Welt ressentimentgeladene Gedanken ausprägt (vgl. Vogl 2021: 129ff, 177ff). Auch deshalb ist die Auseinandersetzung mit dem Begriff des Ressentiment derzeit erforderlich.
Um Ursachen eines von der unteren Klasse zur herrschenden Klasse, aber auch umgekehrt, gezielten Moralismus zu finden, lohnt sich die Auseinandersetzung mitNietzsches Begriff des Ressentiment und wie er weiterentwickelt wurde. Auch die affektive Seite des Moralisierens, von populistischen und rechtsextremistischen Bewegungen, ist über den Umweg des Ressentiment lückenloser zu begreifen - es müsste an dieser Stelle jedoch noch wesentlich mehr Forschung im Bereich der Philosophie und Soziologie in Zusammenarbeit mit der Informatik stattfinden.
Außerdem fände ich es vielversprechend, mögliche Verbindungen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Bezug auf Ressentiments in verschiedenen Milieus zu untersuchen, wie diese konstitutiv für den jeweiligen Habitus sind und wie dieser sich dann erhaltend auf gegebene Macht- und Kapitalasymmetrien auswirkt.
Literatur
Andree, Martin; Thomsen, Timo (2020): Atlas der digitalen Welt. Frankfurt am Main: Campus.
Heidegger, Martin (1928): Nachruf „Andenken an Max Scheier“. In: Paul Good (Hrsg.) Max Scheler im Gegenwartsgeschehen derPhilosophie. Bern 1975.
Nietzsche, Friedrich (1964): Zur Genealogie der Moral. Gesammelte Werke 9. München: Wilhelm Goldmann Verlag.
Oxfam (2021): „Soziale Ungleichheit“. https://www.oxfam.de/unsere-arbeit/themen/soziale- ungleichheit [zuletzt aufgerufen am 04.10.2021].
Scheier, Max (1978): DasRessentiment imAufbau derMoralen. Frankfurt am Main: Klostermann.
Stöcker, C.; Lischka, K. (2018): „Wie algorithmische Prozesse Öffentlichkeit strukturieren“. In R. Mohabbat Kar; B.E. P. Thapa; P. Parycek (Hrsg.) (Un)berechenbar? Algorithmen und Automatisierung in Staat und Gesellschaft. Berlin: Fraunhofer-Institut für Offene Kommuni- kationssystemeFOKUS, Kompetenzzentrum Öffentliche IT(ÖFIT), S.364-391. https://nbn-re- solving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-57598-9 [zuletzt aufgerufen am 05.10.2021].
Tillmann, Angela (2018): „Politische Medienbildung in digitalen Medienwelten: Digitales Informations- und Meinungsbildungsverhalten Jugendlicher“. In T. Hug (Hrsg.) Medienpädagogik Herausforderungen für Lernen und Bildung im Medienzeitalter. Innsbruck: innsbruck university press.
Vogl, Joseph (2021): Kapital und Ressentiment. Eine kurze Theorie der Gegenwart. München: C.H.Beck.
[...]
- Quote paper
- Leo Rheinsberg (Author), 2021, Nietzsches Begriff des Ressentiment und seine heutige Anwendungsfähigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1554470