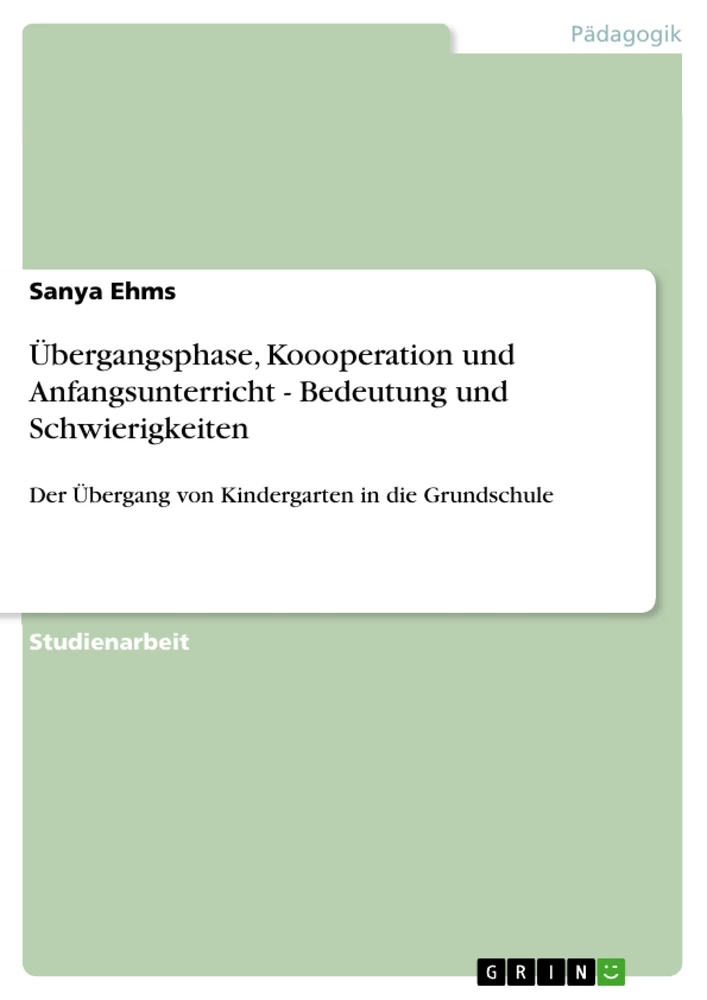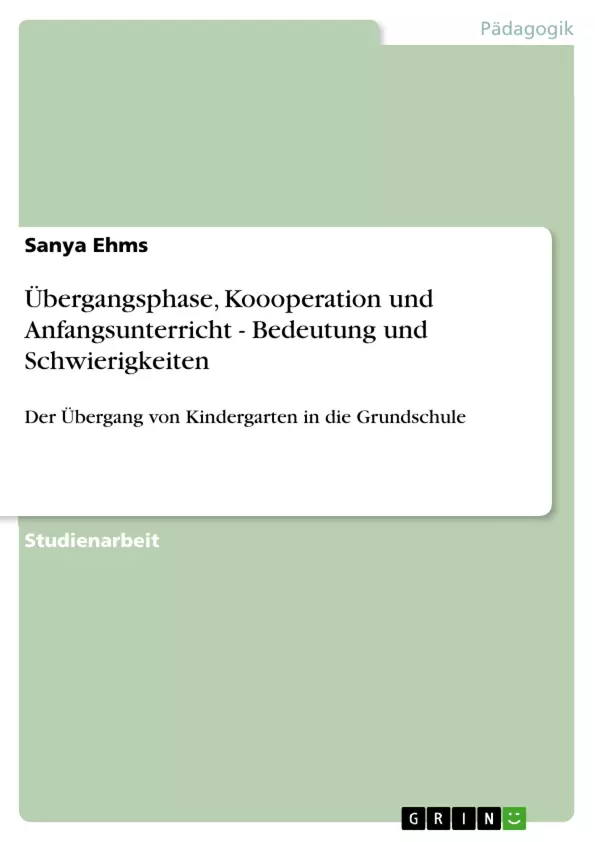Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Bildungsaufträge von Kindergarten und Grundschule
3. Die Übergangsphase und ihre Bedeutung
4. Anfangsunterricht – Probleme und Lösungsansätze
5. Störungen innerhalb der Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule
6.Lösungsvorschläge für eine Kooperation von Kindergarten und Grundschule
7. Elternarbeit – Kooperation der Eltern mit Kindergarten und Grundschule
8.Abschließendes Fazit
9.Erklärung
10. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Der Übergang vom Kindergarten zur Grundschule gewinnt immer mehr an Bedeutung, da er für die weitere Entwicklung der Kinder entscheidend ist.
In meiner Hausarbeit gehe ich deshalb zunächst auf die unterschiedlichen Bildungsaufträge der beiden Institutionen ein. Daraufhin setze ich mich mit dem Übergang auseinander und gehe gezielt auf die Probleme ein, welche in dieser wichtigen Phase auftreten können. In dem darauf folgenden Kapitel, beschäftige ich mich mit der Zusammenarbeit der Institutionen Kindergarten und Grundschule. Ich benenne Gründe warum diese Kooperation für den Übergang wichtig ist und wo Schwierigkeiten bestehen bzw. aufkommen können. Des Weiteren gehe ich auf den schulischen Anfangsunterricht ein und beleuchte die Schwierigkeiten, die sich aus diesem ergeben können, wenn die Übergangsphase zwischen Kindergarten und Grundschule ohne Kooperation vollzogen wird. Sowohl für die Übergangsprobleme, als auch für die Kooperationsschwierigkeiten werde ich Lösungswege vorschlagen bzw. Möglichkeiten aufzeigen, wie Kinder in dieser wichtigen Phase begleitet und unterstützt werden können. Zum Schluss möchte ich mich näher mit der Rolle der Eltern auseinandersetzen und den Teil den sie der Zusammenarbeit beisteuern: Die Elternarbeit.
Ziel meiner Hausarbeit ist die Hervorhebung der Wichtigkeit des Übergangs, des Anfangsunterrichts und der Kooperation zwischen Grundschule, Kindergarten und Elternhaus für die weitere schulische Entwicklung der Kinder. Außerdem möchte ich mit den Vorschlägen zur Lösung von Übergangs- bzw. Kooperationsschwierigkeiten erreichen, dass den Kindern ein besserer Übergang und eine bessere schulische Karriere ermöglicht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bildungsaufträge von Kindergarten und Grundschule
- Die Übergangsphase und ihre Bedeutung
- Anfangsunterricht – Probleme und Lösungsansätze
- Störungen innerhalb der Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule
- Lösungsvorschläge für eine Kooperation von Kindergarten und Grundschule
- Elternarbeit – Kooperation der Eltern mit Kindergarten und Grundschule
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beleuchtet die Wichtigkeit des Übergangs von Kindergarten zur Grundschule für die weitere schulische Entwicklung der Kinder. Neben den unterschiedlichen Bildungsaufträgen der beiden Institutionen werden die Herausforderungen der Übergangsphase und die Bedeutung der Kooperation zwischen Kindergarten, Grundschule und Elternhaus für einen erfolgreichen Start in die Schullaufbahn hervorgehoben.
- Bildungsaufträge von Kindergarten und Grundschule
- Die Übergangsphase und ihre Bedeutung für die schulische Entwicklung
- Herausforderungen des Anfangsunterrichts
- Die Bedeutung von Kooperation zwischen Kindergarten, Grundschule und Eltern
- Lösungsansätze für die Bewältigung der Übergangsphase
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Bedeutung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule für die weitere Entwicklung der Kinder heraus und gibt einen Überblick über die Themen der Hausarbeit.
- Bildungsaufträge von Kindergarten und Grundschule: Dieses Kapitel beleuchtet die unterschiedlichen Bildungsaufträge von Kindergarten und Grundschule und zeigt auf, wie diese Institutionen die Entwicklung der Kinder unterstützen sollen.
- Die Übergangsphase und ihre Bedeutung: Die Bedeutung der Übergangsphase wird in diesem Kapitel hervorgehoben und es werden die Herausforderungen für die Kinder, die Eltern und die Institutionen aufgezeigt.
- Anfangsunterricht – Probleme und Lösungsansätze: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Schwierigkeiten, die im Anfangsunterricht für die Erstklässler entstehen können, und bietet Lösungsansätze für einen erfolgreichen Start in die Schullaufbahn.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Hausarbeit sind: Übergang Kindergarten Grundschule, Bildungsaufträge, Kooperation, Anfangsunterricht, Elternarbeit, schulische Entwicklung, Startvoraussetzungen. Die Hausarbeit fokussiert auf die Herausforderungen der Übergangsphase und die Bedeutung der Kooperation zwischen Kindergarten, Grundschule und Elternhaus für die erfolgreiche schulische Entwicklung der Kinder.
- Arbeit zitieren
- Sanya Ehms (Autor:in), 2008, Übergangsphase, Koooperation und Anfangsunterricht - Bedeutung und Schwierigkeiten, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/155360