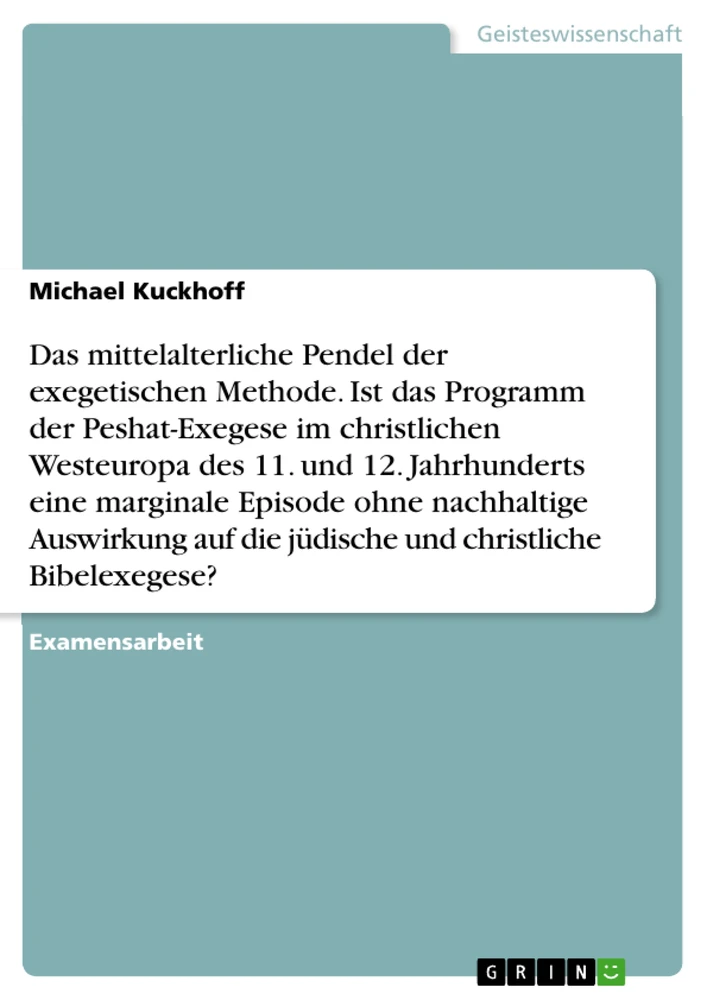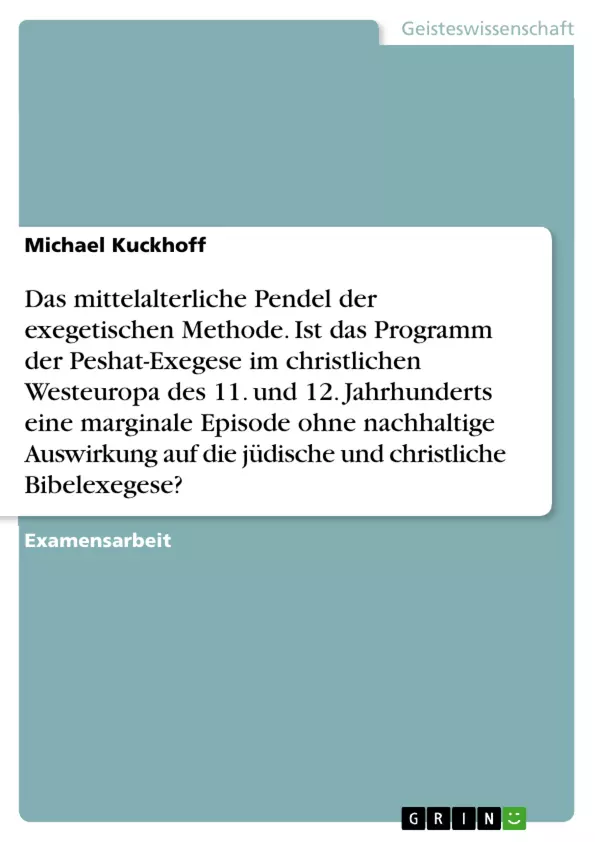Ist das Programm der Peshat-Exegese im christlichen Westeuropa des 11. und 12. Jahrhunderts eine marginale Episode ohne nachhaltige Auswirkung auf die jüdische und christliche Bibelexegese? Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine qualitative, strukturierte Inhaltsanalyse. Dazu wurden Kommentare jüdischer und christlicher Bibelexegeten des Hochmittelalters im christlichen Westeuropa einer vergleichenden Untersuchung unterzogen. Dabei standen die exegetischen Programme der jüdischen Peshat-Tradition bzw. der christlichen ad-litteram-Interpretation des Hohelieds im Zentrum der Betrachtung.
Zunächst werden der aktuelle Forschungsstand und die wichtigsten Publikationen zum Thema ermittelt. Für die qualitative Inhaltsanalyse werden die Kommentare zum Hohelied von Rashi, Rashbam und der Anonyme Oxford Kommentar ausgewählt und diese mit den Kommentaren der christlichen Exegeten Nikolaus von Lyra und Bernhard von Clairvaux verglichen.
Das Hohelied der Liebe ist eines der sonderbarsten Stücke der Heiligen Schrift. Da es sowohl zum christlichen als auch zum jüdischen Kanon gehört, hat es Kommentatoren, Ausleger und einfache Leser jahrhundertelang verwirrt. Der wichtigste Grund für die Besonderheit des Hohelieds ist, dass es sich bei diesem biblischen Buch um ein Stück Liebesdichtung handelt, das voller erotischer Bilder ist. Diese Erotik wurde und wird von vielen Lesern als das Hauptmerkmal des Hohelieds verstanden.
Das Hohelied ist das einzige Buch im Kanon, dem ein religiöses Thema zu fehlen scheint. Umso verständlicher ist das zwei Jahrtausende währende Bemühen von Rabbinern und christlichen Exegeten, eine tiefere und theologisch angemessenere Bedeutung des Hohelieds zu finden. Nicht zuletzt die Vielfalt der Kommentare und die Beharrlichkeit der verschiedenen Textinterpreten machen das Hohelied zu etwas Besonderem und scheinen darauf zu verweisen, dass das Lied der Lieder mehr ist als die bloße Reminiszenz einer Liebesaffäre.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wissenschaftliche Fragestellung
- Methodik
- Quellenlage und Quelleninterpretation
- Bibelstudien im Hochmittelalter Mittel- und Westeuropas
- Bibelexegese an den talmudischen Akademien Nordfrankreichs und Deutschlands
- Die erste Generation: Rashi und die Peshat-Exegese
- Die zweite Generation: Josef Ben Simeon Qara - Rashbam
- Die letzte Generation der Peshat-Exegese in Nordfrankreich
- Die Nachfolgegeneration der Bibelexegese in Südfrankreich: Josef Qimḥi - Gersonides
- Christlicher und polemischer Hebraismus
- Die Bibel im jüdisch-christlichen Dialog
- Das Hohelied: jüdische und christliche Exegese im Hochmittelalter
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Exegese des Hohenliedes im Hochmittelalter, insbesondere den Übergang zwischen allegorischer und wörtlicher Interpretation (Peshat). Sie analysiert die Methoden jüdischer und christlicher Exegeten und deren Interaktion im Kontext des jüdisch-christlichen Dialogs. Die Studie beleuchtet die Bedeutung von Rashi und seinen Nachfolgern für die Entwicklung der wörtlichen Bibelauslegung.
- Die Entwicklung der Peshat-Exegese im Hochmittelalter
- Der Vergleich jüdischer und christlicher Exegetische Methoden
- Der Einfluss von Rashi und Rashbam auf die Bibelauslegung
- Das Hohelied als Fallbeispiel für den jüdisch-christlichen Dialog
- Der Wandel in der Bibelinterpretation zwischen allegorischer und wörtlicher Auslegung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Hohenliedes als ein komplexes und vielschichtig interpretiertes Schriftstück ein. Sie betont die Bedeutung des Buches sowohl im jüdischen als auch im christlichen Kontext und die Herausforderungen, die seine erotische Bildsprache für die Exegeten darstellt. Der Fokus liegt auf der Zwei-Jahrtausende-langen Suche nach einer tieferen theologischen Bedeutung und der Analyse der Kommentare als Quellen, die sowohl den biblischen Text als auch die Interpreten selbst reflektieren. Die Einleitung unterstreicht den Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Auslegungstechniken und dem kulturellen, theologischen und politischen Kontext, in dem die Exegeten wirkten. Es wird auch der Paradigmenwechsel im 12. Jahrhundert angesprochen, der zu neuen innovativen Betrachtungsansätzen neben den traditionellen Methoden führte.
Bibelstudien im Hochmittelalter Mittel- und Westeuropas: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung von eigenständigen Bibelkommentaren im Mittelalter als eine Abkehr vom talmudzentrierten Studium. Es analysiert die Gründe für diese Entwicklung, die im Kontext des erstarkenden Karaismus im muslimischen Raum und der unterschiedlichen Wissensstände und Interessen am Bibelstudium zwischen muslimischen und christlichen Ländern Europas liegt. Das Kapitel diskutiert den Einfluss des intensiven Studiums der hebräischen Sprache und Philosophie im muslimischen Spanien auf die Entwicklung der jüdischen Bibelkommentare und vergleicht die Entwicklungen in muslimischen und christlichen Kontexten. Es wird der Einfluss der jüdischen Kultur im muslimischen Spanien auf die Exegese der Juden in Westeuropa des 11. und 12. Jahrhunderts thematisiert und die Bedeutung von Persönlichkeiten wie Abraham Ibn Esra und Menahem ben Helbo hervorgehoben. Besonders relevant ist die Beobachtung, dass die westeuropäischen Juden, im Gegensatz zu denjenigen in muslimischen Ländern, zunächst weitgehend ohne eigenen Kommentar-Traditionen waren.
Schlüsselwörter
Hohelied, Bibelexegese, Hochmittelalter, Peshat, Allegorie, Rashi, Rashbam, Nikolaus von Lyra, jüdisch-christlicher Dialog, wörtliche Interpretation, Kontextualisierung, mittelalterliche Studien, Exegetische Methoden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Exegese des Hohenliedes im Hochmittelalter, insbesondere den Übergang zwischen allegorischer und wörtlicher Interpretation (Peshat). Sie analysiert die Methoden jüdischer und christlicher Exegeten und deren Interaktion im Kontext des jüdisch-christlichen Dialogs. Die Studie beleuchtet die Bedeutung von Rashi und seinen Nachfolgern für die Entwicklung der wörtlichen Bibelauslegung.
Welche Themenschwerpunkte werden in dieser Arbeit behandelt?
Die Themenschwerpunkte sind: die Entwicklung der Peshat-Exegese im Hochmittelalter, der Vergleich jüdischer und christlicher exegetischer Methoden, der Einfluss von Rashi und Rashbam auf die Bibelauslegung, das Hohelied als Fallbeispiel für den jüdisch-christlichen Dialog, und der Wandel in der Bibelinterpretation zwischen allegorischer und wörtlicher Auslegung.
Worum geht es in der Einleitung?
Die Einleitung führt in die Thematik des Hohenliedes als ein komplexes und vielschichtig interpretiertes Schriftstück ein. Sie betont die Bedeutung des Buches sowohl im jüdischen als auch im christlichen Kontext und die Herausforderungen, die seine erotische Bildsprache für die Exegeten darstellt. Der Fokus liegt auf der Zwei-Jahrtausende-langen Suche nach einer tieferen theologischen Bedeutung und der Analyse der Kommentare als Quellen, die sowohl den biblischen Text als auch die Interpreten selbst reflektieren. Die Einleitung unterstreicht den Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Auslegungstechniken und dem kulturellen, theologischen und politischen Kontext, in dem die Exegeten wirkten. Es wird auch der Paradigmenwechsel im 12. Jahrhundert angesprochen, der zu neuen innovativen Betrachtungsansätzen neben den traditionellen Methoden führte.
Was behandelt das Kapitel über Bibelstudien im Hochmittelalter?
Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung von eigenständigen Bibelkommentaren im Mittelalter als eine Abkehr vom talmudzentrierten Studium. Es analysiert die Gründe für diese Entwicklung, die im Kontext des erstarkenden Karaismus im muslimischen Raum und der unterschiedlichen Wissensstände und Interessen am Bibelstudium zwischen muslimischen und christlichen Ländern Europas liegt. Das Kapitel diskutiert den Einfluss des intensiven Studiums der hebräischen Sprache und Philosophie im muslimischen Spanien auf die Entwicklung der jüdischen Bibelkommentare und vergleicht die Entwicklungen in muslimischen und christlichen Kontexten. Es wird der Einfluss der jüdischen Kultur im muslimischen Spanien auf die Exegese der Juden in Westeuropa des 11. und 12. Jahrhunderts thematisiert und die Bedeutung von Persönlichkeiten wie Abraham Ibn Esra und Menahem ben Helbo hervorgehoben. Besonders relevant ist die Beobachtung, dass die westeuropäischen Juden, im Gegensatz zu denjenigen in muslimischen Ländern, zunächst weitgehend ohne eigenen Kommentar-Traditionen waren.
Welche Schlüsselwörter sind mit dieser Arbeit verbunden?
Die Schlüsselwörter sind: Hohelied, Bibelexegese, Hochmittelalter, Peshat, Allegorie, Rashi, Rashbam, Nikolaus von Lyra, jüdisch-christlicher Dialog, wörtliche Interpretation, Kontextualisierung, mittelalterliche Studien, exegetische Methoden.
Welche Kapitel sind im Inhaltsverzeichnis aufgeführt?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst folgende Kapitel: Einleitung, Wissenschaftliche Fragestellung, Methodik, Quellenlage und Quelleninterpretation, Bibelstudien im Hochmittelalter Mittel- und Westeuropas, Bibelexegese an den talmudischen Akademien Nordfrankreichs und Deutschlands, Die erste Generation: Rashi und die Peshat-Exegese, Die zweite Generation: Josef Ben Simeon Qara - Rashbam, Die letzte Generation der Peshat-Exegese in Nordfrankreich, Die Nachfolgegeneration der Bibelexegese in Südfrankreich: Josef Qimḥi - Gersonides, Christlicher und polemischer Hebraismus, Die Bibel im jüdisch-christlichen Dialog, Das Hohelied: jüdische und christliche Exegese im Hochmittelalter, Schlussfolgerung.
- Quote paper
- Michael Kuckhoff (Author), 2023, Das mittelalterliche Pendel der exegetischen Methode. Ist das Programm der Peshat-Exegese im christlichen Westeuropa des 11. und 12. Jahrhunderts eine marginale Episode ohne nachhaltige Auswirkung auf die jüdische und christliche Bibelexegese?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1547677