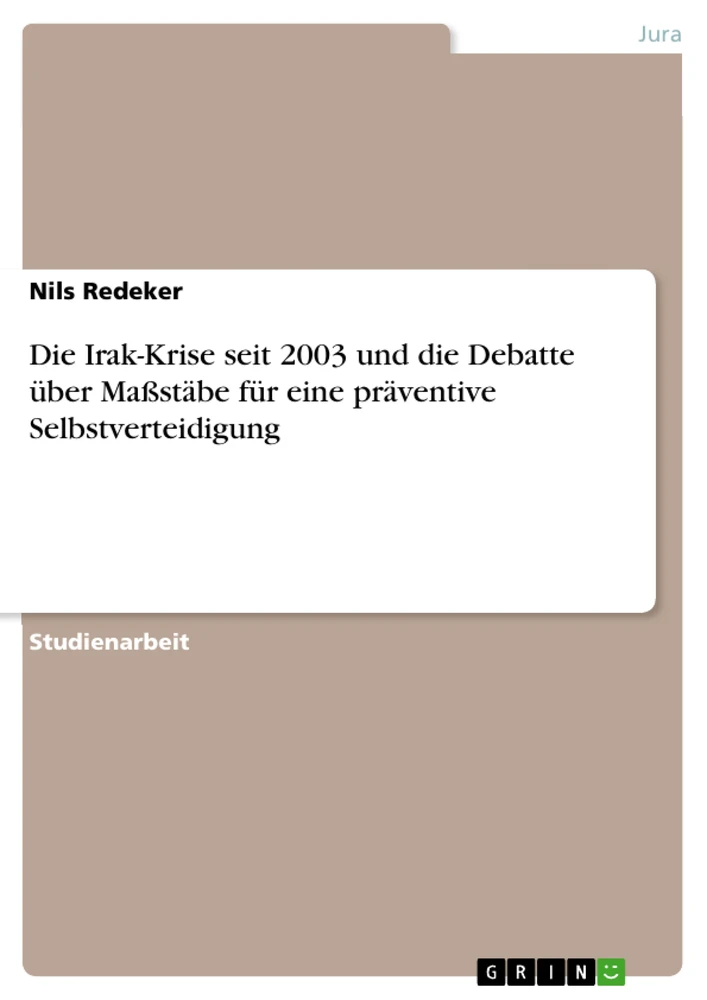Der Irak-Krieg 2003, den die USA und ihre „Koalition der Willigen“ (Ziegler, 2009: S.329) ohne Legitimation durch den UN-Sicherheitsrat führten, war für viele Beobachter nicht nur eine politische und militärische Krise, sondern zugleich auch eine „Krise des Völkerrechts“. (Haverkamp, 2004: S. 270) Die „Operation Iraqi Freedom“ und die Debatte über ihre völkerrechtliche Legitimität stellte einige wesentliche Fragen: Auf welcher Grundlage dürfen Staaten gegeneinander Krieg führen? Wie weit geht der Interpretationsspielraum bei der Auslegung von UN-Resolutionen? Welche Reichweite hat das im Artikel 51 der UN-Charta genannte Recht auf Selbstverteidigung?
Ziel dieser Arbeit ist es, einen grundlegenden Überblick über die völkerrechtlichen Fragen, die sich aus dem zweiten Golfkrieg ergaben, zu bieten. Dazu soll im Folgenden zunächst ein kurzer Einblick in die relevante Vorgeschichte und den Verlauf des Krieges (2) gegeben werden. Daraufhin werde ich mich mit dem völkerrechtlichen Gewaltverbot und seinen grundsätzlichen Ausnahmen beschäftigen (3), um daran anschließend die beiden wesentlichen Argumentationsstränge zur völkerrechtlichen Legitimation des Irakkriegs darzustellen und auf ihre Zulässigkeit zu überprüfen. Dabei werde ich zunächst auf eine mögliche Rechtfertigung durch bereits vorhandene UN-Resolutionen eingehen (4), mich danach aber vor allem auf die Debatte der Zulässigkeit von Selbstverteidigung im Falle des zweiten Golfkriegs konzentrieren. (5) Abschließend wird auf dieser Grundlage die völkerrechtliche Legitimität des Irakkrieg beurteilt. (6)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Relevante Vorgeschichte
- Das völkerrechtliche Gewaltverbot und seine Ausnahmen
- Legitimation durch bereits vorhandene Resolutionen
- Legitimation durch das Recht auf Selbstverteidigung
- Ein Recht auf präventive Selbstverteidigung?
- Die Ausnahme der antizipatorischen Selbstverteidigung
- Antizipatorische Selbstverteidigung der USA gegenüber dem Irak?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, einen umfassenden Überblick über die völkerrechtlichen Fragestellungen zu bieten, die sich aus dem zweiten Golfkrieg ergaben. Im Fokus steht dabei die Debatte um die völkerrechtliche Legitimität des Irakkriegs 2003, den die USA und ihre „Koalition der Willigen“ ohne Legitimation durch den UN-Sicherheitsrat führten.
- Das völkerrechtliche Gewaltverbot und seine Ausnahmen
- Die Interpretation von UN-Resolutionen im Kontext des Irakkriegs
- Das Recht auf Selbstverteidigung und seine Anwendung im Falle des Irakkriegs
- Die Rolle des UN-Sicherheitsrats bei der Durchsetzung von völkerrechtlichen Normen
- Die Bedeutung des Gewaltverbots im internationalen Recht
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Relevanz des Themas Irakkrieg im Kontext der völkerrechtlichen Debatte heraus. Es wird die zentrale Fragestellung definiert, die sich mit der völkerrechtlichen Legitimität des Irakkriegs 2003 beschäftigt. Die Arbeit strukturiert sich in verschiedene Abschnitte, die sich mit der Vorgeschichte, dem völkerrechtlichen Gewaltverbot, den Argumenten für die Legitimation des Irakkriegs und der abschließenden Beurteilung der völkerrechtlichen Legitimität des Irakkriegs befassen.
- Die Relevante Vorgeschichte: Dieser Abschnitt beleuchtet die Ereignisse, die zum Krieg im Irak führten. Dabei werden die Hintergründe des ersten Golfkriegs sowie die Rolle der UN-Sicherheitsratsresolutionen im Kontext des Irakkriegs 2003 dargelegt. Besondere Aufmerksamkeit wird der Entwicklung des Waffenstillstandsabkommens und der daraus resultierenden Verpflichtungen des Iraks gewidmet.
- Das völkerrechtliche Gewaltverbot und seine Ausnahmen: Dieser Abschnitt stellt das grundlegende Gewaltverbot der UN-Charta vor. Es werden die zentralen Normen des völkerrechtlichen Gewaltverbots erläutert sowie die beiden Ausnahmen von diesem Verbot: das Recht auf Selbstverteidigung und die militärische Zwangsmaßnahmen des UN-Sicherheitsrats. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung des Gewaltverbots und die Voraussetzungen für seine Anwendung.
- Legitimation durch bereits vorhandene Resolutionen: In diesem Abschnitt werden die Argumente der Kriegsbefürworter im Zusammenhang mit der Legitimation des Irakkriegs durch bestehende UN-Resolutionen untersucht. Die Arbeit beleuchtet die Interpretation der Resolutionen 678, 687 und 1441 sowie die Positionen verschiedener Akteure, insbesondere der USA, Großbritanniens und Australiens, hinsichtlich der völkerrechtlichen Legitimation des Irakkriegs.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf das völkerrechtliche Gewaltverbot, die Anwendung von Gewalt im internationalen Recht, die Rolle des UN-Sicherheitsrats, die Interpretation von UN-Resolutionen, die Legitimation von militärischen Interventionen, das Recht auf Selbstverteidigung, präventive Selbstverteidigung, der Irakkrieg 2003, die "Koalition der Willigen", Massenvernichtungswaffen und die Frage der völkerrechtlichen Verantwortung.
- Quote paper
- Nils Redeker (Author), 2010, Die Irak-Krise seit 2003 und die Debatte über Maßstäbe für eine präventive Selbstverteidigung , Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/154153