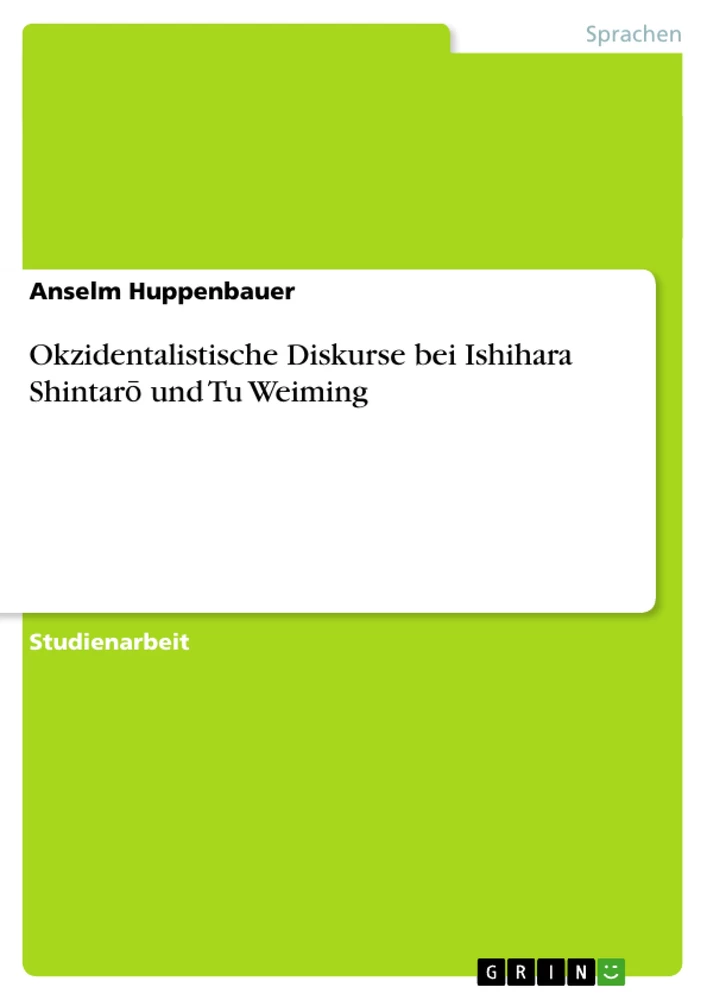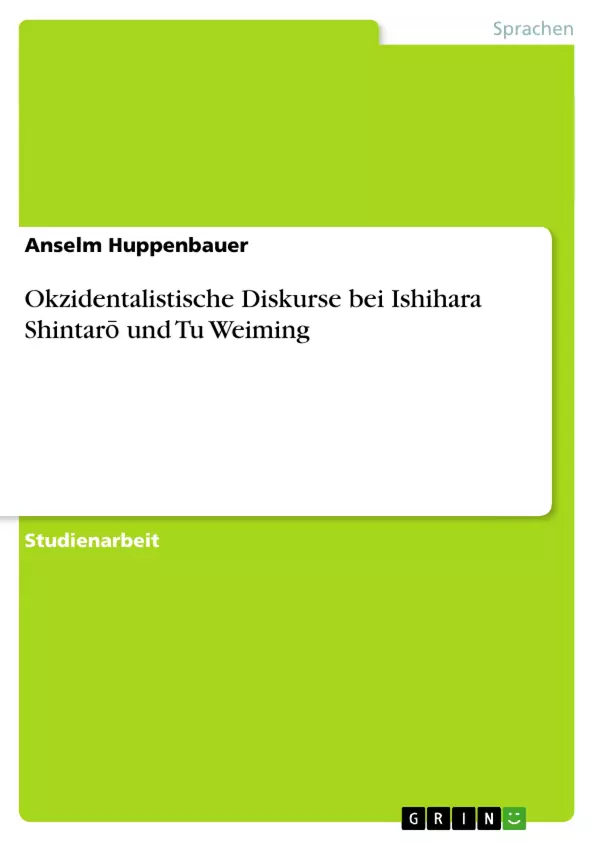[...] In dieser Arbeit sollen Selbstbehauptungsdiskurse untersucht
werden, bei denen als kollektive Identitäten, als imagined communities, „Japan“, „Ostasien“
oder gar „Asien“ beschworen werden. Ich verwende „Selbstbehauptungsdiskurse“1 hier als
Sammelbegriff für „echte“ Ostasiendiskurse, wie „Asian Values“, und für selbstbehauptende
Diskurse einzelner Länder, von denen allerdings nur die „Japandiskurse“ betrachtet werden
sollen. Die darin produzierten Selbstbilder beziehen sich zwar auf unterschiedliche
geographische oder politische Einheiten (Japan, Ostasien, Asien …), die sich – besonders
„Ostasien – nur sehr diffus begrenzen lassen (Gehören Tibet, Sachalin und Singapur zu
Ostasien?), und die auf allen Ebenen extrem heterogen sind, sodass man bei genauerer
Untersuchung wohl nicht einmal Essstäbchen als absolute Gemeinsamkeit gelten lassen kann.
Es lassen sich aber in diesen Selbstbehauptungsdiskursen deutliche Konvergenzen finden, in
der Art, wie sie Selbstbilder produzieren, und wie immer wieder als Vergleichsfolie der
Westen herangezogen wird.
Genau diese Konvergenzen zu untersuchen, insbesondere das auffallend homogene Bild des
Westens, ist Ziel dieser Arbeit. Zunächst sollen dabei die Thesen von Orientalismus und
Okzidentalismus erläutert werden, und geprüft werden, inwieweit ein spiegelbildlicher
Okzidentalismus wirklich existiert, und inwieweit er auf ostasiatische Diskurse anwendbar ist.
Im Folgenden soll einmal die Reichweite ostasiatischer Selbstbehauptungsdiskurse vorgestellt
werden, exemplarisch möchte ich dabei vor allem die Thesen des Tu Weiming und Ishihara
Shintarō beschreiben, indem ich eine kurze Beschreibung der Traditionen der „Japandiskurse“
und der „Asian Values“-Debatte gebe. Es soll also in verschiedenen ostasiatischen Diskursen
die Dichotomisierung zwischen Ost (Japan – Ostasien – Asien) und West (USA – 欧米・
Ōbei) untersucht, und nach Gründen geforscht werden.
Diskurse sind nun im Sinne Foucaults als Machtinstrument und Machteffekt zu sehen, sie
können Macht produzieren, oder aber in Frage stellen2 und gerade Selbstbehauptungsdiskurse
von Nationen oder Regionen, werden nicht im luftleeren Raum, sondern in einem von starken
politischen Interessen geladenen Raum geschrieben. In diesem Sinne sollen im
anschließenden Kapitel Hintergründe und politische Implikationen einiger ostasiatischer
Thesen nachvollzogen werden, speziell die Instrumentalisierung des Konfuzianismus.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theoretische Vorbetrachtungen
2.1. Orientalismus
2.2. Okzidentalismus
2.3. „Imaginative Geographies“ und „Imagined Communities“
3. Selbst- und Fremdbilder in modernen ostasiatischen Selbstbehauptungsdiskursen
3.1. Die Entwicklung der Japandiskurse
3.2. Zwischen Nationalismus und Asian Values: Ishihara Shintaro
3.3. Zwischen Asian Values und Konfuzius: Tu Weiming
4. Selbstbehauptungsdiskurse und politische Interessen
4.1. Die Intentionen des Ishihara Shintaro
4.2. Die Konfuzianismuslüge und Tu Weiming
4.3. Konfuzianischer Humanismus
5. Zusammenfassung
1. Einleitung
Selbstbilder und Bilder des „Anderen“ kollektiver Identitäten sind immer von der jeweiligen politischen Realität abhängig. In dieser Arbeit sollen Selbstbehauptungsdiskurse untersucht werden, bei denen als kollektive Identitäten, als imagined communities, „Japan“, „Ostasien“ oder gar „Asien“ beschworen werden. Ich verwende „Selbstbehauptungsdiskurse“1 hier als Sammelbegriff für „echte“ Ostasiendiskurse, wie „Asian Values“, und für selbstbehauptende Diskurse einzelner Länder, von denen allerdings nur die „Japandiskurse“ betrachtet werden sollen. Die darin produzierten Selbstbilder beziehen sich zwar auf unterschiedliche geographische oder politische Einheiten (Japan, Ostasien, Asien …), die sich – besonders „Ostasien – nur sehr diffus begrenzen lassen (Gehören Tibet, Sachalin und Singapur zu Ostasien?), und die auf allen Ebenen extrem heterogen sind, sodass man bei genauerer Untersuchung wohl nicht einmal Essstäbchen als absolute Gemeinsamkeit gelten lassen kann. Es lassen sich aber in diesen Selbstbehauptungsdiskursen deutliche Konvergenzen finden, in der Art, wie sie Selbstbilder produzieren, und wie immer wieder als Vergleichsfolie der Westen herangezogen wird.
Genau diese Konvergenzen zu untersuchen, insbesondere das auffallend homogene Bild des Westens, ist Ziel dieser Arbeit. Zunächst sollen dabei die Thesen von Orientalismus und Okzidentalismus erläutert werden, und geprüft werden, inwieweit ein spiegelbildlicher Okzidentalismus wirklich existiert, und inwieweit er auf ostasiatische Diskurse anwendbar ist. Im Folgenden soll einmal die Reichweite ostasiatischer Selbstbehauptungsdiskurse vorgestellt werden, exemplarisch möchte ich dabei vor allem die Thesen des Tu Weiming und Ishihara Shintaro beschreiben, indem ich eine kurze Beschreibung der Traditionen der „Japandiskurse“ und der „Asian Values“-Debatte gebe. Es soll also in verschiedenen ostasiatischen Diskursen die Dichotomisierung zwischen Ost (Japan – Ostasien – Asien) und West (USA – fi$• Obei) untersucht, und nach Gründen geforscht werden.
Diskurse sind nun im Sinne Foucaults als Machtinstrument und Machteffekt zu sehen, sie können Macht produzieren, oder aber in Frage stellen2 und gerade Selbstbehauptungsdiskurse von Nationen oder Regionen, werden nicht im luftleeren Raum, sondern in einem von starken politischen Interessen geladenen Raum geschrieben. In diesem Sinne sollen im anschließenden Kapitel Hintergründe und politische Implikationen einiger ostasiatischer Thesen nachvollzogen werden, speziell die Instrumentalisierung des Konfuzianismus.
2. Theoretische Vorbetrachtungen
Ehe die eigentliche Untersuchung ostasiatischer Selbstbehauptungsdiskurse begonnen soll, möchte ich zunächst einige theoretische Grundlagen, auf die ich mich in dieser Arbeit beziehe, erläutern.
2.1. Orientalistische Diskurse
Eine der Theorien, die auf die area studies mit den größten Einfluss hatte, ist der Orientalismus von Edward Said (1979). Indem er einen gewaltigen Korpus an europäischer und amerikanischer Literatur (Reisebeschreibungen, wissenschaftliche Literatur, Romane u. a.) analysiert, entlarvt er europäische, später auch die amerikanischen Diskurse seit der Aufklärung über den Orient, über das Andere, als orientalistisch. Für ihn sind Orientalismus dabei dreierlei, miteinander eng verbundene Dinge, (1) eine akademische Tradition, (2) die Prämisse vieler Theorien, dass ein Orient den Gegenpol zum Okzident darstellt, (3) und vor allem „a Western style for dominating, restructuring, and having authority over the Orient.“3 – Der Orient wird erst durch den Orientalismus konstruiert, er ist kein sprechendes Subjekt, sondern Objekt der Untersuchung, Unterwerfung, für das gesprochen wird.
Said folgt dabei dem Diskursbegriff Foucaults, jener ist gleichzeitig Machtinstrument und Machteffekt4 : Die Erforschung und Beschreibung Ägyptens in literarischen und akademischen Diskursen ebnete beispielsweise den Weg für dessen militärische Unterwerfung durch Napoleon5. Es ist nur eine Veränderung der Machtinstrumente; ein geschriebener Diskurs ist nie frei von „politischem Wissen“; auch unbewusst behalten europäische Autoren aufgrund der politischen Verhältnisse ihre positionelle Überlegenheit über den Orient6, und dem Machtbegriff Foucaults folgend sind Politik und Krieg nur zwei verschiedene Strategien zur Integration gespannter Machtverhältnisse, die jederzeit ineinander umschlagen können7. Auch wenn Macht mehrere Formen besitzt, konzentriert sich Said, genau wie ich in dieser Arbeit, vor allem auf die politische Macht, mit der orientalistische Diskurse besonders verflochten sind: „If this definition of Orientalism seems more political than not, that is simply because I think Orientalism was itself a product of certain political forces and activities.”8
Den Orientalismus bezeichnet Said als einen hegemonialen Diskurs, und es ist m. E. gerechtfertigt, ihn für seine homogene Darstellung zu kritisieren, die eine Orient – Okzident-, Ost – West – Dichotomie wohl noch unbeabsichtigt reproduziert. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass Said tatsächlich den Orient schweigen lässt, und weder Aktionen des Widerstands in den kolonialisierten Ländern, noch Gegendiskurse aufnimmt, obwohl diese ja nach dem Diskursbegriff Foucaults zwingend vorhanden sind, und gerade politischer Widerstand durchaus seinen Einfluss auf den orientalistischen Diskurs hatte9.
Dennoch bietet er eine gute Erklärung für die westliche Hegemonie (im politischen, kulturellen aber auch akademischen Sinne, für die europäische „Deutungshoheit“), die sehr wohl eine Grunderfahrung in vielen Ländern darstellt, die entweder direkt kolonisiert, oder ihr wie die ostasiatischen Länder eher indirekt unterworfen worden sind. Als postkoloniale Theorie, die diese westliche Hegemonie zu dekonstruieren versucht, gewann er entsprechend eine große Beliebtheit, und m. E. behält er als spezieller Diskurstyp einer homogenisierenden, essentialisierenden, mit politischer Macht eng verbundenen Beschreibung des Anderen durchaus seine Gültigkeit, der sich mehr oder minder sinnvoll in fast jeden Raum übertragen lässt. Zur Beschreibung von Diskursen, kann man die Aktanten, Subjekt und Objekt, also den Beschreibenden und das Beschriebene, „wir“ und „das Andere“ nahezu beliebig verändern, auch Begriffe wie Selbstorientalisierung einführen, etwa zur Beschreibung Japans.
2.2. Okzidentalismus
Als eine Antwort auf den Orientalismus ist 2004 das Buch Occidentalism von Ian Buruma und Avishai Margalit erschienen. Hier bezeichnet Okzidentalismus das Set von Vorurteilen und Stereotypen über den „Westen“, derer sich seine Feinde bedienen10, also einen essentialistischen Diskurs, mit dem sich Akteure mit starken politischen, oft gewalttätigen Interessen, gegenüber einem dekadenten Westen selbst zu behaupten versuchen. Die Autoren benennen dabei vier Angriffsfelder: (1) die sündenbeladene, unnatürliche Stadt im Okzidents, (2) die unheroische, auf Komfort bedachte Seele, (3) der rationale, westliche Geist, (4) und die Götzendienerei.
Sie zeigen dabei, was gegenüber Said einen Fortschritt darstellt, dass die Akteure nicht per se außerhalb des Westens sein müssen, dass die Grenzen des Diskurses viel fließender sind und deren einfache Verortung, z. B. in den Orient unmöglich ist. Deutsche Nationalisten aus der Romantik bedienen sich derselben Sprache, desselben Diskurses, wie japanische Kamikazepiloten oder arabische Fundamentalisten11. Elemente aus der Zivilisationskritik innerhalb Europas, innerhalb der Mutterländer der Kolonisation, finden sich in antikolonialen Widerstandsdiskursen wieder.
Obwohl sie diese „cross-contamination, the spread of bad ideas“12 nachweisen, wirkt ihr methodisches Vorgehen im Vergleich zu Said unsystematisch, zu sehr über alle Kontinente gestreut. Es fehlt auch die kritische Reflexion über verwendete Theorien, als dass es eine gleichwertige Antwort auf Orientalism 1979 sein könnte. Dennoch ist es ein interessanter Versuch, den Gegendiskurs, den notwendigen Widerstand gegen den hegemonialen orientalistischen Diskurs, nachzuzeichnen, ein wichtiger Versuch angesichts der (nicht nur metaphorischen!) Sprengkraft anti-westlicher Bewegungen.
Schließlich, ehe wir ostasiatische Diskurse untersuchen, soll noch einmal der Okzidentalismus (im Sinne von Buruma/ Margalit 2004) mit dem Orientalismus (im Sinne Saids, d. h. dem hegemonialen, westlichen Diskurs über den Orient) in Beziehung gesetzt werden. Es ist kein spiegelbildlicher Gegendiskurs. Beide sind ähnlich in ihren essentialistischen, homogenisierenden Bildern des Anderen, beide sind Machtinstrumente, allerdings ist ohne Zweifel der Orientalismus der stärkere Diskurs – die Macht ist in einer Vielzahl politischer, akademischer oder ökonomischer Institutionen kristallisiert13. Said betont ja gerade die Rolle akademischer Forschung als Wegbereiter politischer Macht, und gerade für diese akademische Tradition, die ja einer der drei Grundbedeutungen des Orientalismus ist, fehlt ein Äquivalent in Ostasien. Die geringere Verflechtung mit Institutionen etc. kann allerdings als gradueller, nicht als qualitativer Unterschied zum Orientalismus gesehen werden, schließlich tauchen „mit umgekehrten Vorzeichen“ ähnliche Strukturen auf14.
[...]
1 Vgl. Lackner 2008, S. 17f.
2 Vgl. Foucault 1977, S. 100
3 Zitiert nach Said 1979, S. 3
4 Vgl. Foucault 1977, 100
5 Vgl. Said 1979, S. 80ff.
6 Ebd, S. 7
7 Vgl. Foucault 1977, S. 94
8 Zitiert nach Said 1979, S. 203
9 Vgl. Castro Varela/ Dhawan 2005: S. 38f.
10 Vgl. Buruma/ Margalit 2004, S. 5f.
11 Ebd., S. 59
12 Ebd., S. 149
13 Zu dem Ausdruck der „Kristallisiation“ von Macht vgl. Foucault 1977, S. 93
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Textes?
Der Text untersucht Selbstbehauptungsdiskurse in Ostasien, insbesondere in Bezug auf Japan, und wie diese Diskurse Selbst- und Fremdbilder konstruieren, wobei der Westen oft als Vergleichsfolie dient. Es werden die Theorien von Orientalismus und Okzidentalismus erläutert und ihre Anwendbarkeit auf ostasiatische Diskurse geprüft.
Was sind die theoretischen Grundlagen der Arbeit?
Die Arbeit stützt sich auf die Theorien von Edward Said (Orientalismus) und Ian Buruma/Avishai Margalit (Okzidentalismus) sowie auf den Diskursbegriff von Michel Foucault.
Was ist Orientalismus nach Edward Said?
Orientalismus ist ein westlicher Stil der Dominierung, Restrukturierung und Autorität über den Orient. Er konstruiert den Orient als Gegenpol zum Okzident und behandelt ihn als Objekt der Untersuchung und Unterwerfung.
Was ist Okzidentalismus nach Buruma und Margalit?
Okzidentalismus ist ein Set von Vorurteilen und Stereotypen über den Westen, das von dessen Feinden verwendet wird, um sich selbst zu behaupten. Es kritisiert u.a. die sündenbeladene Stadt, die unheroische Seele, den rationalen Geist und die Götzendienerei des Westens.
Inwiefern unterscheiden sich Orientalismus und Okzidentalismus?
Beide sind essentialistisch und homogenisierend in ihren Bildern des Anderen, aber der Orientalismus ist der stärkere Diskurs, da er in einer Vielzahl politischer, akademischer und ökonomischer Institutionen kristallisiert ist. Es ist kein spiegelbildlicher Gegendiskurs.
Welche ostasiatischen Diskurse werden untersucht?
Exemplarisch werden die Thesen von Tu Weiming und Ishihara Shintaro beschrieben. Es wird eine kurze Beschreibung der Traditionen der „Japandiskurse“ und der „Asian Values“-Debatte gegeben.
Welche Rolle spielt der Diskursbegriff von Foucault?
Diskurse werden als Machtinstrument und Machteffekt gesehen. Sie können Macht produzieren oder in Frage stellen.
Welche politischen Implikationen haben ostasiatische Thesen?
Die Arbeit untersucht Hintergründe und politische Implikationen einiger ostasiatischer Thesen, speziell die Instrumentalisierung des Konfuzianismus.
Was sind "Imaginative Geographies" und "Imagined Communities"?
Diese Begriffe werden im Kontext von kollektiven Identitäten wie "Japan", "Ostasien" oder "Asien" verwendet, die als konstruierte Gemeinschaften betrachtet werden. Sie sind von der jeweiligen politischen Realität abhängig.
- Arbeit zitieren
- Anselm Huppenbauer (Autor:in), 2008, Okzidentalistische Diskurse bei Ishihara Shintarō und Tu Weiming, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/154080