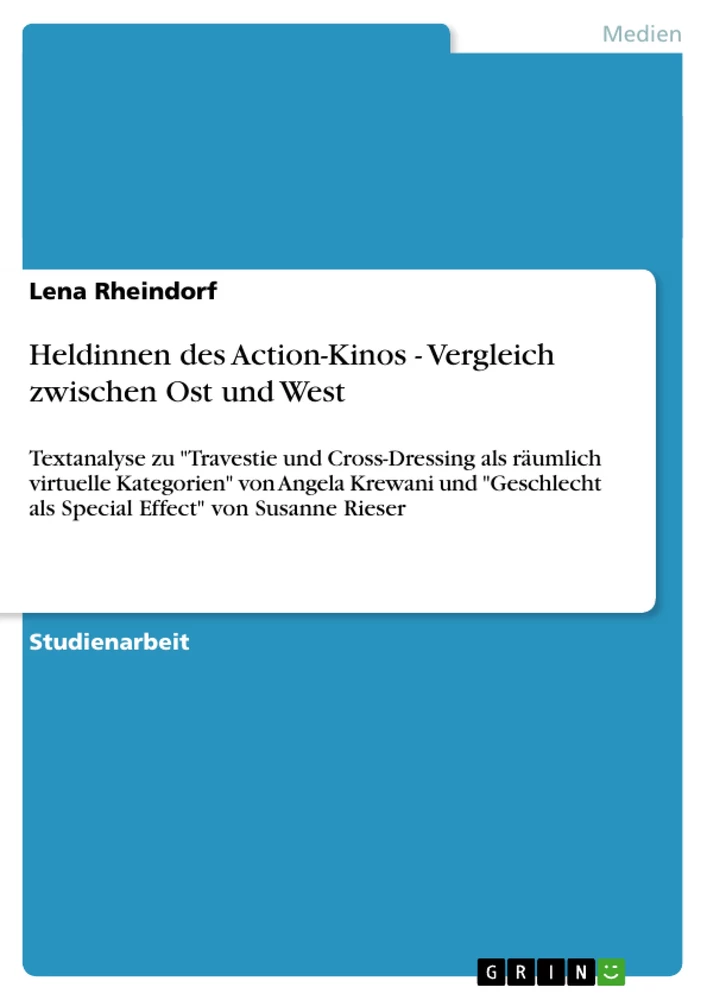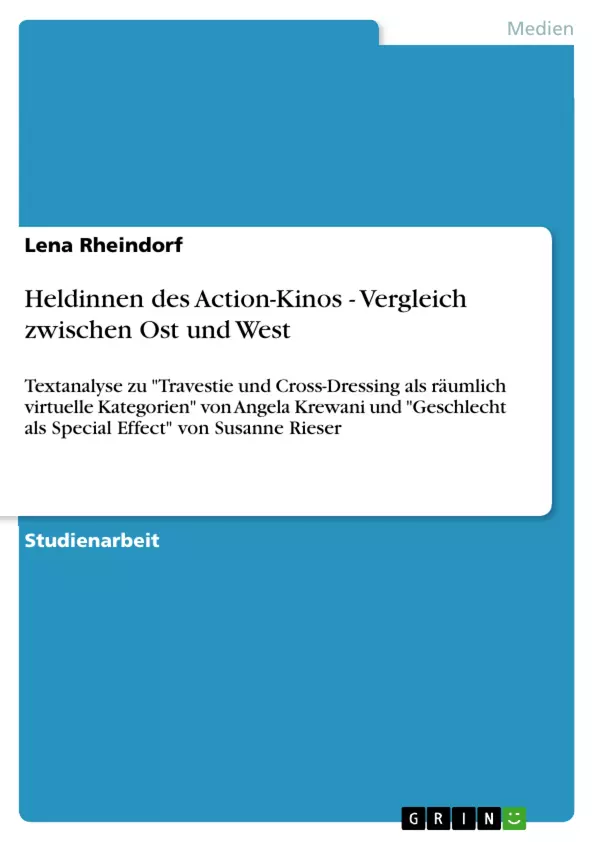Dr. Angela Krewani hat an der Universitat Koln Anglistik, Anglo- Amerikanische Geschichte und Politikwissenschaft studiert. 1992 promovierte sie mit einer Arbeit zum Thema „Moderne und Weiblichkeit- Amerikanische Schriftstellerinnen in Paris". Derzeit ist sie Leiterin eines Forschungsprojekts zum „Mythos Hollywood". Ihre Arbeitsschwerpunkte sind (Inter) mediale Asthetiken, kanadischer Film, Virtualisierung des Alltags und digitale Medien.
In ihrem Text „Travestie und Cross- Dressing als raumlich virtuelle Kategorien"1liegt ihr Fokus auf der ErschlieRung imaginarer Raume und der Veranderung der Semantiken des Raums. Sie erlautert, dass architektonische und raumliche Konzeptionen Differenzen der sozialen Herstellung von Geschlecht mit sich bringen. Das besagt, dass im Allgemeinen der offentliche Raum als mannlich konnotiert, der private Raum als weiblich konnotiert gilt. Im Folgenden disputiert sie dann Raume, in denen sich diese Konnotationen verschieben konnen.
Das hauptsachliche Thema des Textes ist also imaginar-raumliche Transgression. In den Geisteswissenschaften bedeutet der Begriff der Grenzuberschreitung nach Bataille immer eine Ruckkehr des Animalischen. Lust und Sexualitat sind eng an die Idee der Oberschreitung geknupft. Vorderhand geht Krewani in ihrer Argumentation vom Internet als virtuellem Raum, der nur als fiktiver Raum unsere Vorstellungen formt, aus: das Internet lasst sich nach Krewani an althergebrachte weibliche Kulturtechniken- wie etwa das Netzweben- anbinden, die Experimente mit- ansonsten in sozialen Praktiken festgefugten- Geschlechterdifferenzen gestatten.
Das Internetz als Ausgangspunkt nehmend, macht Krewani einen historischen Exkurs und bespricht Raume, die schon vor dem Internet diese Moglichkeit boten. Zuerst erwahnt Krewani die elisabethanische Buhne, auf der das Verhaltnis der Geschlechter und deren Semantiken verhandelt werden konnten. Hier war aber die Travestie augenfallig begrenzt und in ihrer Funktion gekennzeichnet. Dann geht sie detailliert auf die Avantgarde zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als einen Versuch Geschlechterdifferenz in offentlichen Raumen in Frage zu stellen, ein. Die Destabilisierung der Semantiken der Geschlechterdifferenz wurde vor allem von weiblichen Kunstlerinnen in von Frauen betriebenen Salons- als halboffentlicher Raum- praktiziert, expliziert Krewani. Als Aushangeschild dieser Kulturtechnik dient ihr das Schaffen Natalie Barneys im Paris anfangs des 20. Jahrhunderts.
In dieser Zeit begannen Frauen vermehrt uber sich selbst zu schreiben. Soziologisch gesehen gelten moderne Gesellschaften als gekennzeichnet durch Rationalisierung, Orientierung an technischem und wissenschaftlichem Fortschritt, burokratische Verwaltung und Trennung zwischen privater und offentlicher Sphare. Auch fur die Geschichte der literarischen und kunstlerischen Moderne ist das fruhe 20. Jahrhundert besonders bedeutsam. Auch hier zahlen Tempo und Bewegung, eine Orientierung am technischen Fortschritt und am Experiment, die Auseinandersetzung mit Identitat, Individualitat und Masse und ganz besonders die Einschreibung der Erfahrung des Ersten Weltkriegs.
Barneys weibliche Gaste erschienen zumeist in traditionell mannlicher Garderobe. Sie loste die private Raumlichkeit ihres Salons durch ein Medium des offentlichen Raums, und fiktionalisierte die Gaste als allegorische Figuren der Monate eines Jahres in Anlehnung an den mittelalterlichen Kalender, den Almanach. Danach geht Krewani auf Raume in verschiedenen Medien ein.
Vorab geht sie detaillierter auf Texte der Moderne, zwei Romane deren ProtagonistInnen raumliche und zeitliche Grenzen uberschreiten um fiktive Raume fur eine Neuverhandlung der Geschlechterdifferenzen zu hervorbringen, ein. Diesen Ansatz finde ich in sich besonders schlussig, da auch der Autor Rider Haggard2seinem Roman „She“, davon ausgeht dass Geschichte weiblich ist („she’s older than the rocks amoong she sits“) und Frauen als Ursache von Veranderung, namentlich „die“ Frau als Ursprung der Moderne, ansieht. Schrift an sich beinhaltet in dieser Zeit fur schreibende Frauen das Potential transgressiven Sprachgebrauchs zur Umwerfung des Patriachats und zur ErschlieOung neuer Identitatskonstruktionen.3Zunachst analysiert sie Virginia Woolfs Orlando4. Orlando ist ursprunglich eine Hommage Virginia Woolfs an die Schriftstellerin Victoria Sackville-West. In dem jungen, wandelbar-unwandelbaren Orlando, dessen abenteuerliches Leben 400 Jahre umspannt, sieht Virginia Woolf ihre Freundin als Verkorperung ihrer Vorfahren, der Grafen und Herzoge Sackville. Bald ist Orlando ein schoner Jungling, Gunstling Elisabeths I., bald eine Frau, die in Konstantinopel bei einem Zigeunerstamm lebt, dann wieder im England des 17.und 18. Jahrhunderts eine Dame der groRen Gesellschaft, die als Mann verkleidet verbotene Abenteuer sucht. In der Gegenwart angekommen, ist Orlando eine Dichterin, die, wie Vita Sackville West 1928, einen Literaturpreis erhalt. Orlando bietet laut Krewani ein Modell fur ein Verstandnis von Travestie als eigener Kategorie, die zwar nach Raumen verlangt, diese aber nicht territorial oder lokal verankert. Woolf erfasst Travestie eher als Kulturtechnik, die unabhangig von determinierten Raumen funktioniert.
Danach diskutiert Krewani Djuna Barnes Roman Nightwood. Nightwood beginnt mit dem folgenden, vielversprechenden Satz "Early in 1880, in spite of a well-founded suspicion as to the advisability of perpetuating that race which has the sanction of the Lord and the disapproval of the people, Hedvig Volkbein, a Viennese woman of great strength and military beauty, lying upon a canopied bed, of a red spectacular crimson, the valance stamped with the bifurcated wings of the House of Hapsburg, the feather coverlet an envelope of satin on which, in massive and tarnished gold threats, stood die Volkbein arms, - gave birth, at the age of forty-five, to an only child, a son, seven days after her physician predicted that she would be taken."5In Gegenuberstellung zu den verschleierten Transformationen des Transvestiten O’Connor, der die Offentlichkeit seines Verlangens scheut, empfindet die bisexuelle Robin Vote in Nightwood ihre Sexualitat als auRerordentlich ambivalent. Indem sie sich den im Roman dargebotenen Abhandlungen entzieht, unterhandelt Vote dessen narrative Energie und akzentuiert dadurch die Raume zwischen den Diskursen.
Die Erweiterung der Heterotopien bedeutet laut Krewani den Anspruch auf einen virtuellen Raum, in dem das Spiel mit den Geschlechteridentitaten und Korpergrenzen durchgefuhrt werden kann. Weiters bezieht sich Krewani auf Marjorie Garber, die in der Travestie eine dritte Geschlechtskategorie sieht und der zufolge die Aspekte des Gender- Bendings nicht nur im Entrucken der Grenzlinien von Geschlechterdifferenz, sondern auch im Transfer mit deren Kategorien liegen. In ihrem Text „Vested Interests"6geht Garber auf das Thema Travestie im Kriminalroman ein.
Der/die Cross-DresserIn verkorpert nach Garber die Krise gesellschaftlicher Kategorien schlechthin. Krewani erweitert Garbers These um eine raumliche Komponente, und argumentiert dass das Spiel mit der Geschlechterdifferenz ein Resultat eines leeren, unbeschriebenen Raums ist. Zuletzt lehnt sich Krewani an Angela Carters Roman „The Passion of New Eve" an, indem Carter imaginare Freiraume an Medienbilder anhangt, mediale Verfahren reflektiert und so indirekt einen medientheoretischen Beitrag zum Verhaltnis von Imagination und Medialitat leistet. Der Roman handelt von der Amerikareise eines jungen Mannes, der, von Amazonen entfuhrt, sich einer operativen Geschlechtsumwandlung unterziehen muss. Auf der Flucht begegnet sie ihrer ehemaligen Liebe, der Filmdiva Tristtessa. Carter koppelt in ihrem Roman, so Krewani, den semantischen Freiraum Wuste an den unkorperlichen Raum Film, der genauso wie die Wuste Grenzuberschreitungen von Geschlechtergrenzen gestattet.
AbschlieRend erwahnt Krewani zusammenfassend, dass die Offnung imaginarer Raume und die Umgestaltung der Semantiken des Raums bereits lange vor dem Internet durch eine Fulle von Wesensformen moglich waren.
Dr. Susanne Rieser lehrt Filmwissenschaft, Popularkulturanalyse und Frauenforschung an der Universitat Wien (derzeit halt sie eine Vorlesung zur Genderforschung am Institut fur Publizistik und Kommunikationswissenschaft), in Graz und an verschiedenen Kunstakademien. Momentan erhalt sie ein postdoktorales Fellowship- Stipendium und arbeitet an ihrem Buch uber Actionfilme: ,,The politics of the Spectacle".
Rieser diskutiert in ihrem Text ,,Geschlecht als Special Effekt"7die Moglichkeiten queerer Lesarten von Actionfilmen mittels Vergleich von Heroinnen im Hollywood- und Hong Kong Kino. Sie beschreibt Actionkino als Kino der spektakularen Grenzuberschreitungen, die sich nicht nur auf physische Korpergrenzen beschranken, sondern identitatspolitische Kategorien der Zugehorigkeit miteinschlieRen.
Rieser betont besonders die Vorzuge des asiatischen Actionkinos, welches vor allem durch zwei Inszenierungsformeln international beruhmt wurde. Filme mit high tech macho action a la John Woo, und durch Martial- Arts- Fabeln, in denen traditionelle asiatische Kampftechniken die Hauptattraktion bilden. Diese Martial- Arts- Fabeln bilden den Schwerpunkt in Riesers Betrachtungsweise. Diese weisen Rieser zu Folge radikale, revolutionare geschlechterpolitische Aspekte auf. Aufgrund der archaischen Bedeutung der Kampfkunstmeisterinnen in der chinesischen Folklore und Mythologie seien bisexuelle oder transgender Akzente in den Hongkonger Actionfilmen keine Seltenheit. Im Gegenteil: Travestie, Bi- und Transsexualitat, Hermaphrodismus und „polymorph-perverse“ Begehrensstrukturen seien sogar Vorraussetzungen zum Erlernen der allerhochsten Kampfkunste.
Die Filmtechnik von Actionfilmen verbindet eine maximale Schnittfrequenz mit einem polyrhythmischen Wechsel von langeren und kurzeren Einstellungen. Das Actionkino erzeuge einen speziellen Schaulustmoment, so Rieser, der nicht uber Narration, sondern uber das Visuelle Vergnugen erzeuge. Der spezielle Reiz asiatischer Kampfstunts ist das Resultat der mehrjahrigen Ausbildung der Darstellerinnen und einer hochprazisen Aufnahme- und Schnitttechnik.
Rieser meint, das kinetische Spektakel des Actionfilms provoziere regelrecht den- bei Mulvey diskutierten- mannlichen Blick, durch eine maximal dynamisierte Dingwelt ergeben sich neue Moglichkeiten der Umverteilung in der symbolischen Beziehung von Weiblichkeit und Mannlichkeit, was die Moglichkeit fur eine vom Geschlecht emanzipierte „visual agency“ beinhalte. Sie skizziert die Entwicklung des Genres im Hong Kong Kino seit den 1960er Jahren: War das kantonesische Kino der 60er Jahre noch gepragt von konservativ, anmutigen Weiblichkeitsentwurfen, kam es durch soziookonomische Strukturveranderungen (z.B. Wirtschaftsboom oder Modernisierung) zu einer neuen gesellschaftspolitischen Dimension von finanzieller, sozialer und urbaner Unabhangigkeit von Frauen.
Rieser geht dann ausfuhrlich auf eine herausragende Kinofigur dieser Zeit ein: Jane Bond. Diese Filmreihe war fur ein weibliches Fanpublikum konzipiert. Die Figur Jane Bond war eine normal aussehende junge, smarte Frau und eine hervorragende Kampferin. In den Jane Bond Filmen gingen Aggressions- und Gewaltakte hauptsachlich von den weiblichen Figuren aus. Jane wurde als asexuelle Figur inszeniert, ihre Sidekicks waren alle weibliche Verwandte- um moglichen lesbischen Subtexten vorzubeugen- und ihr Verlobter hatte den passiven Part der Beziehung (sofern uberhaupt vorhanden) inne.
In der zweiten Halfte der 60er Jahre wurden solche Figuren vom Mandarin Kino verdrangt. Nach dem Sieg der Kommunisten hatte die national chinesische Filmindustrie ihren Hauptabsatzmarkt verloren, auRerdem galt es die nationale Mannlichkeit wiederherzustellen. Obwohl sich die Hongkonger Filmindustrie von diesem Maskulinisierungsschub nie mehr vollstandig erholte, weist das chinesische Action Kino viel originellere Geschlechterinszenierungen auf als das Hollywood Kino, meint Rieser.
In einem Exkurs geht Rieser auf die Maskulinitat des Hollywood Actionkinos ein. In dieser Maskulinitat sei eine masochistische Ikonographie weiRer mannlicher Korper zu verorten. Ebenso wie Dyer8macht Rieser einen bedeutenden Moment in der Bodybuilidingkultur weiRer Manner fest. Die Tatigkeit- das Bodybuilding- selbst inkludiert Schmerz, Korperqualen und damit die Idee des Wertes von Schmerz. Dies kommt in Hollywoodfilmen durch die Kreuzigung von Bodybuildern zum Ausdruck. Bodybuilding hat drei Ziele: Masse, Muskeldefinition und Proportion. Die ersten beiden ergeben ein hartes Aussehen: der mit Haut uberzogene, aufgepumpte Muskel erzeugt eine straffe Oberflache, die Trennung der Muskelgruppen sieht aus wie in Stein gemeiRelt. Definition und Proportion betonen die Kontur einzelner Muskelgruppen und des gesamten Korpers. Nur ein harter, sichtlich konturierter Korper kann sich dem Horror, in die Femininitat eingetaucht zu werden, widersetzen. Gleichzeitig aber habe Bodybuilding geschlechtstransgessive Qualitaten, erzeuge physische Analogien zwischen weiblichen und mannlichen Korpern. Durch das Kunstliche, die Konstruiertheit und die Eitelkeit seien mannliche Bodybuildingkorper gleichzeitig weiblich konnotiert.
[...]