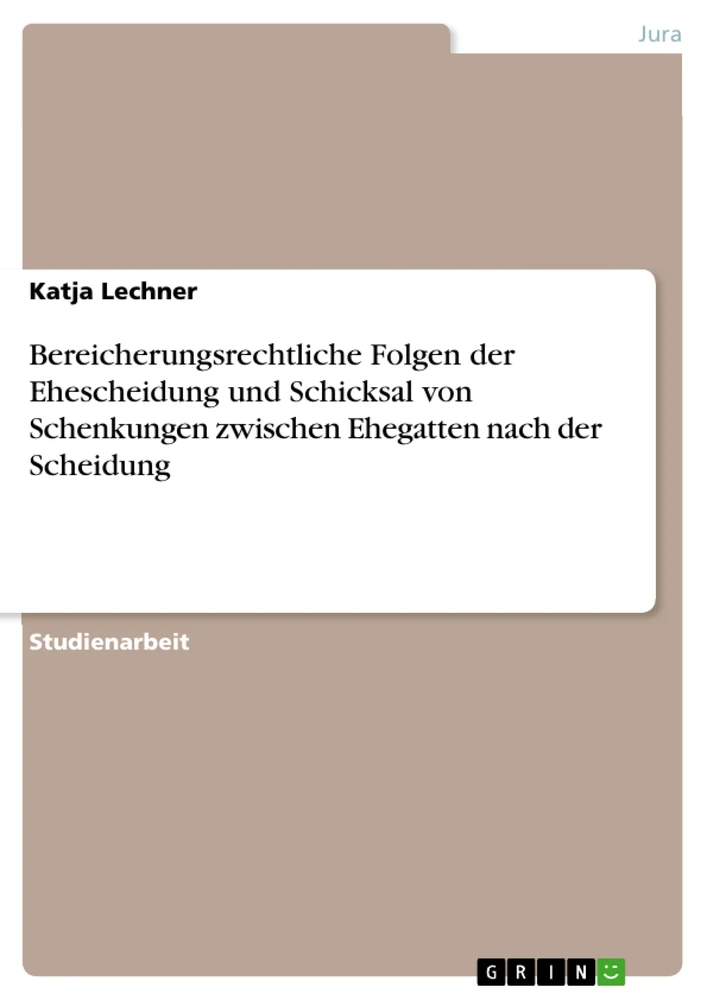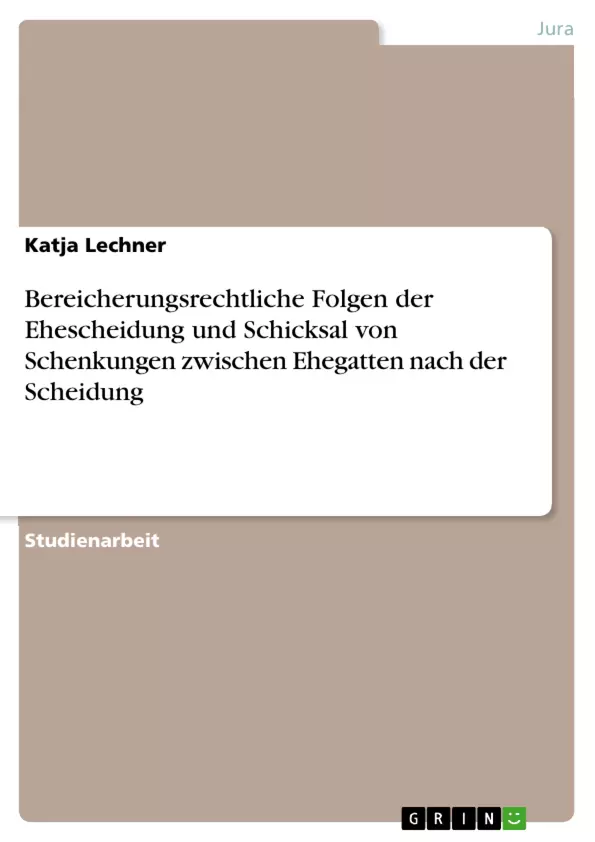Wird eine eheliche Lebensgemeinschaft aufgelöst, ergeben sich meist komplexe Fragen.
Zwei dieser Fragen werden in der vorliegenden Arbeit behandelt, nämlich die bereicherungsrechtlichen Folgen der Ehescheidung und das Schicksal von Schenkungen zwischen Ehegatten nach der Scheidung.
Das FamRÄG 2009, das seit 01.01.2010 gilt, hat im Zusammenhang mit der Aufteilung der ehelichen Ersparnisse und des ehelichen Gebrauchsvermögens weiträumige Änderungen mit sich gebracht, die hier natürlich berücksichtigt wurden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bereicherungsrechtliche Folgen der Ehescheidung
- Gegenstand der Aufteilung
- Eheliche Ersparnisse
- Eheliches Gebrauchsvermögen
- Ehewohnung
- Nicht zur Aufteilungsmasse gehören
- Aufteilungsgrundsätze
- Die Aufteilung
- Vorausvereinbarungen
- Eheliche Ersparnisse
- Eheliches Gebrauchsvermögen ohne Ehewohnung
- Ehewohnung
- Gerichtliche Abweichungen
- Vereinbarungen im Zusammenhang mit einer Scheidung
- Opt-in Opt-out der Ehewohnung
- Rechtslage vor FamRÄG 2009
- Gegenstand der Aufteilung
- Schicksal von Schenkungen zwischen Ehegatten nach der Scheidung
- Allgemeines
- Schenkungen unter Ehegatten
- Rückforderung von Schenkungen
- Widerruf der Schenkung wegen groben Undanks
- Analogie mit § 1266 ABGB
- Motivirrtum
- Bereicherungsrechtliche Rückabwicklung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den bereicherungsrechtlichen Folgen der Ehescheidung und dem Schicksal von Schenkungen zwischen Ehegatten nach der Scheidung. Sie analysiert die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen und untersucht die Auswirkungen der Trennung auf das Vermögen der ehemaligen Ehepartner.
- Eheliches Vermögen und dessen Aufteilung im Scheidungsfall
- Bereicherungsrechtliche Rückabwicklung von Schenkungen
- Rechtliche Rahmenbedingungen für Schenkungen unter Ehegatten
- Relevanz des FamRÄG 2009 für die Ehegüterrechtliche Folgen
- Spezialfälle wie die Ehewohnung und deren rechtliche Besonderheiten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Einleitung und gibt einen Überblick über die relevanten gesetzlichen Grundlagen, insbesondere das ABGB und das EheG. Das zweite Kapitel widmet sich den bereicherungsrechtlichen Folgen der Ehescheidung, wobei es die Aufteilung des ehelichen Vermögens in den Vordergrund stellt. Es untersucht die verschiedenen Arten von Vermögen, wie etwa eheliche Ersparnisse, Gebrauchsvermögen und die Ehewohnung, und beleuchtet die relevanten Aufteilungsgrundsätze und -verfahren.
Das dritte Kapitel konzentriert sich auf das Schicksal von Schenkungen zwischen Ehegatten nach der Scheidung. Es analysiert die Besonderheiten von Schenkungen im ehelichen Kontext und untersucht die Möglichkeiten der Rückforderung von Schenkungen im Scheidungsfall, insbesondere im Hinblick auf Widerruf, Analogie und bereicherungsrechtliche Rückabwicklung.
Schlüsselwörter
Ehescheidung, Bereicherungsrecht, Schenkungen, Ehegatten, Eheliches Vermögen, Aufteilung, FamRÄG 2009, ABGB, EheG, Rückforderung, Widerruf, Analogie, Motivirrtum, Rückabwicklung.
- Arbeit zitieren
- Katja Lechner (Autor:in), 2010, Bereicherungsrechtliche Folgen der Ehescheidung und Schicksal von Schenkungen zwischen Ehegatten nach der Scheidung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/153631