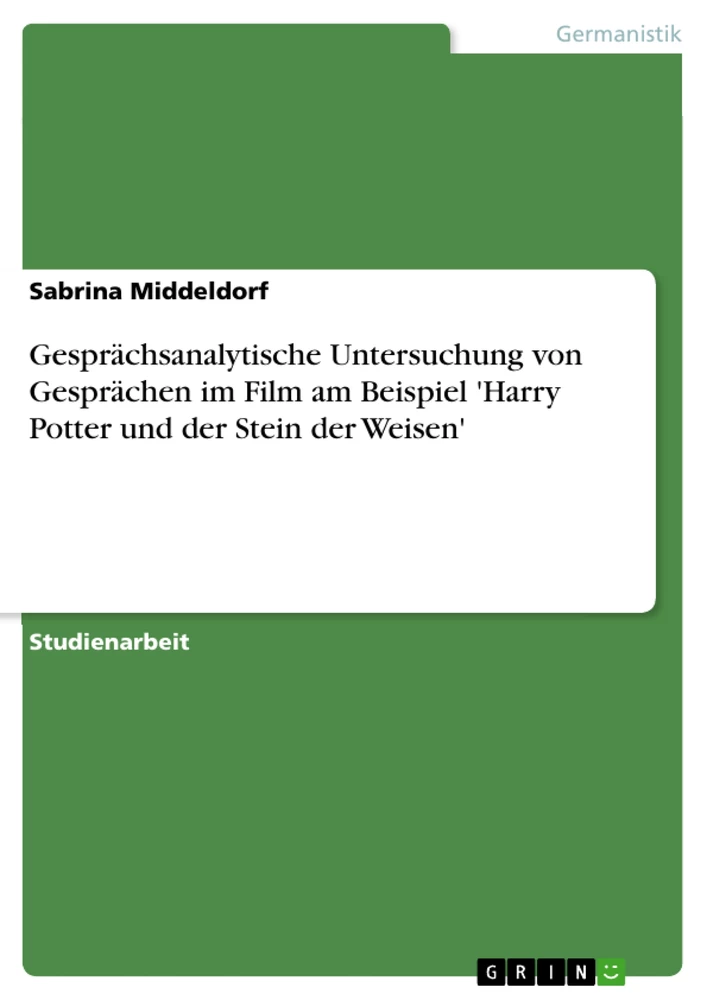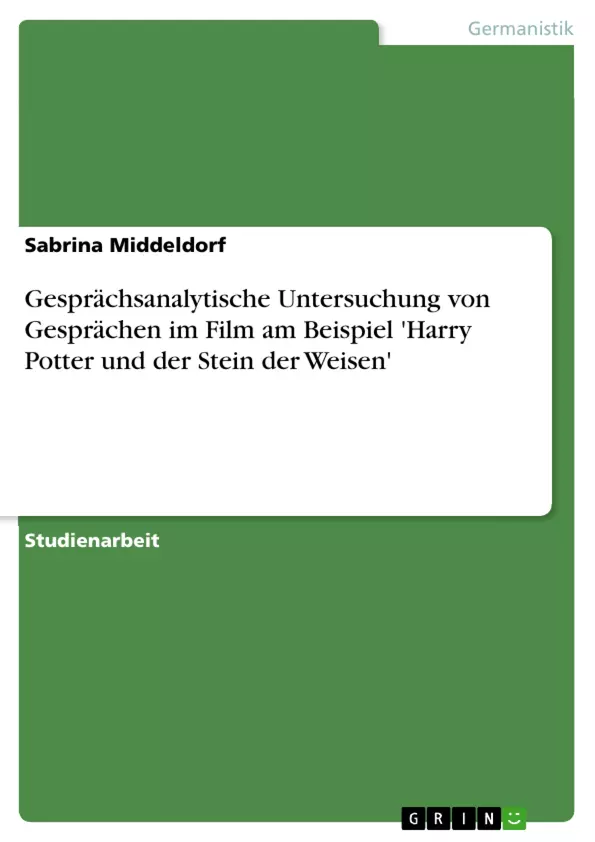Die Fähigkeit zu Denken und diese Gedanken verbal ausdrücken zu können unterscheidet uns von anderen Lebewesen enorm: dies ist es, was uns zum Menschen macht.„Wenn der Mensch[nun also] durch seine Sprachfähigkeit erst zum Menschen wird, dann bedeutet diese Sprachfähigkeit zugleich, dass der Mensch mit anderen Menschen in ein Gemeinsames und das heißt: in ein Gespräch eintreten kann.“
Das Gemeinsame ist der Grundstein unserer Existenz, nämlich die Möglichkeit sich mit anderen zu verständigen und auszutauschen. Da wir dies auf diverse Arten tun können, gibt es hier einigen Forschungsbedarf. So nimmt die Gesprächsanalyse einen nicht unerheblichen Teil der Linguistik ein. In dieser Hausarbeit stellt die Gesprächsanalyse die Grundlage für einige interessante Überlegungen: Warum gelingen uns die allermeisten Gespräche im privaten wie im beruflichen Sektor? Was sind die Gründe dafür, dass eine Kommunikation manchmal scheitert? Nach welchen Regeln führen wir Gespräche mit unseren Mitmenschen? Und wie verhält es sich mit diesen Fragen bei inszenierten Gesprächen, beispielsweise im Film? Denn auch wenn solcherlei Gespräche auf den ersten Blick wie ‚echte, natürliche’ Gespräche wirken, bemerkt man beim genauen Zuschauen und –hören etwas Fremdartiges: Beispielsweise erklärt in „Illuminati“, dem Film zu Dan Bown’s bekanntem Roman, ein Bischof einem anderen Bischof welche Aufgaben ein Camerlengo hat. Auf den ersten Blick erscheint dieses Gespräch als höchst interessant, da dies einem Großteil der Zuschauer vorher sicher nicht bekannt war. Denkt man jedoch etwas länger darüber nach, erkennt man schnell eine Absurdität: ein Mitglied des Klerus erklärt einem anderen Mitglied des Klerus die Aufgaben eines dritten Mitglieds des Klerus. Das Problem bei solchen Filmgesprächen ist, dass dem Zuschauer auf der einen Seite Informationen übermittelt werden müssen, diese Informationsweitergabe auf der anderen Seite jedoch in einen realistischen, logischen Zusammenhang gestellt werden muss. Da ein Drehbuchautor diesem Zwiespalt nicht immer entkommen oder ihn zumindest geschickt umgehen kann, treffen wir häufig auf Filmszenen, die befremdlich wirken.
Filmgespräche sind aber noch aus einem anderen Grund höchst interessant: auch wenn Filmgespräche generell nur gespielt werden, ist es trotzdem das Ziel des Films, den Zuschauer in eine andere Realität zu entführen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Gesprächsanalyse
- 2.1 Kategorien der Gesprächsanalyse und ihre Bedeutung im Film
- 2.1.1 Sprecherwechsel
- 2.1.2 Gliederungssignale und back-channel-behaviour
- 2.1.3 Paarcharakter
- 2.1.4 Maxime nach Grice
- 2.1.5 Implikaturen
- 2.1.6 Sprechakte und Hörverstehensakte
- 2.2 Kriterien zur Analyse von Gesprächen im Film
- 3. Analyse der Filmsequenzen
- 3.1 Eine kurze Inhaltsangabe
- 3.2 Wer ist Hagrid? - Analyse der ersten Szene
- 3.3 Professor Snape - Analyse der zweiten Szene
- 3.4 Woher wisst ihr von Fluffy? - Analyse der dritten Szene
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Gesprächsanalyse und deren Bedeutung im Film. Die Arbeit analysiert anhand ausgewählter Szenen aus „Harry Potter und der Stein der Weisen“, wie Gespräche im Film inszeniert werden und welche Besonderheiten sie im Vergleich zu realen Gesprächen aufweisen.
- Analyse von Gesprächskategorien im Kontext des Films
- Untersuchung der Bedeutung von Sprecherwechsel, Gliederungssignalen und back-channel-behaviour in Filmgesprächen
- Entwicklung eines Kriterienkatalogs zur Analyse von Gesprächen im Film
- Anwendung des Kriterienkatalogs auf ausgewählte Szenen aus „Harry Potter und der Stein der Weisen“
- Herausarbeitung der Besonderheiten von Gesprächen im Film
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Gesprächsanalyse ein und erläutert deren Relevanz für die Untersuchung von Gesprächen im Film. Sie beleuchtet die Besonderheiten von inszenierten Gesprächen und hebt die Bedeutung von Konversationen für die immersive Wirkung von Filmen hervor.
- Kapitel 2: Gesprächsanalyse: Dieses Kapitel stellt grundlegende Konzepte der Gesprächsanalyse vor und untersucht die Bedeutung einzelner Kategorien für die Analyse von Gesprächen im Film. Dabei wird auf den Paarcharakter von Gesprächen, die Bedeutung von Sprecherwechsel und die Rolle von Gliederungssignalen und back-channel-behaviour eingegangen.
- Kapitel 3: Analyse der Filmsequenzen: Hier werden anhand von drei ausgewählten Szenen aus „Harry Potter und der Stein der Weisen“ konkrete Beispiele für die Inszenierung von Gesprächen im Film analysiert. Die Analyse fokussiert auf die Anwendung der im vorherigen Kapitel vorgestellten Konzepte und deren Bedeutung für die Vermittlung von Informationen und die Schaffung einer realistischen Atmosphäre.
Schlüsselwörter
Gesprächsanalyse, Filmgespräche, Inszenierung, Sprecherwechsel, Gliederungssignale, back-channel-behaviour, Konversationsanalyse, "Harry Potter und der Stein der Weisen", Realismus, Immersion, Informationstransfer
- Arbeit zitieren
- Sabrina Middeldorf (Autor:in), 2010, Gesprächsanalytische Untersuchung von Gesprächen im Film am Beispiel 'Harry Potter und der Stein der Weisen', München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/153252