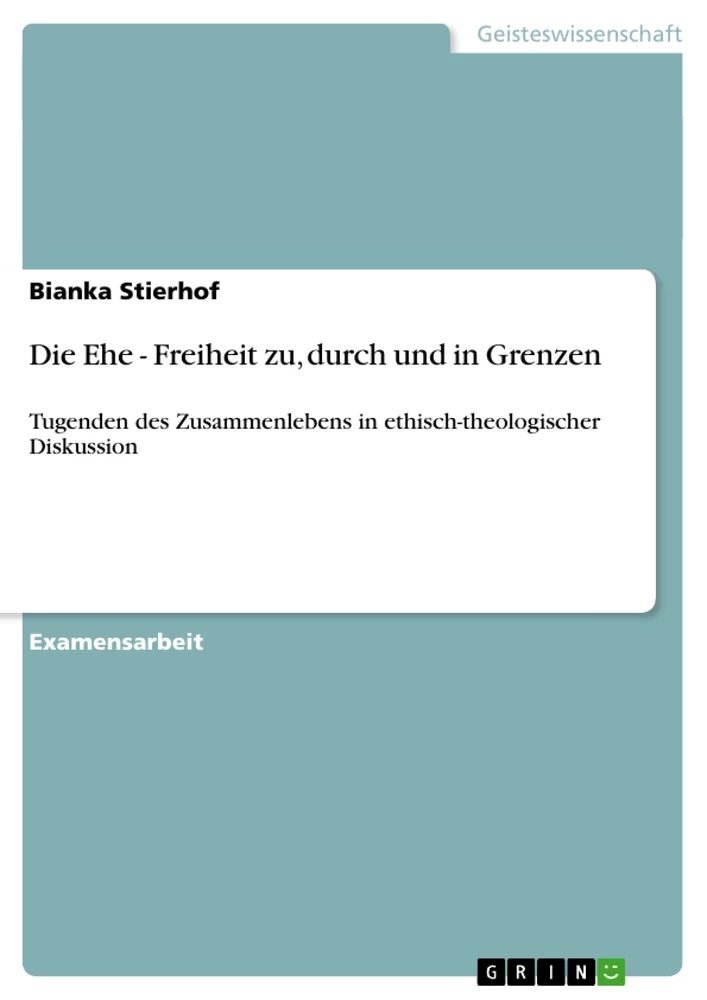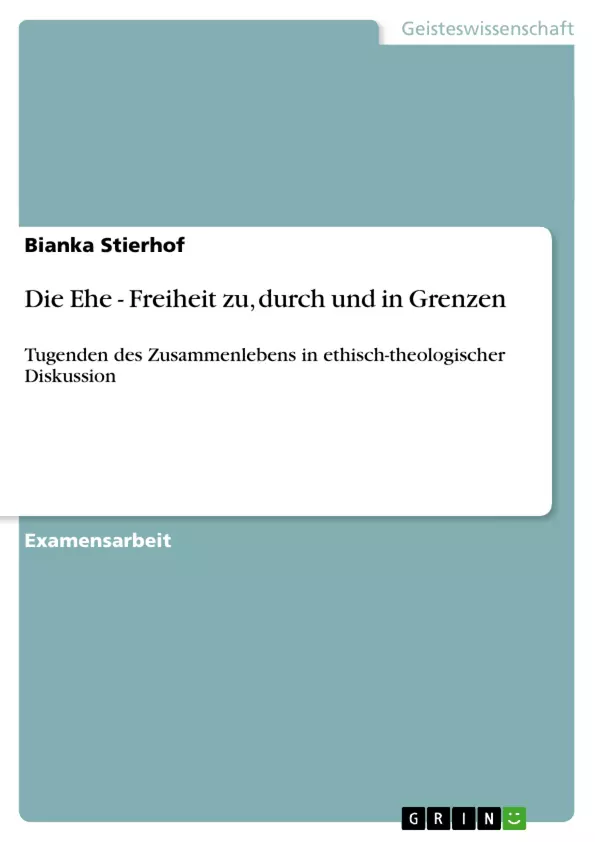Die christliche Sicht bezüglich Liebe, Partnerschaft und Familie unterstreicht deutlich die dauerhafte Verbindung, die Menschen verantwortungsvoll gemeinsam schließen. Den Ort der Partnerschaft sieht die traditionelle Theologie in der Ehe, die als äußere Gestalt eine schützende Institution darstellt und im Inneren durch Liebe und Treue von den Partnern ausgefüllt wird. Dabei hat das „Füreinander Vorrang vor der Selbstverwirklichung des Ich“, was in kollektivistischen Sozialordnungen, in denen besonders der Schwächeren gedacht wird, eine Tugend darstellt. Ob die Krise der Ehe, von der seit Jahrzehnten die Rede ist, nun auf die Lebensform Ehe an sich im Wandel der Zeit oder auf der Krise der Institution gründet, bleibt eine zentrale Streitfrage in der Ethik. Fakt ist, dass die Ehe nicht mehr selbstverständlich ist. Warum sie jedoch wichtig und sinnvoll ist, soll in dieser Arbeit dargestellt werden.
Das Skelett der Problembehandlung ist an dem Grundriss des Urteilsverlaufs angelehnt, den Heinz Eduard Tödt in seinem Werk Perspektiven theologischer Ethik dargelegt hat. Demnach gliedert sich die Urteilsfindung in sechs Schritte: Problemwahrnehmung, Situationsanalyse, Verhaltensentwurf, Auswahl und Durchsicht von Normen, Prüfung der Verbindlichkeit von Verhaltensmöglichkeiten und schließlich der Urteilsfindung, welche mit Blick auf die Schule didaktisch entfaltet wird.
Die Fragestellungen drehen sich darum, was in der menschlichen Lebenspraxis gut ist und warum die Stabilität einer Partnerschaft zu einem guten Leben gehört. Schließlich sollten Verhaltensweisen als Konsequenz einer evangelischen Gesinnung herausgearbeitet werden. Wie Schleiermacher sagte: „Was muss werden, weil das religiöse Selbstbewusstsein ist?“ Da die Definition eines Problems immer nur subjektiv bestimmt werden kann, ist in den weiteren Ausführungen zu bedenken, dass die Fragestellungen und die Verhaltensoptionen in der Perspektive junger Erwachsener gestellt wurden, geprägt durch ein pluralistisches, westliches und stark von Medien beeinflusstes Weltbild.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Einleitung
- 1.1 Hinführung zum Thema
- 1.2 Vorgehensweise
- 1.3 Themenrahmen
- 2. Partnerschaft und Ehe im Wandel der Zeit
- 2.1 Raum-zeitlicher Horizont
- 2.1.1 Ehe und Familie bei den Erzvätern
- 2.1.2 Eheschließung zu Zeiten Jesu und im Urchristentum
- 2.1.3 Augustinus von Hippo und Thomas von Aquin zum Ehesakrament
- 2.1.4 Neue Ansichten im Zeitalter der Reformation
- 2.1.5 Verdrängung der Kirche als Moralinstanz seit der Aufklärung
- 2.2 Zukunftsperspektiven
- 2.3 Problembestimmung und religionspädagogische Relevanz
- 2.1 Raum-zeitlicher Horizont
- 3. Kontextanalyse - Zeitgenössische Moral zwischen Zweck und Würde
- 3.1 Die rechtliche Dimension von Partnerschaft und Ehe
- 3.2 Die Rolle und das Bild der Frau
- 3.3 Lebensformen und Lebensstile im Wandel
- 3.4 Sozialwissenschaftliche Erkenntnisse zur Instabilität der Ehe
- 3.5 Die ,,Erlebnisgesellschaft"
- 3.6 Interkulturelle Eindrücke zum Ehe- und Familienleben
- 3.7 Lebensformen und ihre Vielfalt
- 3.8 Sozialpsychologische Erkenntnisse zum Sozialverhalten
- 4. Mögliche Verhaltensoptionen im Entwurf und ihre didaktische Relevanz
- 4.1 Menschliches Zusammenleben ist nicht beliebig
- 4.2 Religionsunterricht und Wertevermittlung
- 5. Bausteine für ein gelingendes Zusammenleben
- 5.1 Voraussetzungen
- 5.1.1 Prinzipien, Normen und Tugenden
- 5.1.2 Werte und Gewissen
- 5.1.3 Freiheit
- 5.1.4 Das Gerüst der Ehe - Treue, Institution, Verheißung
- 5.1.4.1 Treue
- 5.1.4.2 Institution
- 5.1.4.3 Verheißung
- 5.2 Glaubensinhalte
- 5.2.1 Zur Ehe und Partnerschaft in den Bekenntnisschriften
- 5.2.2 Der Katholische Katechismus zur Ehe
- 5.2.3 Warum noch heiraten?
- 5.3 Die ,,Früchte“ der Ehe
- 5.3.1 Freiheitsmoment Glück und Liebe
- 5.3.2 Freiheitsmoment Dauerhaftigkeit, Gegenseitigkeit und Vergebung
- 5.3.3 Freiheitsmoment Kinderwunsch, Elternschaft und Familie
- 5.3.4 Sexualität und Treue
- 5.1 Voraussetzungen
- 6. Welche Verhaltensoptionen können universell gelten?
- 6.1 Familie Heimat und Ort der ersten Sozialisation
- 6.2 Warum ist es für viele Menschen heute so schwer sich festzulegen?
- 6.3 Der Inhalt des christlichen Ethos und das Gelingen einer Partnerschaft
- 6.4 Lerninhalte und Lernziele für den Unterricht - Christliches Ethos
- 6.4.1 Die Tugend der Empathie und Solidarität
- 6.4.2 Produktives Konfliktmanagement
- 6.4.2.1 Der Konflikt
- 6.4.2.2 Kommunikationsmodelle
- 6.4.3 Nächsten- und Feindesliebe – Ethos der Einseitigkeit
- 7. Verhaltensorientiertes Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zulassungsarbeit befasst sich mit der Ehe und den Tugenden des Zusammenlebens in ethisch-theologischer Diskussion. Sie analysiert die Entwicklung der Ehe im Wandel der Zeit und beleuchtet die Herausforderungen und Chancen der Partnerschaft in der heutigen Gesellschaft. Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung der Ehe als Institution und die Rolle der christlichen Werte im Kontext der modernen Lebenswelt zu erforschen.
- Die Ehe im Wandel der Zeit
- Die Herausforderungen der modernen Partnerschaft
- Die Rolle der christlichen Werte im Zusammenleben
- Die Bedeutung der Ehe als Institution
- Die Bedeutung von Tugenden für ein gelingendes Zusammenleben
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Ehe und die Relevanz der ethisch-theologischen Diskussion ein. Sie beleuchtet die Problematik der Instrumentalisierung des Menschen in der heutigen Zeit und stellt die Frage nach dem Fundament der romantischen Liebesehe.
Das zweite Kapitel analysiert die Entwicklung der Ehe im Wandel der Zeit, beginnend bei den Erzvätern bis hin zur modernen Gesellschaft. Es beleuchtet die verschiedenen Ansichten zur Ehe in unterschiedlichen Epochen und stellt die Verdrängung der Kirche als Moralinstanz seit der Aufklärung dar.
Das dritte Kapitel widmet sich der Kontextanalyse der zeitgenössischen Moral. Es untersucht die rechtliche Dimension von Partnerschaft und Ehe, die Rolle der Frau in der Gesellschaft, die Vielfalt der Lebensformen und die sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse zur Instabilität der Ehe. Außerdem werden die ,,Erlebnisgesellschaft" und interkulturelle Eindrücke zum Ehe- und Familienleben beleuchtet.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit möglichen Verhaltensoptionen im Entwurf und deren didaktischer Relevanz. Es betont, dass menschliches Zusammenleben nicht beliebig ist und die Bedeutung des Religionsunterrichts für die Wertevermittlung.
Das fünfte Kapitel stellt Bausteine für ein gelingendes Zusammenleben vor. Es analysiert Voraussetzungen wie Prinzipien, Normen, Werte, Gewissen und Freiheit sowie das Gerüst der Ehe, das aus Treue, Institution und Verheißung besteht. Außerdem werden Glaubensinhalte zur Ehe und Partnerschaft in den Bekenntnisschriften und im Katholischen Katechismus beleuchtet. Abschließend werden die ,,Früchte" der Ehe, wie Glück, Liebe, Dauerhaftigkeit, Gegenseitigkeit, Vergebung, Kinderwunsch, Elternschaft und Sexualität, betrachtet.
Das sechste Kapitel untersucht die Frage, welche Verhaltensoptionen universell gelten können. Es beleuchtet die Bedeutung der Familie als Heimat und Ort der ersten Sozialisation und die Herausforderungen, die es für viele Menschen heute schwer machen, sich festzulegen. Außerdem wird der Inhalt des christlichen Ethos und dessen Bedeutung für das Gelingen einer Partnerschaft analysiert. Abschließend werden Lerninhalte und Lernziele für den Unterricht im Bereich des christlichen Ethos, wie die Tugend der Empathie und Solidarität, produktives Konfliktmanagement und Nächsten- und Feindesliebe, vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Ehe, Partnerschaft, Tugenden, Zusammenleben, ethisch-theologische Diskussion, christliche Werte, moderne Lebenswelt, Wandel der Zeit, Instrumentalisierung, romantische Liebesehe, Familie, Gesellschaft, Religionsunterricht, Wertevermittlung, Freiheit, Treue, Institution, Verheißung, Glaubensinhalte, Bekenntnisschriften, Katholischer Katechismus, Glück, Liebe, Dauerhaftigkeit, Gegenseitigkeit, Vergebung, Kinderwunsch, Elternschaft, Sexualität, Konfliktmanagement, Empathie, Solidarität, Nächstenliebe, Feindesliebe.
- Arbeit zitieren
- Bianka Stierhof (Autor:in), 2009, Die Ehe - Freiheit zu, durch und in Grenzen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/152361