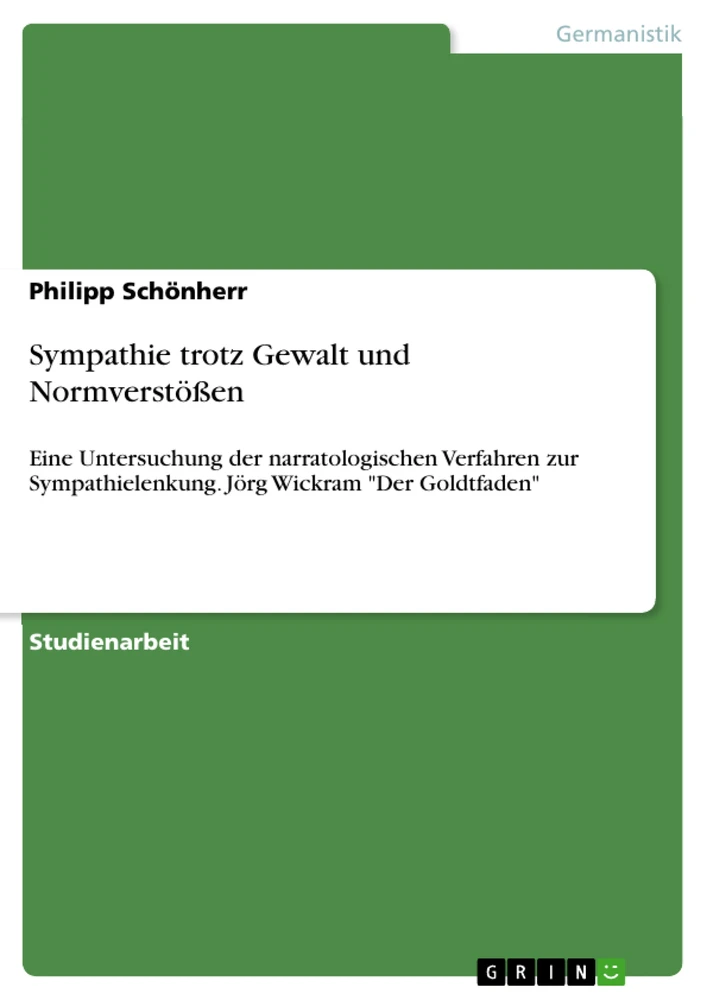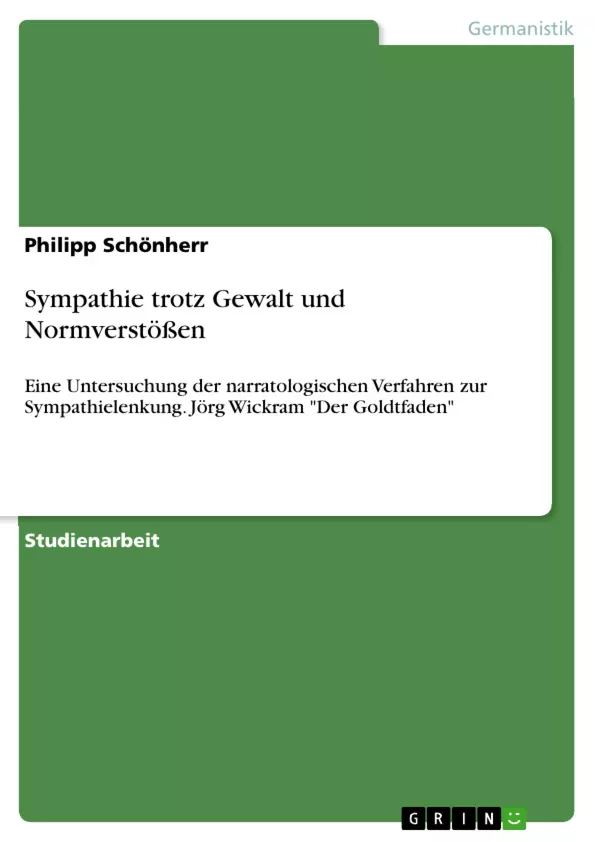Wie sichert Wickram seinem Protagonisten, der durch seinen sozialen Aufstieg, nicht nur gegen jede zeitgenössische Wahrscheinlichkeit verstößt, sondern auch ein Ordnungsprinzip jener Zeit infrage stellt, das Wohlwollen einer Leserschaft?
Diese Untersuchung zu Jörg Wickrams "Der Goldtfaden" befasst sich mit einem noch vergleichsweise jungen Teilbereich der germanistisch-mediävistischen Forschung, nämlich der Sympathielenkung. Das bedeutet konkret, dass narratologische Verfahren und Strategien untersucht werden, die darauf abzielen, bei einer Leserschaft Emotionen der Empathie, Sympathie und einem potenziellen Engagement gegenüber fiktiven Figuren zu erzeugen oder je nach Erfolg oder Misserfolg der Ausführung, Antipathie und Distanz hervorrufen.
Innerhalb der germanistisch-mediävistischen Forschung herrscht weitestgehend Einigkeit darüber, dass, wie Waghäll es treffend zusammenfasst: "[Wickrams] Schriften [...] der Frage [gelten], wie man die Menschen und die Welt verbessern kann". Hinsichtlich dieses Anspruchs veranschaulichen Werke wie "Der Jungen Knaben Spiegel" oder der Roman "Von guten und bösen Nachbarn", die Bedeutung von Bildung, Ethik, Moral und Möglichkeiten eines friedlichen und produktiven Miteinanders, das auf Konzepten der Freundschaft, Ehe und alternativen Familienmodellen aufbaut. Wickrams Texte weisen dabei einen, besonders wenn es um die Erziehung der Jugend geht, belehrenden Ton und didaktischen Anspruch auf. Dementsprechend darf Wickram durchaus als ein kritischer Beobachter zeitgenössischer Erfahrungswelten betrachtet werden, der gesellschaftliche Probleme und Ungerechtigkeiten thematisiert und alternative Lebensentwürfe konzipiert und literarisch veranschaulicht. Dass ihm hierbei eine gesonderte Stellung zukommt, liegt unter anderem darin begründet, dass er bis dato der erste, namentlich bekannte volkssprachliche Autor ist, dessen Romane größtenteils keine direkten Vorlagen aufweisen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Empathie und Sympathielenkung – Ein Überblick
- 3. Der Goldtfaden
- 3.1 Göttliche Prädestination und erste Umsetzung einer 'idealen' Herrschaft
- 3.2 Leufried bei Hofe – Karriere, Liebe und der Tun-Ergehen-Zusammenhang
- 3.3 Gewalt und ritterliche Taten eines Hirtensohnes
- 3.4 Realisierung einer Utopie und Überführung in bestehende Ordnung
- 4. Endergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die narratologischen Verfahren der Sympathielenkung in Jörg Wickrams "Der Goldtfaden". Ziel ist es, zu analysieren, wie Wickram trotz des sozialen Aufstiegs seines Protagonisten und dessen Infragestellung gesellschaftlicher Normen, das Wohlwollen des Lesers sichert. Die Analyse konzentriert sich auf die Strategien, die Empathie und Sympathie beim Leser erzeugen sollen.
- Sozialer Aufstieg und soziale Mobilität in einer ständischen Gesellschaft
- Spannungsverhältnis zwischen individueller Entwicklung und gesellschaftlichen Normen
- Narratologische Strategien der Sympathielenkung
- Die Darstellung von Gewalt und deren Legitimierung
- Die Umsetzung einer idealen Gesellschaft im Roman
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung etabliert Jörg Wickram als kritischen Beobachter gesellschaftlicher Missstände im 16. Jahrhundert, der alternative Lebensentwürfe in seinen volkstümlichen Romanen vorstellt. Sie hebt Wickrams besondere Stellung als erster namentlich bekannter volkstümlicher Romanautor hervor, der sich von traditionellen Autorisierungsinstanzen löst und stattdessen auf Glaubwürdigkeit durch Exemplarizität und Wahrscheinlichkeit setzt. Die Einleitung führt den Fokus auf die Aufhebung sozialer Determination und die soziale Mobilität in Wickrams Romanen ein und kündigt die Untersuchung der Sympathielenkung in "Der Goldtfaden" an, ein bis dato wenig erforschtes Gebiet der Wickram-Forschung.
2. Empathie und Sympathielenkung – Ein Überblick: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Ansätze der Sympathieforschung, die, trotz ihrer Relevanz und ihres interdisziplinären Charakters, in der Literaturwissenschaft bisher wenig Beachtung gefunden haben. Es legt die theoretischen Grundlagen für die anschließende Analyse des "Goldfadens" und definiert die methodischen Ansätze der Untersuchung.
3. Der Goldtfaden: Das Kapitel analysiert die verschiedenen Aspekte von Wickrams "Der Goldtfaden" im Hinblick auf die Sympathielenkung. Es wird ein Überblick über den Inhalt gegeben, gefolgt von einer detaillierten Untersuchung verschiedener Szenen. Dabei wird die Geburtsszene und Leufrieds schulische Karriere analysiert, um zu zeigen, wie die Erwartungshaltung des Lesers geschaffen und durch einen Bruch mit dieser Erwartung die Handlung vorangetrieben wird. Die Analyse wird sich außerdem mit der Liebesgeschichte des Protagonisten und der Darstellung von Gewalt befassen. Schließlich wird die Umsetzung von Leufrieds Gesellschaftsvision im Roman betrachtet. Die Darstellung der Liebesbeziehung und der Gewalt wird im Hinblick auf den "Tun-Ergehen-Zusammenhang" und die Legitimation von Handlungen untersucht.
Schlüsselwörter
Jörg Wickram, Der Goldtfaden, Sympathielenkung, Narratologie, soziale Mobilität, ständische Gesellschaft, Empathie, Gewalt, Utopie, Didaktik, frühneuhochdeutsche Literatur, sozialer Aufstieg.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus der Analyse von "Der Goldtfaden"?
Die Analyse konzentriert sich auf die narratologischen Verfahren der Sympathielenkung in Jörg Wickrams "Der Goldtfaden". Ziel ist es, zu untersuchen, wie Wickram trotz des sozialen Aufstiegs seines Protagonisten und dessen Infragestellung gesellschaftlicher Normen, das Wohlwollen des Lesers sichert. Die Analyse konzentriert sich auf die Strategien, die Empathie und Sympathie beim Leser erzeugen sollen.
Welche Themenschwerpunkte werden in Bezug auf "Der Goldtfaden" untersucht?
Die Themenschwerpunkte umfassen:
- Sozialer Aufstieg und soziale Mobilität in einer ständischen Gesellschaft
- Spannungsverhältnis zwischen individueller Entwicklung und gesellschaftlichen Normen
- Narratologische Strategien der Sympathielenkung
- Die Darstellung von Gewalt und deren Legitimierung
- Die Umsetzung einer idealen Gesellschaft im Roman
Was ist die Hauptaussage der Einleitung bezüglich Jörg Wickram?
Die Einleitung etabliert Jörg Wickram als kritischen Beobachter gesellschaftlicher Missstände im 16. Jahrhundert, der alternative Lebensentwürfe in seinen volkstümlichen Romanen vorstellt. Sie hebt Wickrams besondere Stellung als erster namentlich bekannter volkstümlicher Romanautor hervor, der sich von traditionellen Autorisierungsinstanzen löst und stattdessen auf Glaubwürdigkeit durch Exemplarizität und Wahrscheinlichkeit setzt.
Was behandelt das Kapitel über Empathie und Sympathielenkung?
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Ansätze der Sympathieforschung und legt die theoretischen Grundlagen für die anschließende Analyse des "Goldfadens" fest.
Welche Aspekte von "Der Goldtfaden" werden im dritten Kapitel analysiert?
Das Kapitel analysiert die verschiedenen Aspekte von Wickrams "Der Goldtfaden" im Hinblick auf die Sympathielenkung, einschließlich der Geburtsszene, Leufrieds schulische Karriere, die Liebesgeschichte des Protagonisten und die Darstellung von Gewalt. Es wird auch die Umsetzung von Leufrieds Gesellschaftsvision im Roman betrachtet.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Analyse von "Der Goldtfaden"?
Relevante Schlüsselwörter sind: Jörg Wickram, Der Goldtfaden, Sympathielenkung, Narratologie, soziale Mobilität, ständische Gesellschaft, Empathie, Gewalt, Utopie, Didaktik, frühneuhochdeutsche Literatur, sozialer Aufstieg.
- Arbeit zitieren
- Philipp Schönherr (Autor:in), 2021, Sympathie trotz Gewalt und Normverstößen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1522887