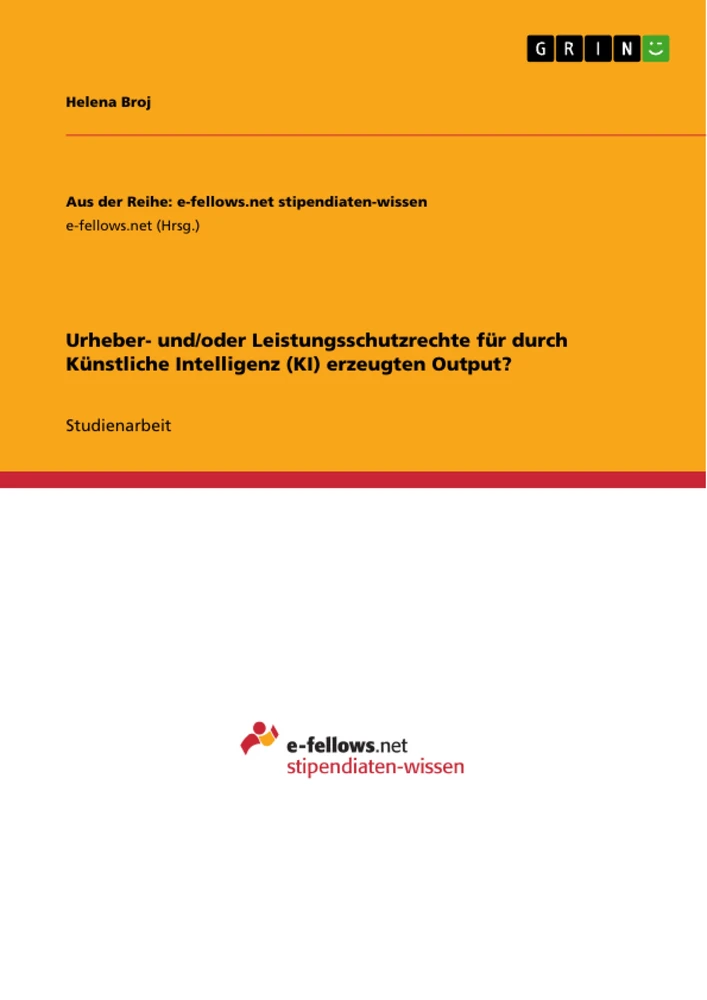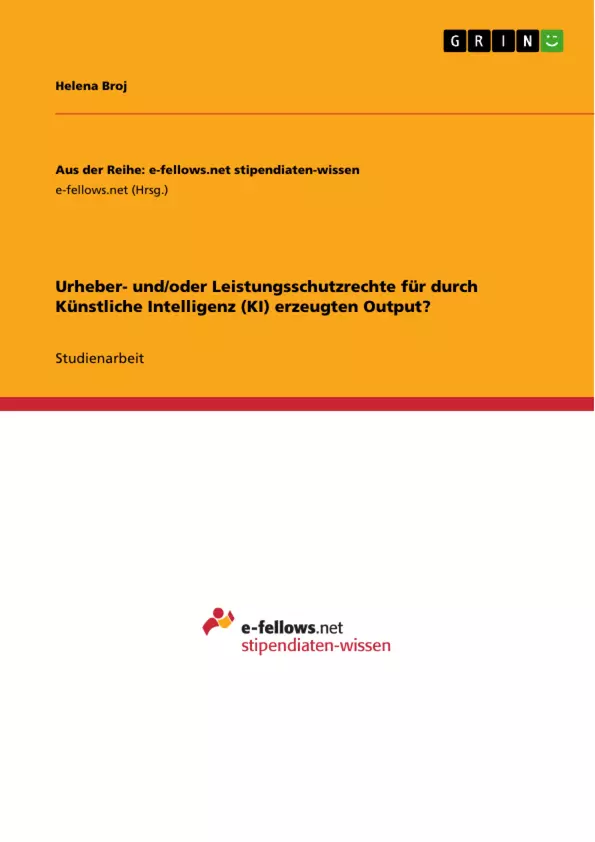Im Rahmen dieser Arbeit soll insbes. auf die Schutzfähigkeit für durch KI erzeugten Output eingegangen werden. Im Folgenden wird zunächst untersucht, inwieweit ein Schutz unter dem aktuellen deutschen schöpferzentrierten Urheberrecht denkbar ist. Der Großteil des Urheberrechts ist zunächst anhand analoger Technologien entwickelt worden. Dessen Anpassungsbedarf an den technischen Fortschritt und zunehmenden Einfluss des Internets wurde bereits erkannt, sodass in den vergangenen Jahren Anpassungen es Immaterialgüterrechts vorgenommen wurden. Es wird daher darauf eingegangen, wie rechtlich und sachadäquat mit KI-Erzeugnissen umgegangen werden sollte und ob ein Schutz de lege ferenda angebracht wäre.
Ende 2018 wurde das Portrait „Edmond de Belamy“ für 432.500 $ versteigert. Zunächst erscheint ein solcher Versteigerungswert für ein Gemälde nicht außergewöhnlich. Besonders ist allerdings, dass es sich um ein Kunstwerk handelt, das von einer künstlichen Intelligenz (KI) erstellt wurde. Unterschrieben wurde es mit „min G max D Ex[log(D(x))]+Ez[log(1-D(G(z)))]“, dem Algorithmus der das Werk erzeugt hat. Bereits 2016 wurde im Rahmen eines Projektes der TU Delft das Kunstwerk „The next Rembrandt“ erstellt. Ziel war es, ein Bild zu produzieren, welches den Gemälden des echten Künstlers Rembrandt täuschend ähnlich ist. Hinsichtlich Ästhetik und Qualität unterscheidet es sich nur geringfügig von den Gemälden des echten Rembrandts.
Festzustellen ist, dass KI-Arbeiten im Bereich kreativer Gestaltungen sich in ihrer Qualität immer mehr dem Schaffen von Menschen annähern. Eine Studie zeigte auf, dass KI-Gestaltungen z.T. sogar als besser bewertet wurden als von menschlichen Künstlern geschaffene Werke.
Die durch den Fortschritt der Technik zunehmende Autonomie von KI-Systemen lässt die Möglichkeit des kreativen und produktiven Tätigwerdens ohne oder mit nur geringem menschlichem Einfluss zu. Dadurch verschwimmt die Grenze zwischen natürlicher und künstlicher Intelligenz immer mehr. KI-Technologien erfassen zunehmend mehr Bereiche unseres Lebens, sodass auch ihr Schutz und Regelungen zum Umgang mit ihnen immer mehr an Bedeutung gewinnen.
Dass KI in der Lage sind Arbeiten zu erstellen, die ebenso kreativ und originell wirken wie menschliche Schöpfungen, wirft die Frage nach deren urheberrechtlichen Schutz auf.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Definition KI
- C. Schutz des KI-Systems
- D. Schutz des KI-Outputs de lege lata
- I. Schutz durch das deutsche Urheberrecht
- 1. Allgemeine Schutzvoraussetzungen
- 2. Schutz als Werk iSv §2 II UrhG
- a) Werkzeug
- b) Autonom handelnde KI
- c) Grenze
- d) Zurechnung der Urheberschaft
- e) Praktische Probleme
- 3. Zwischenergebnis
- II. Unionsrechtlicher Rahmen
- III. British Copyright Law
- IV. US Copyright Law
- V. Zwischenergebnis
- VI. Schutz durch verwandte Leistungsschutzrechte
- 1. Allgemeiner Zweck
- 2. Licht- und Laufbilder
- 3. Datenbankherstellerrecht
- 4. Zwischenergebnis
- VII. Zusammenfassung Schutz de lege lata
- I. Schutz durch das deutsche Urheberrecht
- E. Schutz des KI-Outputs de lege ferenda
- I. Schutzbedürfnis
- II. Anpassung des geltenden Rechts
- III. Regelungsmöglichkeiten
- IV. Gemeinfreiheit
- F. Endergebnis
- I. Zusammenfassung
- II. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die urheber- und leistungsschutzrechtliche Stellung von durch Künstliche Intelligenz (KI) erzeugten Outputs. Ziel ist es, den aktuellen rechtlichen Rahmen (de lege lata) zu analysieren und mögliche zukünftige Regelungen (de lege ferenda) zu diskutieren.
- Urheberrechtlicher Schutz von KI-generierten Werken
- Anwendbarkeit verwandter Leistungsschutzrechte
- Vergleichende Betrachtung des Rechts in verschiedenen Ländern (Deutschland, EU, Großbritannien, USA)
- Analyse des Problems der Urheberschaftszurechnung
- Diskussion möglicher Rechtsreformen
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Urheberrechts für KI-generierte Outputs ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie verdeutlicht die Komplexität der Fragestellung, die sich aus dem Zusammenspiel von technologischem Fortschritt und bestehenden Rechtsnormen ergibt. Die Einleitung dient als wichtiger Kontext für die folgenden Kapitel, welche sich detaillierter mit den einzelnen Aspekten befassen.
B. Definition KI: Dieses Kapitel liefert eine prägnante Definition von Künstlicher Intelligenz, die für die juristische Betrachtung relevant ist. Es wird darauf eingegangen, welche Arten von KI-Systemen im Kontext des Urheberrechts relevant sind und welche Eigenschaften diese Systeme aufweisen müssen, um als „Schöpfer“ von Werken in Betracht gezogen zu werden. Die Abgrenzung zu anderen Technologien wird ebenfalls thematisiert, um Missverständnisse zu vermeiden.
C. Schutz des KI-Systems: Das Kapitel beleuchtet die Schutzmöglichkeiten des KI-Systems selbst, getrennt von den durch die KI erstellten Outputs. Es wird diskutiert, welche Aspekte des Systems schützenswert sind, zum Beispiel der Quellcode oder das Design, und welche Rechtsgebiete zum Schutz herangezogen werden können, wie z.B. das Patentrecht oder das Know-how-Schutzrecht. Die Abgrenzung zum Schutz des Outputs ist essentiell für die weitere Betrachtung.
D. Schutz des KI-Outputs de lege lata: Dieses zentrale Kapitel analysiert die Schutzmöglichkeiten von KI-generierten Werken unter dem bestehenden Recht. Es wird eingehend auf die deutschen Urheberrechtsbestimmungen eingegangen, wobei die Voraussetzungen für den Werkbegriff und die Frage der Urheberschaft im Detail beleuchtet werden. Der internationale Vergleich mit dem britischen und amerikanischen Urheberrecht stellt den deutschen Ansatz in einen breiteren Kontext und zeigt verschiedene Herangehensweisen an das Problem.
E. Schutz des KI-Outputs de lege ferenda: Das Kapitel befasst sich mit den Herausforderungen des bestehenden Rechts und diskutiert mögliche zukünftige Regelungen. Es wird auf das Schutzbedürfnis eingegangen, die Interessen verschiedener Akteure (Entwickler, Nutzer, Investoren) gewichtet und verschiedene Modellansätze zur Lösung der Urheberschaftsproblematik vorgestellt. Die Diskussion umfasst sowohl eine Erweiterung des Werkbegriffs als auch die Möglichkeit, der KI selbst Urheberrechte zuzuordnen.
Schlüsselwörter
Künstliche Intelligenz, Urheberrecht, Leistungsschutzrechte, KI-Output, Werkbegriff, Urheberschaft, de lege lata, de lege ferenda, Rechtsvergleich, Schutzbedürfnis, Regelungsmöglichkeiten, KI-Autonomie, Gemeinfreiheit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus dieser Seminararbeit zum Thema KI und Urheberrecht?
Diese Seminararbeit untersucht die urheber- und leistungsschutzrechtliche Stellung von durch Künstliche Intelligenz (KI) erzeugten Outputs. Ziel ist es, den aktuellen rechtlichen Rahmen (de lege lata) zu analysieren und mögliche zukünftige Regelungen (de lege ferenda) zu diskutieren.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem den urheberrechtlichen Schutz von KI-generierten Werken, die Anwendbarkeit verwandter Leistungsschutzrechte, eine vergleichende Betrachtung des Rechts in verschiedenen Ländern (Deutschland, EU, Großbritannien, USA), die Analyse des Problems der Urheberschaftszurechnung und die Diskussion möglicher Rechtsreformen.
Was beinhaltet das Kapitel "Einleitung"?
Die Einleitung führt in die Thematik des Urheberrechts für KI-generierte Outputs ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie verdeutlicht die Komplexität der Fragestellung, die sich aus dem Zusammenspiel von technologischem Fortschritt und bestehenden Rechtsnormen ergibt.
Was wird im Kapitel "Definition KI" erläutert?
Dieses Kapitel liefert eine prägnante Definition von Künstlicher Intelligenz, die für die juristische Betrachtung relevant ist. Es wird darauf eingegangen, welche Arten von KI-Systemen im Kontext des Urheberrechts relevant sind und welche Eigenschaften diese Systeme aufweisen müssen, um als „Schöpfer“ von Werken in Betracht gezogen zu werden.
Womit beschäftigt sich das Kapitel "Schutz des KI-Systems"?
Das Kapitel beleuchtet die Schutzmöglichkeiten des KI-Systems selbst, getrennt von den durch die KI erstellten Outputs. Es wird diskutiert, welche Aspekte des Systems schützenswert sind, zum Beispiel der Quellcode oder das Design, und welche Rechtsgebiete zum Schutz herangezogen werden können, wie z.B. das Patentrecht oder das Know-how-Schutzrecht.
Was ist der Inhalt des Kapitels "Schutz des KI-Outputs de lege lata"?
Dieses zentrale Kapitel analysiert die Schutzmöglichkeiten von KI-generierten Werken unter dem bestehenden Recht. Es wird eingehend auf die deutschen Urheberrechtsbestimmungen eingegangen, wobei die Voraussetzungen für den Werkbegriff und die Frage der Urheberschaft im Detail beleuchtet werden. Der internationale Vergleich mit dem britischen und amerikanischen Urheberrecht stellt den deutschen Ansatz in einen breiteren Kontext.
Was wird im Kapitel "Schutz des KI-Outputs de lege ferenda" diskutiert?
Das Kapitel befasst sich mit den Herausforderungen des bestehenden Rechts und diskutiert mögliche zukünftige Regelungen. Es wird auf das Schutzbedürfnis eingegangen, die Interessen verschiedener Akteure (Entwickler, Nutzer, Investoren) gewichtet und verschiedene Modellansätze zur Lösung der Urheberschaftsproblematik vorgestellt.
Welche Schlüsselwörter werden im Zusammenhang mit dieser Thematik genannt?
Die Schlüsselwörter sind: Künstliche Intelligenz, Urheberrecht, Leistungsschutzrechte, KI-Output, Werkbegriff, Urheberschaft, de lege lata, de lege ferenda, Rechtsvergleich, Schutzbedürfnis, Regelungsmöglichkeiten, KI-Autonomie, Gemeinfreiheit.
Welche Länder werden im Rahmen des Rechtsvergleichs betrachtet?
Im Rahmen der Arbeit werden die Rechtsordnungen von Deutschland, der EU, Großbritannien und den USA verglichen.
- Arbeit zitieren
- Helena Broj (Autor:in), 2021, Urheber‐ und/oder Leistungsschutzrechte für durch Künstliche Intelligenz (KI) erzeugten Output?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1519376