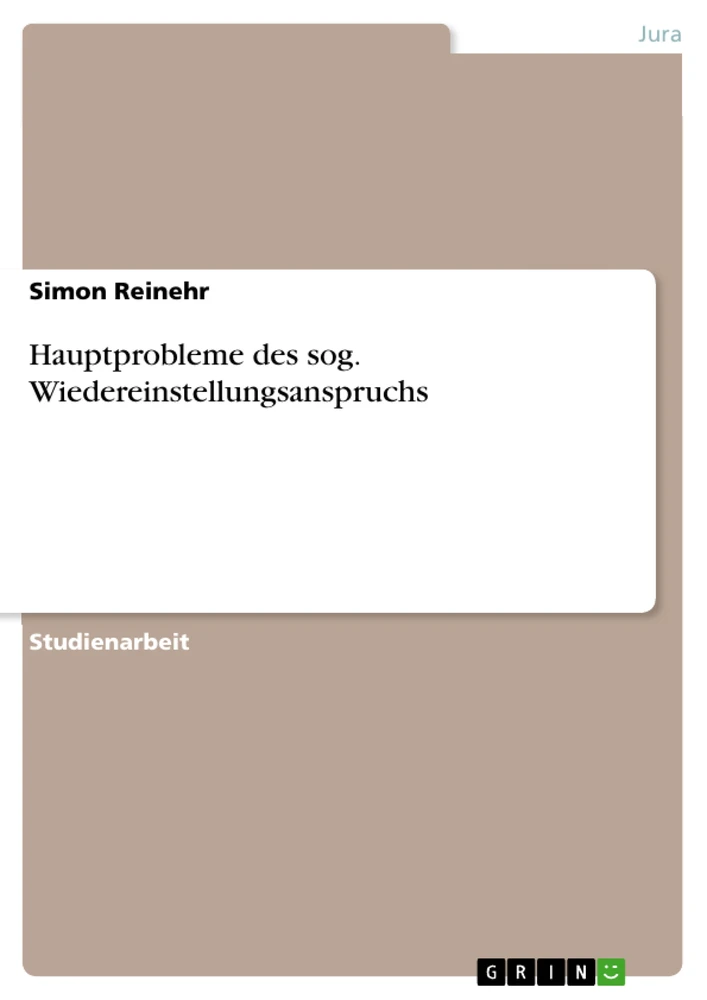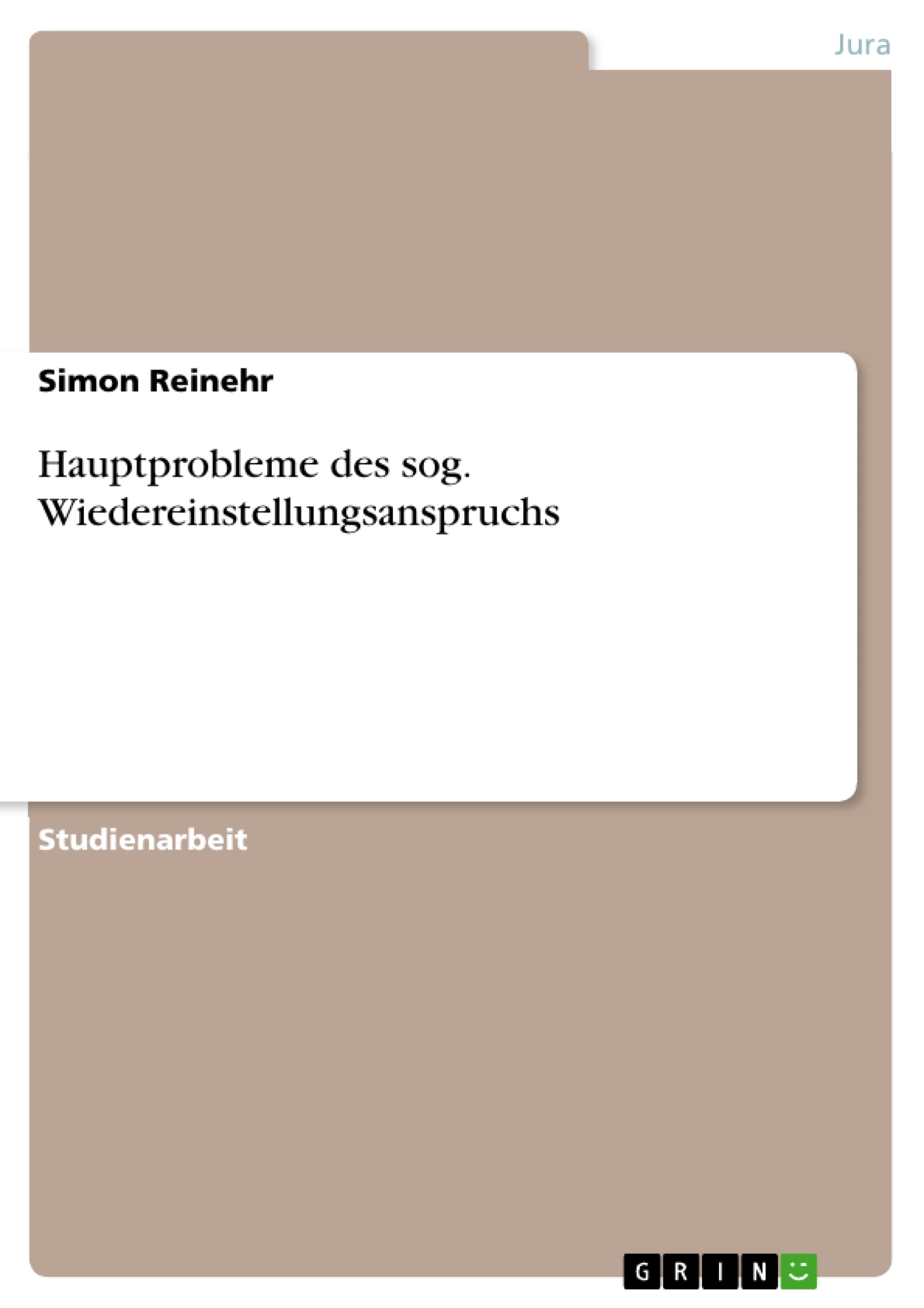Die Frage nach einem WEA stellt sich, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer kündigt, sich im Nachhinein aber Umstände ergeben, die den Kündigungsgrund entfallen lassen. Der WEA wird als Anspruch des Arbeitnehmers definiert, nach wirksamer Kündigung seines Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber und damit nach rechtmäßiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses wiedereingestellt zu werden, wenn nach Ausspruch der Kündigung eine Veränderung von Umständen eintritt, die eine gegenüber der Lage zum Zeitpunkt der Kündigungserklärung neue Situation schafft.
Die Problematik des WEA ist nicht neu. Bereits in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts hatte das BAG über Fälle zu entscheiden, bei denen Arbeitsverhältnisse aufgrund nationalsozialistischer Ver-fehlungen beendet wurden, der Arbeitnehmer aber später „entnazifiziert“ worden war . „Neu“ ist hingegen der Standpunkt des BAG: in der Entscheidung vom 27.02.1997 war zum ersten Mal ein WEA bei betriebsbedingter Kündigung bejaht. Auf diese Entscheidung folgten weitere, bei denen es ebenfalls um einen WEA aufgrund nachträglich entfallener Kündigungsgründe ging. Trotz der inzwischen wohl gefestigten Rechtssprechung des BAG, welches grundsätzlich die Möglichkeit des WEA anerkennt, herrscht jedoch sehr große Uneinigkeit über die dogmatische Einordnung und über die aus dem WEA resultierenden Folgeprobleme.
Ziel dieser Arbeit ist, die Hauptprobleme des WEA aufzuzeigen und eine Lösung hierfür anzubieten.
Inhaltsverzeichnis
- Die zweifelhafte Wirkung der Prognose im Kündigungsrecht
- Nachwirkende Vertragspflichten
- Die Kündigung wegen Verdachtsbedingten Vertrauenswegfalls
- Die betriebsbedingte Kündigung – Unter Berücksichtigung des neuen Betriebsverfassungsrechts und des Arbeitsgerichtsverfahrens
- Nachwirkungen des Arbeitsvertrages
- Der Wiedereinstellungsanspruch – Teil 2
- Praktische Probleme des Wiedereinstellungsanspruchs nach wirksamer Kündigung
- Personalabbau und Betriebsänderung im Insolvenzverfahren
- Der Wiedereinstellungsanspruch des Arbeitnehmers nach Wegfall des Kündigungsgrundes
- Individualrechtliche Probleme des verdeckten bzw. (zunächst) unerkannten Betriebsübergangs
- Der Grundsatz der Gleichbehandlung im Arbeitsrecht
- Prognoseprobleme im Kündigungsrecht
- Der Wiedereinstellungsanspruch des Arbeitnehmers nach wirksamer Kündigung
- Wiedereinstellungsanspruch nach wirksamer betriebsbedingter Kündigung?
- Anmerkung zum Urteil des BAG 4.12.1997
- Die Prognoseentscheidung des Arbeitgebers im Kündigungsrecht
- Betriebsverfassungsrecht
- Kündigungsschutzgesetz - Kommentar
- Arbeitsrecht Band 1 - Individualarbeitsrecht
- Wegfall des Kündigungsgrundes - Weder Unwirksamkeit der Kündigung noch Wiedereinstellungsanspruch
- Kündigungsschutzrecht – Kommentar für die Praxis zu Kündigungen und anderen Formen der Beendigung von Arbeitsverhältnissen
- Der Wiedereinstellungsanspruch des Arbeitnehmers - Rechtsfortbildung im Spannungsfeld von Bestandsschutz und wirksamer Kündigung im Arbeitsverhältnis
- Anmerkung zu BAG Urteil vom 28.6. 2000-Wiedereinstellungsanspruch nach betriebsbedingter Kündigung und Abfindungsvergleich
- Der Wiedereinstellungsanspruch des Arbeitnehmers beim Betriebsübergang
- Kommentar zum Kündigungsschutzgesetz
- Die Krankheitsbedingte Kündigung - (Un)wirksame Kündigung, Wiedereinstellungsanspruch oder Fortsetzungsanspruch?
- Der Wiedereinstellungsanspruch
- Die Renaissance des Wiedereinstellungsanspruchs
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Studienarbeit befasst sich mit den Hauptproblemen des Wiedereinstellungsanspruchs im Arbeitsrecht. Sie analysiert die Rechtsprechung und die Literatur zum Thema und beleuchtet die verschiedenen Aspekte des Wiedereinstellungsanspruchs, insbesondere im Kontext von Kündigungen und Betriebsübergängen.
- Die Voraussetzungen für einen Wiedereinstellungsanspruch
- Die Rechtsfolgen eines erfolgreichen Wiedereinstellungsanspruchs
- Die Problematik der Prognose im Kündigungsrecht
- Die Bedeutung des Betriebsübergangs für den Wiedereinstellungsanspruch
- Die Abgrenzung des Wiedereinstellungsanspruchs von anderen Rechtsbehelfen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Studienarbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema des Wiedereinstellungsanspruchs und erläutert die rechtlichen Grundlagen. Anschließend werden die Voraussetzungen für einen Wiedereinstellungsanspruch im Detail analysiert, wobei die verschiedenen Arten von Kündigungen und die damit verbundenen Besonderheiten im Fokus stehen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Problematik der Prognose im Kündigungsrecht, die für die Beurteilung des Wiedereinstellungsanspruchs von großer Bedeutung ist. Die Arbeit beleuchtet auch die Rechtsfolgen eines erfolgreichen Wiedereinstellungsanspruchs und die Abgrenzung des Wiedereinstellungsanspruchs von anderen Rechtsbehelfen. Abschließend werden die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammengefasst und ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Wiedereinstellungsanspruchs gegeben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Wiedereinstellungsanspruch, das Kündigungsrecht, die Prognose im Kündigungsrecht, den Betriebsübergang, die Rechtsfolgen des Wiedereinstellungsanspruchs und die Abgrenzung des Wiedereinstellungsanspruchs von anderen Rechtsbehelfen. Die Arbeit analysiert die Rechtsprechung und die Literatur zum Thema und beleuchtet die verschiedenen Aspekte des Wiedereinstellungsanspruchs, insbesondere im Kontext von Kündigungen und Betriebsübergängen.
- Arbeit zitieren
- Simon Reinehr (Autor:in), 2007, Hauptprobleme des sog. Wiedereinstellungsanspruchs, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/151834