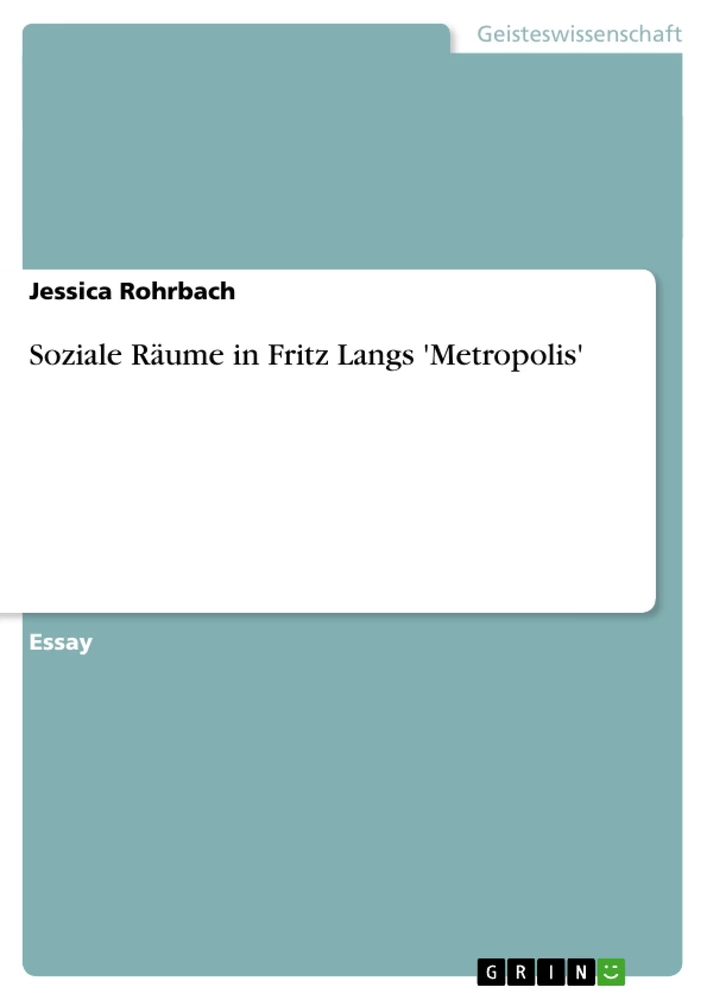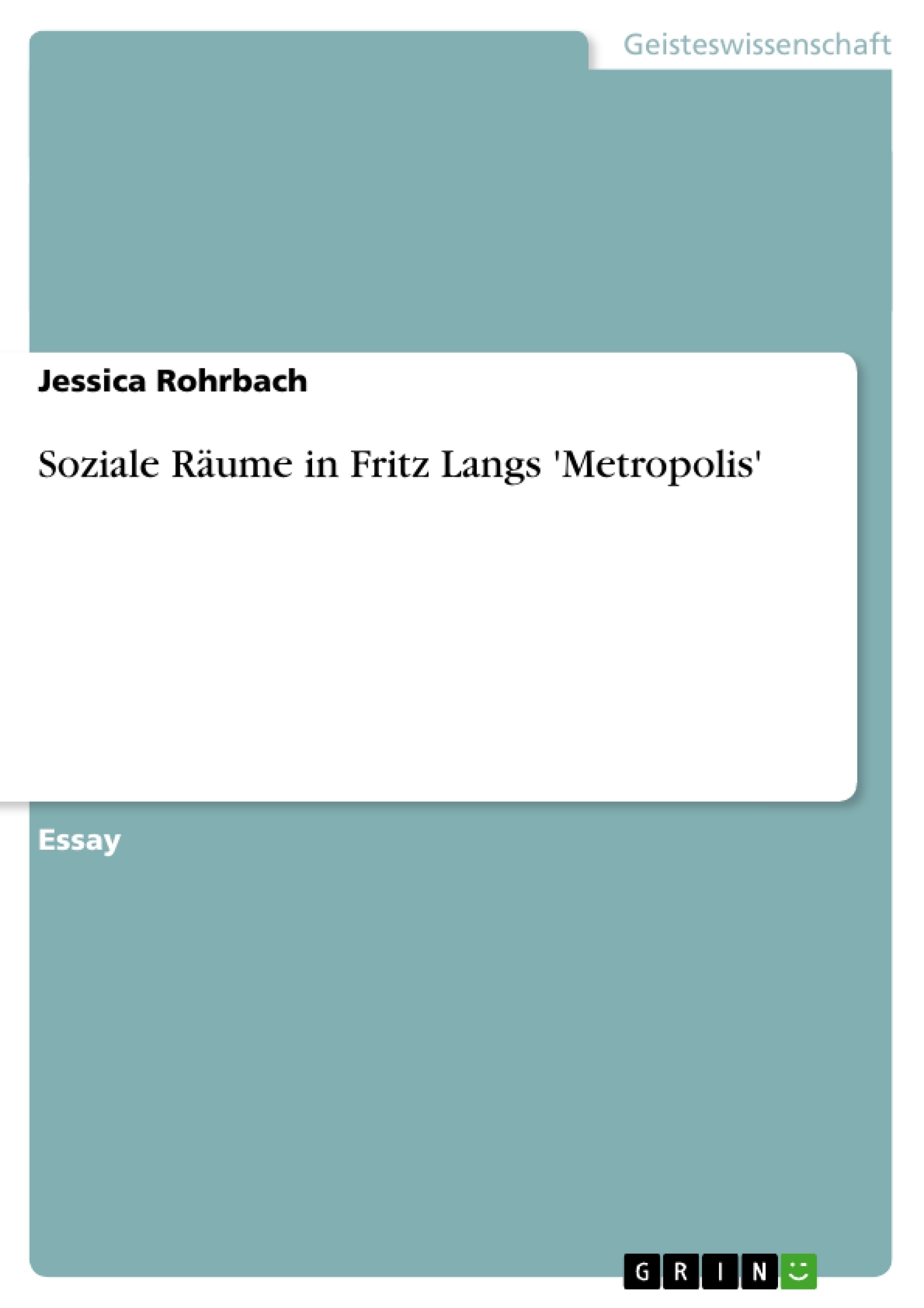Der Anfang 1927 in Berlin uraufgeführte Film „Metropolis“ von Fritz Lang hatte keinen guten Start: Von Kritikern verrissen, denn er sei nicht utopisch, zu übertrieben dargestellt und hätte eine furchtbar platte Aussage (vgl. H. G. Wells in seiner Kritik am 17.04.1927 in den „New York Times“), unzählige Male gekürzt, für verschiedene Märkte zurechtgeschnitten und verändert, wurde er schließlich doch noch zum –allerdings unvollständigen – Kultfilm. Mit jeder neuen Veränderung erfuhr „Metropolis“ eine Uminterpretation. Die Grundaussage „Mittler zwischen Hirn und Hand muss das Herz sein“ blieb zwar, dennoch fehlten und fehlen immer noch je nach Fassung verschiedene wichtige Szenen, die in anderen Fassungen entweder wieder auftraten oder gänzlich unauffindbar blieben.
Eines jedoch blieb über die verschiedenen Fassungen bestehen und das ist die beeindruckende Architektur, die im Film dargestellt wird. Diese bleibt nicht wie eine einfache Kulisse im Hintergrund des Films zurück, sondern nimmt eine zentrale Stellung ein.
Lang hat in seinem Film eine unüberschaubare Stadt geschaffen, mit vielen unterschiedlichen Räumen und ebenso unterschiedlichen Menschen. Betrachtet man diese genauer, fällt auf, dass die sehr funktional gestalteten Räume ihre Funktionen auf die Menschen, die in ihnen leben, wohnen und arbeiten, übertragen. Lang stellt in seinem Film also unter anderem dar, dass Räume Einfluss auf die Persönlichkeit des Menschen nehmen, was im Folgenden näher betrachtet und auf reale Räume übertragen werden soll. Dazu will ich zunächst den Begriff des sozialen Raums einführen.
Als soziale Räume bezeichne ich Räume, die durch ihren Aufbau und ihre Funktion das Sozialleben der sich in ihnen aufhaltenden Menschen beeinflussen. Das tun sie ganz einfach, indem sie durch ihren Aufbau verschiedene Möglichkeiten schaffen, wie die Menschen diesen Raum nutzen können. So kann zum Beispiel eine Küche durch ihre Einrichtung mit Arbeitsfläche, Herd, Kühlschrank usw. am besten zum Zubereiten von Speisen genutzt werden. Der Mensch, der in ihr sein Essen kocht, tut das nur deshalb dort, weil der Raum ihm die Möglichkeiten dazu bietet. Gäbe es diese Küche nicht, würde der sie nutzende Mensch sich anderweitig versorgen (müssen). Solche Räume gibt es auch in Metropolis, doch bevor ich auf die einzelnen Räume zu sprechen komme, soll zuerst die komplette fiktive Stadt vorgestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Der Anfang
- Eines jedoch blieb über die verschiedenen Fassungen bestehen und das ist die beeindruckende Architektur, die im Film dargestellt wird.
- Lang hat in seinem Film eine unüberschaubare Stadt geschaffen, mit vielen unterschiedlichen Räumen und ebenso unterschiedlichen Menschen.
- Der soziale Raum Metropolis
- Langs Metropolis hat also durchaus reale Vorbilder, weswegen der Film unter anderem auch kritisiert wurde.
- Die Menschen in Metropolis nehmen eine etwas andere Rolle ein, als die Menschen in realen Städten.
- Trennung der sozialen Schichten: Die Ober- und die Unterstadt
- Während die Stadt von außen betrachtet zentralistisch gegliedert ist, ist sie in ihrem Inneren vertikal nach Schichten unterteilt.
- Die unteren Etagen von Metropolis beherbergen die „Maschinenstadt“, in der die Unterschicht lebt und arbeitet.
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay analysiert die Darstellung sozialer Räume in Fritz Langs Film „Metropolis“ und untersucht, wie die Architektur und die Gestaltung der Räume das Sozialleben der Figuren beeinflussen. Der Fokus liegt dabei auf der Unterscheidung zwischen Ober- und Unterstadt sowie der Rolle der Maschinenstadt in der Gesamtstruktur der Stadt.
- Die Bedeutung der Architektur als Ausdruck sozialer Strukturen
- Die Rolle der Räume in der Gestaltung des Soziallebens
- Die Trennung der sozialen Schichten in Ober- und Unterstadt
- Die Maschinenstadt als Symbol für die Entfremdung und Ausbeutung der Arbeiterklasse
- Die Stadt als organisches Gebilde, das von Maschinen am Leben erhalten wird
Zusammenfassung der Kapitel
Der Essay beginnt mit einer kurzen Einführung in die Geschichte des Films „Metropolis“ und seiner verschiedenen Fassungen. Anschließend wird die Bedeutung der Architektur im Film hervorgehoben, die nicht nur als Kulisse dient, sondern eine zentrale Rolle in der Gestaltung des Soziallebens spielt. Der Autor führt den Begriff des sozialen Raums ein und erklärt, wie Räume durch ihren Aufbau und ihre Funktion das Sozialleben der Menschen beeinflussen können.
Im nächsten Abschnitt wird die fiktive Stadt Metropolis vorgestellt, die von Lang als eine mehrdimensionale und vertikal nach Schichten unterteilte Stadt konzipiert wurde. Die Oberstadt beherbergt die Oberschicht, die in luxuriösen und individuell gestalteten Räumen lebt und arbeitet. Die Unterstadt hingegen ist die „Maschinenstadt“, in der die Arbeiterklasse in trostlosen und funktionalen Räumen lebt und arbeitet. Die Arbeiter sind den Maschinen, an denen sie ihren Tag verbringen, ähnlich und führen ein Leben, das nur aus Arbeit besteht.
Der Essay analysiert die verschiedenen Räume in Ober- und Unterstadt und zeigt, wie die Gestaltung der Räume die Persönlichkeit und das Verhalten der Figuren beeinflusst. Die Oberstadt ist geprägt von Luxus, Individualität und Freiheit, während die Unterstadt von Entfremdung, Ausbeutung und Monotonie geprägt ist. Die Maschinenstadt wird als Symbol für die Entfremdung der Arbeiterklasse von ihrer Arbeit und von der Gesellschaft dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen soziale Räume, Architektur, Fritz Lang, Metropolis, Oberstadt, Unterstadt, Maschinenstadt, Entfremdung, Ausbeutung, Arbeiterklasse, Sozialleben, Film, Filmgeschichte, Architekturgeschichte.
- Arbeit zitieren
- Jessica Rohrbach (Autor:in), 2009, Soziale Räume in Fritz Langs 'Metropolis', München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/151634