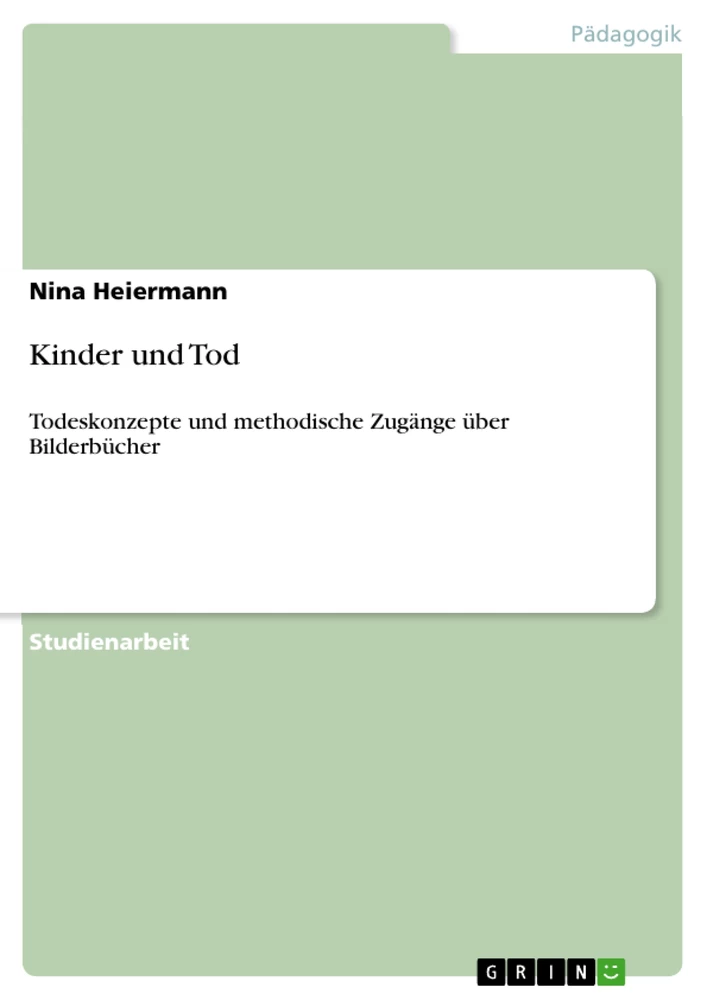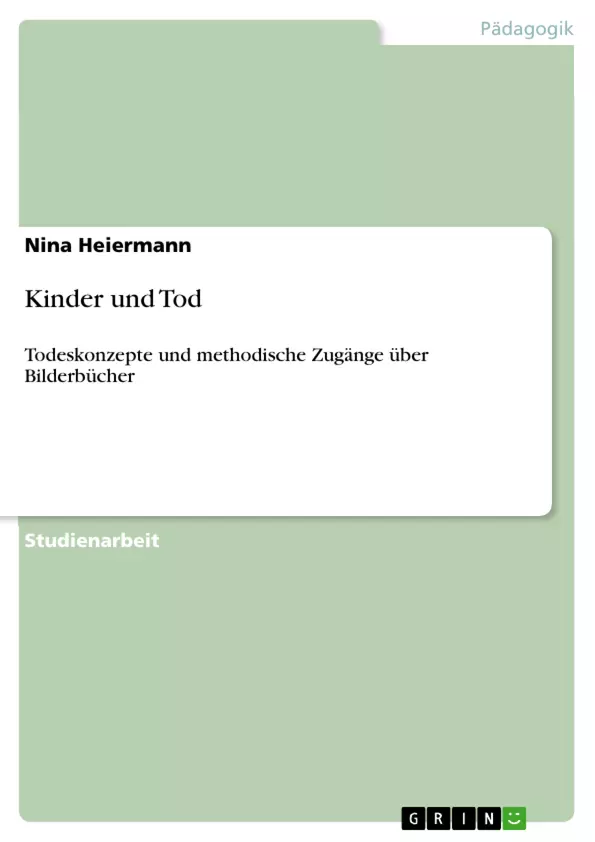Im Wintersemester 2006/2007 besuchte ich das Seminar „Sterben, Tod und Trauer – Themen für den Religionsunterricht?“ bei Elisabeth Hennecke. Innerhalb dieses Seminars wurde das Thema der Trauerarbeit bei Kindern, unterrichtliche Zugänge zum Thema sowie theologische Erkenntnisse zum Thema Tod fokussiert. Es reizt mich sehr, mehr über den Zugang über Bilderbücher zu erfahren. So mache ich dieses Thema zum Mittelpunkt meiner Hausarbeit. Nachdem ich das Phasenmodell von Spiegel über den Trauerprozess bei Kindern beleuchten werde, möchte ich mir zunächst noch einmal die Todesvorstellungen in den einzelnen Altersstufen vergegenwärtigen. Im Anschluss daran möchte ich das Bilderbuch „Abschied von Tante Sofia“ von Hiltraud Olbrich in den Blick nehmen. Um auch später im Berufsalltag kompetent mit Literatur zum Thema Sterben und Tod umgehen zu können, untersuche ich das Bilderbuch theoretisch-analytisch auf verschiedene Kriterien. Weiterhin werde ich Impulse und methodische Möglichkeiten der Umsetzung in der Grundschule nennen. Abschließend werde ich meine Arbeit resümieren und meine abschließenden Gedanken festhalten
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Trauerprozess bei Kindern – Phasenmodell nach Yorick Spiegel
- Todesvorstellungen in den verschiedenen Altersstufen
- Vorschulkinder 3 bis 5 Jahre
- Grundschulkinder 6 bis 9 Jahre
- Schulkinder 9 bis 12 Jahre
- Jugendliche
- Zugänge zum Thema Tod und Leben in der Grundschule über Bilderbücher
- Abschied von Tante Sofia
- Kriterienanalyse
- Mögliche Einführung in das Thema – Impulse für eine methodische Umsetzung
- Abschied von Tante Sofia
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Umgang mit dem Thema Tod und Trauer bei Kindern im Grundschulalter. Ziel ist es, unterrichtliche Zugänge, insbesondere über Bilderbücher, zu beleuchten und ein besseres Verständnis für den Trauerprozess bei Kindern zu entwickeln. Die Arbeit basiert auf dem Phasenmodell des Trauerprozesses nach Yorick Spiegel und analysiert das Bilderbuch "Abschied von Tante Sofia" hinsichtlich seiner Eignung für den Unterricht.
- Der Trauerprozess bei Kindern nach Yorick Spiegel
- Entwicklung kindlicher Todesvorstellungen in verschiedenen Altersstufen
- Analyse des Bilderbuchs "Abschied von Tante Sofia" nach verschiedenen Kriterien
- Methodische Umsetzung des Themas Tod und Leben im Grundschulunterricht
- Der Umgang mit dem Thema Tod und Trauer im Kontext der Grundschule
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Zugang zum Thema Tod und Trauer bei Kindern im Grundschulalter, insbesondere durch den Einsatz von Bilderbüchern. Sie basiert auf einem Seminar zum Thema und fokussiert die Trauerarbeit bei Kindern, unterrichtliche Zugänge und theologische Aspekte des Todes. Die Arbeit analysiert das Phasenmodell von Spiegel und das Bilderbuch "Abschied von Tante Sofia" im Hinblick auf dessen Eignung für den Unterricht.
Der Trauerprozess bei Kindern – Phasenmodell nach Yorick Spiegel: Dieses Kapitel beschreibt Spiegels Phasenmodell des Trauerprozesses bei Kindern, beginnend mit der Schockphase, gefolgt von einer Kontroll- oder Vergewisserungsphase, einer Regressionsphase und schließlich der Adaptionsphase. Es betont die individuelle Ausprägung des Trauerprozesses und die Notwendigkeit, Kindern ausreichend Zeit und Raum für die Verarbeitung ihres Verlustes zu geben. Das Modell wird mit den Jahreszeiten verglichen, um die Nicht-Linearität des Prozesses zu verdeutlichen.
Todesvorstellungen in den verschiedenen Altersstufen: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung kindlicher Todesvorstellungen in verschiedenen Altersgruppen (Vorschulkinder, Grundschulkinder, Schulkinder, Jugendliche). Es wird herausgestellt, dass die Vorstellungen vom Tod mit dem Alter komplexer und realistischer werden, von einer eher gestaltlosen Vorstellung im Vorschulalter bis hin zu einem nüchternen Verständnis als Naturphänomen bei älteren Kindern. Der Glaube an ein Leben nach dem Tod wird ebenfalls thematisiert.
Zugänge zum Thema Tod und Leben in der Grundschule über Bilderbücher: Dieses Kapitel argumentiert für die Eignung von Bilderbüchern als Zugang zum Thema Tod und Leben in der Grundschule. Es betont den Wert von Bilderbüchern, um Kindern eine altersgerechte Annäherung an das Thema zu ermöglichen und einen Raum für Fragen und den Austausch von Gefühlen zu schaffen. Das Kapitel legt den Fokus auf die Bedeutung einer nicht-moralisierenden, sondern unterstützenden Herangehensweise.
Abschied von Tante Sofia: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Analyse des Bilderbuchs "Abschied von Tante Sofia" nach Kriterien von Martina Plieth. Die Analyse umfasst literarästhetische Aspekte, die Qualität bildhafter Elemente, die Authentizität der Sterbe- und Todesdarstellungen, den Veranschaulichungsgrad von Stimmungswerten, die Plausibilität von Lösungs- und Bewältigungsstrategien, die Tragfähigkeit von Konsolationselementen, die Kontinuität von Kommunikations- und Interaktionsstrukturen und den Offenheitsgrad bezüglich religiöser und/oder christlicher Wertmaßstäbe. Die Analyse zeigt die vielschichtigen Möglichkeiten des Buches für die Auseinandersetzung mit Tod und Trauer auf.
Mögliche Einführung in das Thema – Impulse für eine methodische Umsetzung: Dieses Kapitel gibt Impulse für eine methodische Umsetzung des Bilderbuchs "Abschied von Tante Sofia" im Unterricht. Es schlägt verschiedene didaktische Ansätze vor, um das Buch in den Unterricht zu integrieren und die Kinder zum Nachdenken und Reflektieren über das Thema Tod und Leben anzuregen. Die vorgeschlagenen Aktivitäten umfassen Gespräche, kreative Aufgaben und Rollenspiele.
Ausblick: Das Kapitel betont die Wichtigkeit eines offenen Umgangs mit dem Thema Tod und Trauer in der Gesellschaft und im Unterricht. Es unterstreicht die Relevanz des Themas für die gesunde Entwicklung von Kindern und die Rolle der Lehrkräfte bei der Begleitung und Unterstützung von Kindern in Trauerprozessen. Die Autorin bekundet ihre ermutigende Erfahrung mit der Thematik und die Bereitschaft, diese im Unterricht anzugehen.
Schlüsselwörter
Trauerprozess, Kinder, Tod, Sterben, Bilderbuch, "Abschied von Tante Sofia", Grundschule, Religionsunterricht, Todesvorstellungen, Phasenmodell Spiegel, methodische Umsetzung, Hoffnung, Trauerarbeit, Identifikation, Lebensbewältigung.
Häufig gestellte Fragen zu "Der Umgang mit Tod und Trauer bei Kindern im Grundschulalter"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Umgang mit Tod und Trauer bei Kindern im Grundschulalter. Sie beleuchtet unterrichtliche Zugänge zum Thema, insbesondere über Bilderbücher, und fördert ein besseres Verständnis des Trauerprozesses bei Kindern. Die Arbeit basiert auf dem Phasenmodell des Trauerprozesses nach Yorick Spiegel und analysiert das Bilderbuch "Abschied von Tante Sofia" auf seine Eignung im Unterricht.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Trauerprozess bei Kindern nach Yorick Spiegel, die Entwicklung kindlicher Todesvorstellungen in verschiedenen Altersstufen, eine Analyse des Bilderbuchs "Abschied von Tante Sofia", methodische Umsetzungen des Themas Tod und Leben im Grundschulunterricht und den Umgang mit Tod und Trauer im Kontext der Grundschule.
Welches Phasenmodell wird verwendet?
Die Arbeit verwendet das Phasenmodell des Trauerprozesses nach Yorick Spiegel. Dieses Modell beschreibt den Trauerprozess in Phasen (Schock, Kontrolle/Vergewisserung, Regression, Adaption) und betont die individuelle Ausprägung und die Notwendigkeit von Zeit und Raum für die Verarbeitung.
Wie werden kindliche Todesvorstellungen behandelt?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung kindlicher Todesvorstellungen in verschiedenen Altersgruppen (Vorschulkinder, Grundschulkinder, Schulkinder, Jugendliche). Es wird gezeigt, wie die Vorstellungen vom Tod mit dem Alter komplexer und realistischer werden.
Welche Rolle spielen Bilderbücher?
Bilderbücher werden als geeigneter Zugang zum Thema Tod und Leben in der Grundschule betrachtet. Sie ermöglichen eine altersgerechte Annäherung und schaffen Raum für Fragen und den Austausch von Gefühlen. Die Arbeit analysiert das Bilderbuch "Abschied von Tante Sofia" detailliert.
Wie wird "Abschied von Tante Sofia" analysiert?
Das Bilderbuch "Abschied von Tante Sofia" wird anhand von Kriterien von Martina Plieth analysiert. Die Analyse umfasst literarästhetische Aspekte, bildhafte Elemente, Authentizität der Sterbe- und Todesdarstellungen, Stimmungswerte, Lösungs- und Bewältigungsstrategien, Konsolationselemente, Kommunikationsstrukturen und den Offenheitsgrad bezüglich religiöser Wertmaßstäbe.
Welche methodischen Umsetzungen werden vorgeschlagen?
Die Arbeit schlägt verschiedene didaktische Ansätze vor, um "Abschied von Tante Sofia" im Unterricht zu integrieren. Dies umfasst Gespräche, kreative Aufgaben und Rollenspiele, um Kinder zum Nachdenken und Reflektieren anzuregen.
Welchen Ausblick bietet die Arbeit?
Die Arbeit betont die Wichtigkeit eines offenen Umgangs mit Tod und Trauer in der Gesellschaft und im Unterricht. Sie unterstreicht die Relevanz des Themas für die gesunde Entwicklung von Kindern und die Rolle der Lehrkräfte bei der Begleitung und Unterstützung von Kindern in Trauerprozessen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Trauerprozess, Kinder, Tod, Sterben, Bilderbuch, "Abschied von Tante Sofia", Grundschule, Religionsunterricht, Todesvorstellungen, Phasenmodell Spiegel, methodische Umsetzung, Hoffnung, Trauerarbeit, Identifikation, Lebensbewältigung.
- Arbeit zitieren
- Nina Heiermann (Autor:in), 2007, Kinder und Tod, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/151420