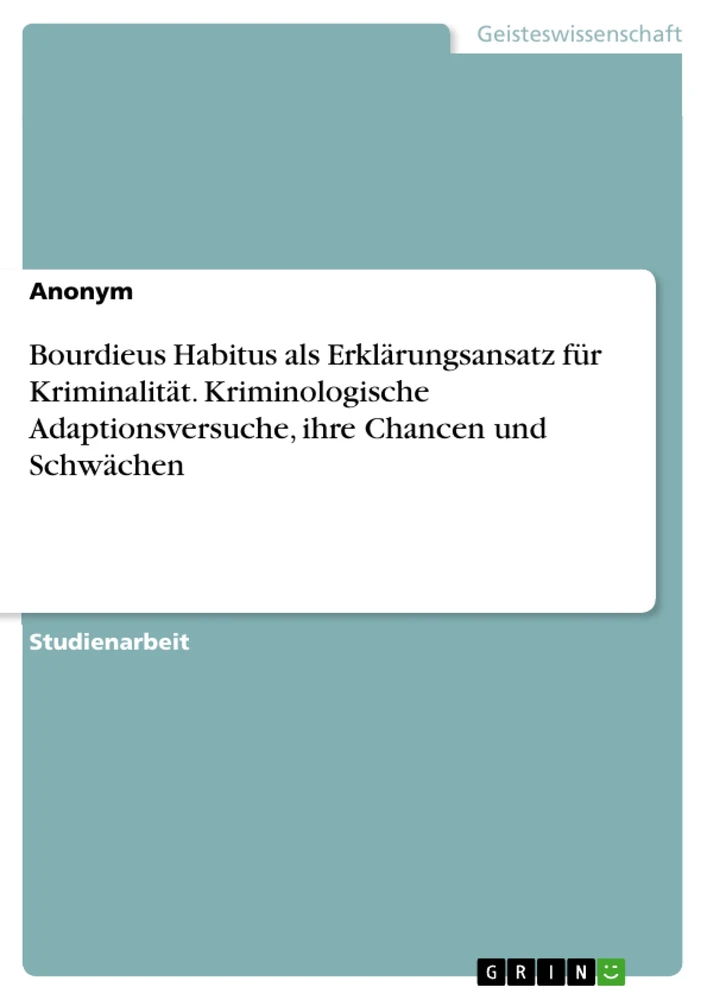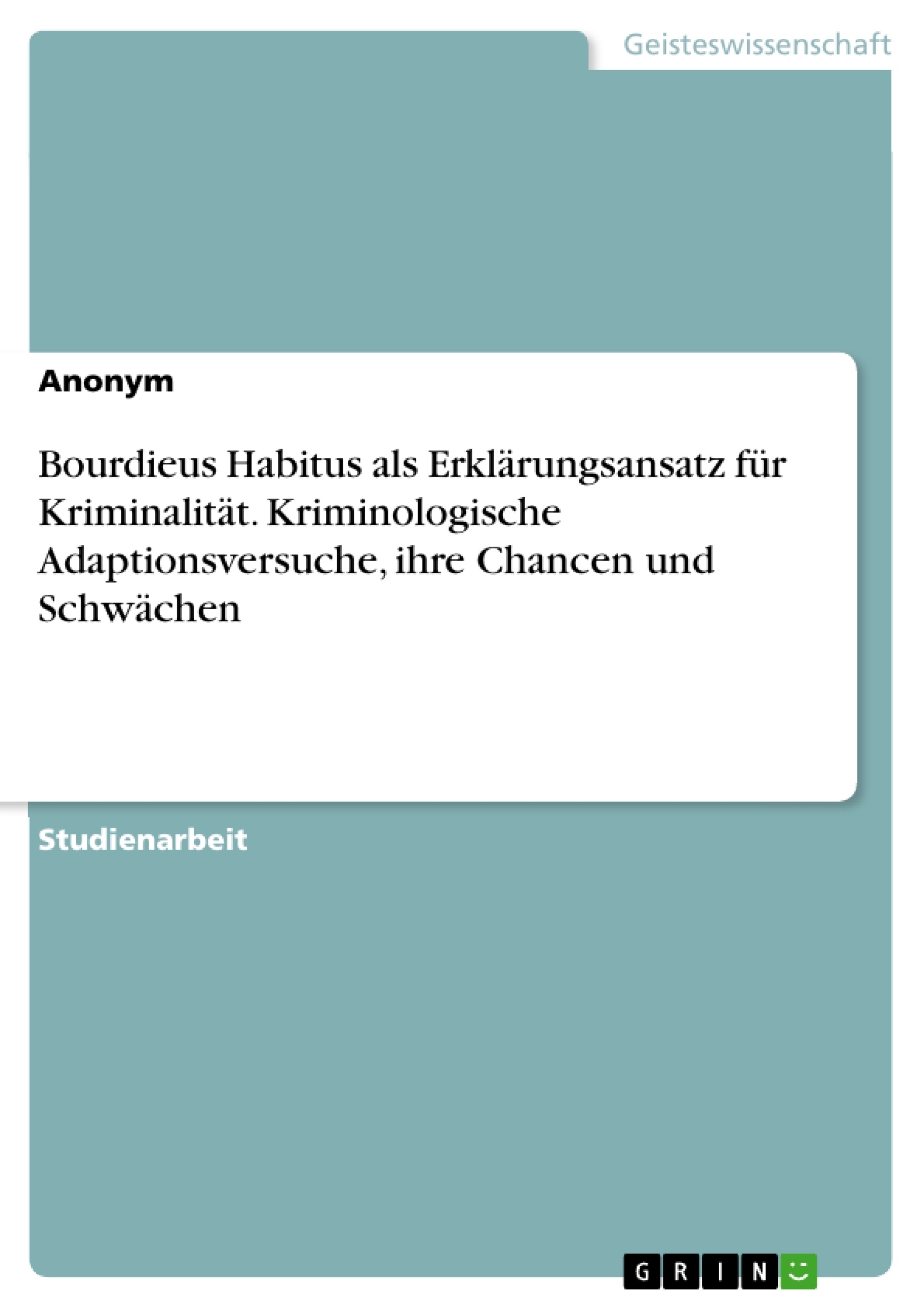In diesem Aufsatz soll das konzeptionelle Potential des Habituskonzepts für die Kriminologie erörtert werden. Hierfür wird der Habitus einführend als Ungleichheitsmechanismus vorgestellt. Anschließend werden die drei zuvor genannten Beiträge in ihren wichtigsten Kernpunkten und Unterschieden erläutert. Auf dieser Grundlage werden die Chancen und Grenzen des Habitus für die Erklärung von Kriminalität erarbeitet. Im Fazit folgt eine kritische Einordnung der Ergebnisse.
Während Bourdieus Habitus längst zu einem ‚Klassiker‘ der Ungleichheitsforschung avanciert ist, bleibt seine Anwendung in vielen anderen (wenn auch verwandten) Fachgebieten der Sozialwissenschaften aus. Die Anzahl nennenswerter Zeitschriften- bzw. Sammelbandbeiträge, die den Versuch vornehmen, eine kriminologische Adaption der Habitustheorie voranzutreiben, beläuft sich auf drei Stück: Alan France (2015) zeigt anhand eigener Felderfahrungen exemplarisch auf, inwiefern die Habitustheorie das kriminelle Verhalten Jugendlicher erklären kann. Shammas und Sandberg (2016) arbeiten eine bourdieusche Kriminalitätstheorie heraus, in welcher der Habitus einen wichtigen konzeptionellen Baustein darstellt. In einem ähnlichen Vorhaben betont zuletzt Prieur (2018) aus kulturtheoretischer Sicht die mediatorische Rolle von Emotionen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bourdieus Habitus
- Habitus und Kriminalität
- Konzeptionelle Anwendungen und Erweiterungen in der Kriminologie
- Kriminologie der politischen Ökologie
- Street Field und Street Habitus
- Emotionen in der kulturellen Kriminologie
- Grenzen und Chancen des Habituskonzepts für die Kriminologie
- Determinismuskritik
- Konzeptionelle Unschärfe
- Methodologische Anwendbarkeit
- Konzeptionelle Einbettung
- Integratives Potential
- Konzeptionelle Anwendungen und Erweiterungen in der Kriminologie
- Reflexion und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Aufsatz untersucht das konzeptionelle Potential von Bourdieus Habituskonzept für die Kriminologie. Es werden kriminologische Adaptionsversuche des Habituskonzepts vorgestellt und deren Chancen und Schwächen analysiert. Der Fokus liegt auf der Erörterung des Habitus als Erklärungsansatz für Kriminalität und seiner Einbettung in bestehende kriminologische Theorien.
- Bourdieus Habituskonzept und seine Anwendung in der Sozialforschung
- Kriminologische Adaptionen des Habituskonzepts
- Chancen und Grenzen des Habituskonzepts zur Erklärung von Kriminalität
- Vergleich verschiedener kriminologischer Ansätze zur Erklärung von Kriminalität
- Integratives Potential des Habituskonzepts für die Kriminologie
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Die Einleitung stellt die intergenerationale Transmission von Kriminalität vor und führt in die Problematik der Erklärung kriminellen Verhaltens ein. Sie benennt den Habitus als möglichen Erklärungsansatz und skizziert den Aufbau des Aufsatzes.
Kapitel 2 (Bourdieus Habitus): Dieses Kapitel beschreibt Bourdieus Habituskonzept als zentralen Bestandteil seiner Gesellschaftstheorie. Es erläutert den Habitus als „Systeme dauerhafter und übertragbarer Dispositionen“, die Handlungen beeinflussen, aber nicht determinieren.
Kapitel 3 (Habitus und Kriminalität): Dieses Kapitel präsentiert und analysiert drei kriminologische Adaptionen des Habituskonzepts. Es werden die jeweiligen Kernpunkte und Unterschiede dieser Ansätze herausgearbeitet.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2024, Bourdieus Habitus als Erklärungsansatz für Kriminalität. Kriminologische Adaptionsversuche, ihre Chancen und Schwächen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1513263