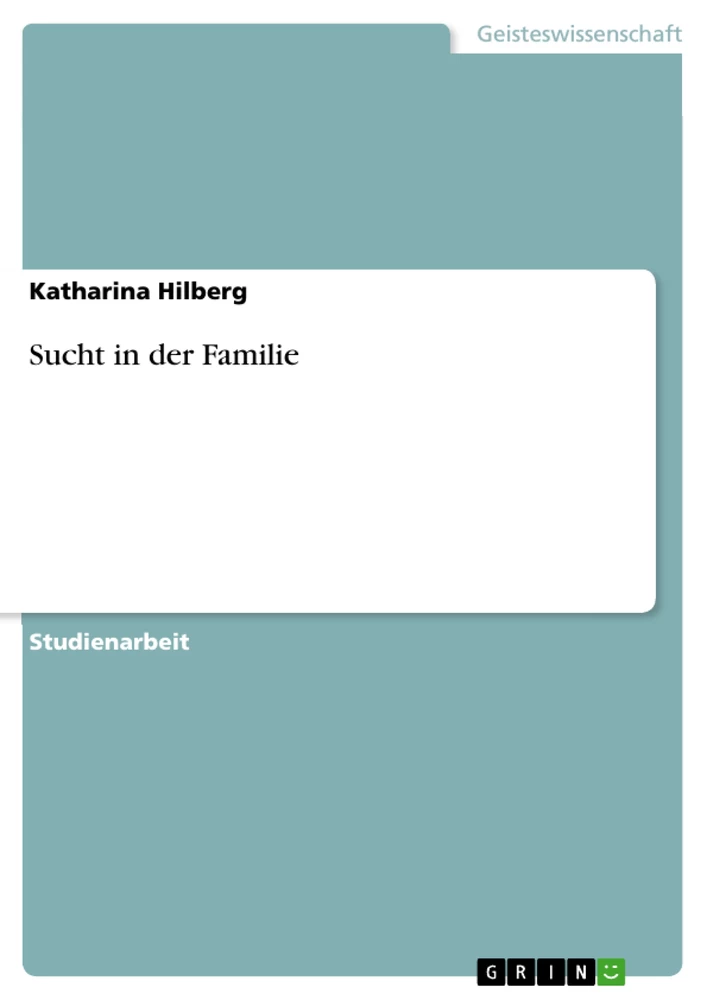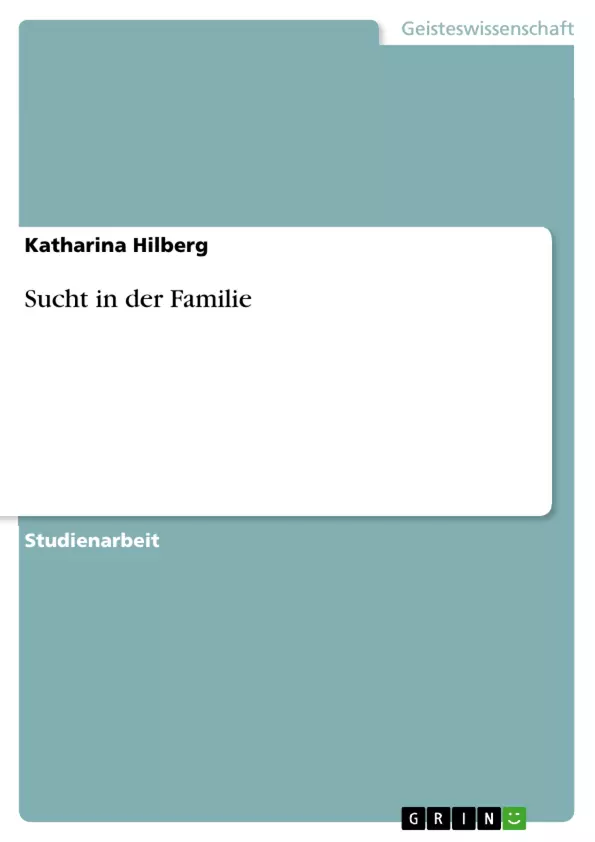Die Familie hat eine wichtige Sozialisationswirkung. Sie vermittelt Werte und Normen, strukturiert, ordnet und bewertet Erfahrungen, dient als Umweltvermittler, unterstützt bei der Erschließung des ökologischen Angebots und hat einen enormen Einfluss auf den Umfang und die Qualität der Sozial- und Lernerfahrungen. Zudem spielen der Erziehungsstil in der Familie, das Familienklima und die Positionen der Familienmitglieder eine wichtige Rolle.
Seit den letzten fünf Jahrzehnten fällt auf, dass die Institution Familie tragende Struktur¬wandlungen durchmacht. Die Kernfamilie, wie man sie früher kannte – bestehend aus Vater, Mutter und in der Regel zwei Kinder-, ist heutzutage nicht mehr typisch und selbstverständlich vorzufinden. Früher sorgte die Mutter für den Haushalt, kümmerte sich um die Kinder und der Mann verdiente das Geld. Nicht gerade selten lebten mehrere Familienmitglieder in einer 1-Zimmer-Wohnung. Noch bis in die 1960er Jahren war die Lebensform Ehe für 90% der Erwachsenen selbstver¬ständlich und gehörte zum Leben dazu. Jedoch kommt es seit den 1960er Jahren zu einem Bedeutungsverlust der Institution Familie. Nicht nur, dass heutzutage immer weniger Erwach¬sene heiraten, auch immer weniger Kinder werden geboren und die Berufstätigkeit der Frau nimmt zu. Die Gestaltung eines selbstbestimmten Lebens rückt stärker in den Vordergrund.
Inhaltsverzeichnis
1. Familie im Wandel – früher und heute
2. Risiko- und Schutzfaktoren
3. Formen von Sucht in der Familie
4. Folgen und Auswirkungen
5. Unterstützungsangebote und Präventionsmaßnahmen
6. Literatur
1. Familie im Wandel – früher und heute
Die Familie hat eine wichtige Sozialisationswirkung. Sie vermittelt Werte und Normen, strukturiert, ordnet und bewertet Erfahrungen, dient als Umweltvermittler, unterstützt bei der Erschließung des ökologischen Angebots und hat einen enormen Einfluss auf den Umfang und die Qualität der Sozial- und Lernerfahrungen. Zudem spielen der Erziehungsstil in der Familie, das Familienklima und die Positionen der Familienmitglieder eine wichtige Rolle.[1]
Seit den letzten fünf Jahrzehnten fällt auf, dass die Institution Familie tragende Strukturwandlungen durchmacht. Die Kernfamilie, wie man sie früher kannte – bestehend aus Vater, Mutter und in der Regel zwei Kinder-, ist heutzutage nicht mehr typisch und selbstverständlich vorzufinden. Früher sorgte die Mutter für den Haushalt, kümmerte sich um die Kinder und der Mann verdiente das Geld. Nicht gerade selten lebten mehrere Familienmitglieder in einer 1-Zimmer-Wohnung. Noch bis in die 1960er Jahren war die Lebensform Ehe für 90% der Erwachsenen selbstverständlich und gehörte zum Leben dazu. Jedoch kommt es seit den 1960er Jahren zu einem Bedeutungsverlust der Institution Familie. Nicht nur, dass heutzutage immer weniger Erwachsene heiraten, auch immer weniger Kinder werden geboren und die Berufstätigkeit der Frau nimmt zu. Die Gestaltung eines selbstbestimmten Lebens rückt stärker in den Vordergrund. Durch diese Veränderungen finden wir in der Gesellschaft eine breite Vielfalt von Pluralisierung und Individualisierung der Familienformen wieder, die immer selbstverständlicher werden. Diese reichen von ehelichen und nichtehelichen Lebensgemeinschaften, alleinerziehende Eltern (vor allem alleinerziehende Mütter), Wohngemeinschaften mit Kindern, getrennt lebende Eltern über Patchworkfamilien und wiederverheirateten Eltern mit Kindern und Stiefkindern. Die Zahl der Familien mit relativ schlechten Sozialisationsbedingungen steigt durch soziale und ökonomische Benachteiligung, Trennung und Scheidung weiter an.[2]
Die Rolle der Eltern als soziale Vorbilder und Ansprechpersonen spielt gerade in einer sich stetig verändernden Gesellschaft mit immer neuen Anforderungen eine tragende Rolle. In der heutigen Zeit sind die Anforderungen an die Erziehung stark gewachsen. Neben einer Pluralisierung und Individualisierung von Lebensformen werden die Entscheidungs- und Handlungsprozesse immer komplexer. Orientierungslosigkeit, Verunsicherung und Unübersichtlichkeit spiegeln sich in der Gesellschaft wieder. Soziale und Kulturelle Sicherheiten schwinden, soziale Unterstützungsnetzwerke der Menschen werden löcherig, handlungs-leitende Werte werden unverbindlicher und Lebenskonstruktionen sind störanfällig. Es gibt keine oder nur wenige vorbestimmte Lebensbahnen und Diskontinuitäten und Unübersichtlichkeiten des Lebens wachsen. Dadurch kann es zu Überforderungen im Alltag für Familienmitglieder kommen.
2. Risiko- und Schutzfaktoren
Wenn man über Abhängigkeitskrankheiten in der Familie spricht, ist es wichtig, diese nicht als ein autonomes System zu betrachten. Jede Familie ist in ein soziales und ökonomisches Umfeld eingebunden, das eine Vielzahl von Einflüssen auf die Familie ausübt. Treten Störungen oder Probleme auf (z.B. weil sich ein Familienmitglied den gesellschaftlichen Anforderungen und Erwartungen nicht mehr gewachsen sieht), kann es vorkommen, dass die Betroffenen zu anderen Substanzen wie Medikamenten, Alkohol oder Drogen greifen. Die Familie kann also auf der einen Seite ein Risikofaktor für die Entstehung von Abhängigkeiten, aber auch ein Schutzfaktor gegen Abhängigkeiten und Missbrauch sein.
In einer Familie ist es wichtig, füreinander da zu sein, zusammenzuhalten, Verantwortung zu übernehmen, Familienmitglieder anzuerkennen und wertzuschätzen, Zuwendung und Liebe zu geben und füreinander Sorge zu tragen. Enge persönliche Bindungen, Kameradschaft, Solidarität und Liebe stabilisieren die Familienbeziehungen. Störungen in den Beziehungsabläufen der Familie können die Identitätsbildung beeinträchtigen. Familienmitglieder mit verschlossenen, ängstlichen, sensiblen und leicht verletzbaren Persönlichkeiten, die zudem eine geringe Frustrationstoleranz haben, sind oftmals empfänglicher für Risikofaktoren, als starke und gefestigte Persönlichkeiten. Abhängigkeitskrankheiten in der Familie stellen für Familienmitglieder eine fast unerträgliche Belastung dar. So kann es zu Verzweiflung, psychischen Zusammenbrüchen, Schuld- und Schamgefühlen, finanziellen Nöten, Aufopferung und Demütigung kommen.[3]
Für Kinder und Jugendliche ist es besonders schwer, wenn ihre Eltern bspw. drogen- oder alkoholabhängig sind. Eltern übernehmen eine wichtige Vorbildfunktion und Verantwortung.
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nennt folgende mögliche Risikofaktoren in der Familie:
1. „Auflösung der Familie und Suchtrisiko
- Die Familie vermittelt keine Werte und Normen mehr, das bedeutet Orientierungslosigkeit, mehr Drogenkonsum und höheres Suchtrisiko für alle.
- Die Familie vermittelt keine Vorbilder (Modellverhalten) mehr, das bedeutet höheres Suchtrisiko für die Jugend.
- Die Familie bietet keine Ressourcen, Netzwerke, Solidarität mehr, das bedeutet höheres Suchtrisiko für alle.
2. Gestörte Familien und Suchtrisiko
- Unvollständige Familien (ex broken home): „Scheidungsfamilien“, „vater-/mutterlose Familien“, „Stieffamilien“, „Karrierefamilien“ etc. sind Familienformen, die zu Vernachlässigung und Bindungslosigkeit der Kinder und Jugendlichen führen können, dann droht das Suchtrisiko.
3. Familiäre Erziehungsstile und Suchtrisiko
Suchtgenerierende Erziehungsstile
- repressiv,
- gleichgültig,
- over-protective/ heated (übermäßig schützend/ überhitzt),
- permissiv,
- pseudoharmonisch (Familismus)
4. Familientraumata in der Kindheit und Suchtrisiko
- Macht, Gewalt und sexueller Missbrauch (besonders bei Frauen)
5. Familie, gesellschaftliche Strukturzwänge und Suchtrisiko
- Familie und defavorisiertes Sozialmilieu (Wohnverhältnisse, Armut)
- Familie und Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit.“[4]
Im Gegensatz dazu gibt es auch einige Schutzfaktoren in der Familie:
- positive Selbstwertgefühle, Zukunftserwartungen, religiöse Einstellungen, Unterstützung durch Eltern, Schule und Freunde,
- familienfreundliche Werte, Normen, Orientierungen, Vorbilder, Modelle, Ressourcen, Netzwerke, Solidarität, Sozialverhältnisse, vollständige Familien, richtige Erziehungsstile, die Abwesenheit von Familientrauma,
- Solidarität, positive Lebenseinstellung, Bewältigungsstrategien, soziale Kompetenzen, Zusammenhalt, Liebe, Verantwortung, Anerkennung, Wertschätzung.[5]
3. Formen von Sucht in der Familie
In der BRD gibt es ca. 2,5 Millionen Alkoholgefährdete und Alkohlkranke und insgesamt ca. sechs Millionen von der Krankheit mittelbar und unmittelbar Betroffene. Damit gemeint ist das soziale Umfeld, also die Familie[6].
Eine einfache Darstellung dieser Problematik ist nicht möglich, da Betroffenheit und Sucht in der Familie vielfältig sein kann[7]. Das bedeutet, dass Suchtmittelgebrauch und Abhängigkeit in ihr unterschiedliche Formen annehmen kann. Hier gilt auch, was sich allgemein bezüglich der Sucht aufzeigen lässt: Neben der stoffgebundenen Abhängigkeit existieren auch stoffungebundene Verhaltensstörungen. Die WHO unterscheidet innerhalb der stoffgebundenen Abhängigkeiten, jene von illegalen Drogen wie Cannabis, Halluzinogenen, Betäubungsmitteln, Aufputschmitteln, Synthetische Drogen und solche von legalen Drogen, wie Alkohol, Medikamente, Schnüffelstoffe und Nikotin bzw. Tabak auf. Unter den stoffungebundenen Verhaltensstörungen werden Esstörungen, Fernsehsucht, Kaufsucht, Arbeitssucht, Spielsucht, Geltungssucht/ Habsucht/ Machtsucht sowie Sexsucht und andere Störungen aufgezählt.
Neben der Form und Art der Abhängigkeit des Familienmitglieds oder der Familienmitglieder, spielt es eine entscheidende Rolle welche und wie viele Familienmitglieder von der Suchterkrankung betroffen sind. Folglich kann man zwischen Suchterkrankungen beider Eltern oder eines Elternteils und dem Suchtmittelmissbrauch der Kinder und Jugendlichen unterscheiden[8].
Viele Untersuchungen weisen darauf hin, dass wir es also mit sehr unterschiedlichen Gruppen von Menschen im Zusammenhang der Suchtbelastung in der Familie zu tun haben, die zwar Gemeinsamkeiten, jedoch auch Unterschiede aufweisen. Diese liegen wie bereits erwähnt z.B. darin, ob ein Elternteil abhängig ist oder beide abhängig sind. Wenn nur ein Elternteil betroffen ist, ist es bedeutsam zu erfragen welcher Elternteil betroffen ist, Vater oder Mutter. Zudem ist es entscheidend, ob neben der Suchterkrankung noch andere Störungen bei den Eltern vorliegen[9]. Es macht zudem einen Unterschied, ob die Eltern oder der Elternteil noch abhängig sind oder seit Jahren drogenfrei leben. Auch das Geschlecht der betroffenen Kinder spielt in diesem Zusammenhang eine Rolle[10]. Es ist somit zwingend erforderlich, dieses Problem und das damit verbundene Geschehen in der Familie in seinem Gesamtzusammenhang zu betrachten.
4. Folgen und Auswirkungen
In Deutschland leben über 2,5 Millionen Kinder unter 18 Jahren, die mit mindestens einem suchtkranken Elternteil aufwachsen. Diese Kinder leiden häufig unter kognitiven Einschränkungen sowie sozialen, psychischen und körperlichen Belastungen[11]. Für Kinder ist es unglaublich belastend, in einer Familie aufzuwachsen, in der der Vater oder die Mutter oder gar beide von Alkohol oder anderen Drogen abhängig sind.
Zunächst sind Kinder suchtkranker Eltern stark gefährdet, selbst abhängig zu werden. Man kann davon ausgehen, dass ein Kind umso stärker in seiner seelischen und sozialen Entwicklung gestört wird, je jünger es in der Krankheitsphase des suchtkranken Elternteils ist. Die Suchtkrankheit besetzt in der Familienstruktur bzw. im Familiensystem einen derartig großen Raum, dass für kaum etwas anderes Platz bleibt; vor allem nicht für das Kind und seine Bedürfnisse. Je jünger das Kind ist, desto weniger findet es Gelegenheiten, in denen es Geborgenheit, Sicherheit und Bindungen erfährt. Im Gegenteil, überwiegend erfährt es Kälte, Unsicherheit, Isolation und Einsamkeit, distanzierte Bedürfnisbefriedigung und keine Identifikation im Sinne seiner Ich-Entwicklung. Oftmals wird es noch nicht einmal mit dem Nötigsten versorgt. Deshalb zählen schwere schizoide Störungen zu weiteren Folgen für die Kinder aus suchtbelasteten Familien. Zudem kommt das Kind auch in späteren Entwicklungsphasen zu kurz. Seine Ängste, Verwirrtheit und Überforderung wird häufig nicht wahrgenommen oder sogar als angenehm empfunden[12].
Setzt die Suchtphase des Elternteils zu einem späteren Zeitpunkt ein, in dem das Kind schon eine tragfähige psychische Reife entwickelt hat, setzt dennoch eine starke seelische Belastung ein, denn die Erkrankung trifft es in seiner Solidarität zur Familie. Das größere Kind wird in den Isolationsprozess der Familie miteinbezogen. Es wird am dem Prozess der Verheimlichung, des Vertuschens und der Scham und Schuld beteiligt. Dies hat Auswirkung auf seine sozialen Kontakte, die infolge stark belastet werden. Es bricht seine sozialen Kontakte ab, was so weit gehen kann, dass es eher nachlassende Schulleistungen und das Sitzenbleiben in Kauf nimmt, als sich jemandem anzuvertrauen. Es kommt auch vor, dass das Kind die Sündenbockrolle zugewiesen bekommt, die es aufgrund seines gefühlten Schuldanteils an der Situation schließlich auch übernimmt. Zudem muss es gegen Versprechungen und Drohungen das Suchmittel heimlich besorgen[13].
Unumstritten ist zudem, dass die Sucht eines Elternteils bzw. der Eltern, mit all ihren Spannungen, Konflikten und Ängsten, bereits auf das ungeborene Kind einwirkt[14]. Die Suchterkrankung der Eltern wird wahrscheinlich[15] nicht ohne Folgen auf die Entwicklung des ungeborenen Kindes bleiben. Zu nennen sind körperliche Schäden, auch diejenigen die durch körperliche Misshandlung geschehen. Die Auftretenswahrscheinlichkeit von Gewalt liegt in Familien mit Suchtproblemen deutlich höher als in der übrigen Bevölkerung.
[...]
[1] Vgl. Hurrelmann, Klaus und Unverzagt, Gerlinde; 2000; S.127-137
[2] Vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung; 1999; S.26-29
[3] Vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung; 1999; S.27-29
[4] Vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung; 1999; S.29-30
[5] Vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung; 1999; S.30
[6] Vgl. Lindemann, S.31.
[7] Sowohl bezüglich der Stärke und der Art der Suchterkrankung als auch bezüglich der Auswirkungen und Folgen.
[8] Vgl. Kuntz (2005), S. 47.
[9] Dies ist besonders bedeutsam bei einer antisozialen Persönlichkeitsstörung.
[10] Vgl. Lindemann (2006), S. 16.
[11] Vgl. Lindemann (2006), S. 41.
[12] Vgl. Lindemann(2006), S.25-26.
[13] Vgl. Lindemann (2006), S.27-28
[14] Vgl. Lindemann (2006), S. 19.
[15] Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Störungen ist hoch, jedoch nicht zwangsläufig.
Häufig gestellte Fragen
Welche Auswirkungen hat die Sucht eines Elternteils auf Kinder?
Kinder in suchtbelasteten Familien leiden oft unter emotionaler Vernachlässigung, Schamgefühlen, Orientierungslosigkeit und tragen ein höheres Risiko, später selbst eine Sucht zu entwickeln.
Was sind Risikofaktoren für die Entstehung von Sucht in der Familie?
Dazu zählen instabile Familienstrukturen, gestörte Erziehungsstile (z. B. repressiv oder gleichgültig), Armut, Arbeitslosigkeit und fehlende soziale Vorbilder.
Welche Schutzfaktoren können einer Suchtentwicklung entgegenwirken?
Ein positives Selbstwertgefühl, verlässliche Bezugspersonen, ein wertschätzendes Familienklima und die Förderung sozialer Kompetenzen wirken stabilisierend.
Wie viele Kinder in Deutschland wachsen mit suchtkranken Eltern auf?
Schätzungen zufolge leben in Deutschland über 2,5 Millionen Kinder unter 18 Jahren mit mindestens einem suchtkranken Elternteil zusammen.
Was versteht man unter stoffungebundenen Süchten?
Dazu gehören Verhaltensstörungen wie Spielsucht, Kaufsucht, Mediensucht oder Essstörungen, die ähnliche Dynamiken wie eine Drogenabhängigkeit in der Familie auslösen können.
Welche Rolle spielen Erziehungsstile beim Suchtrisiko?
Sowohl übermäßig schützende („over-protective“) als auch völlig grenzenlose („permissive“) Erziehungsstile können die Identitätsbildung stören und die Anfälligkeit für Sucht erhöhen.
- Quote paper
- Katharina Hilberg (Author), 2010, Sucht in der Familie, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/150218