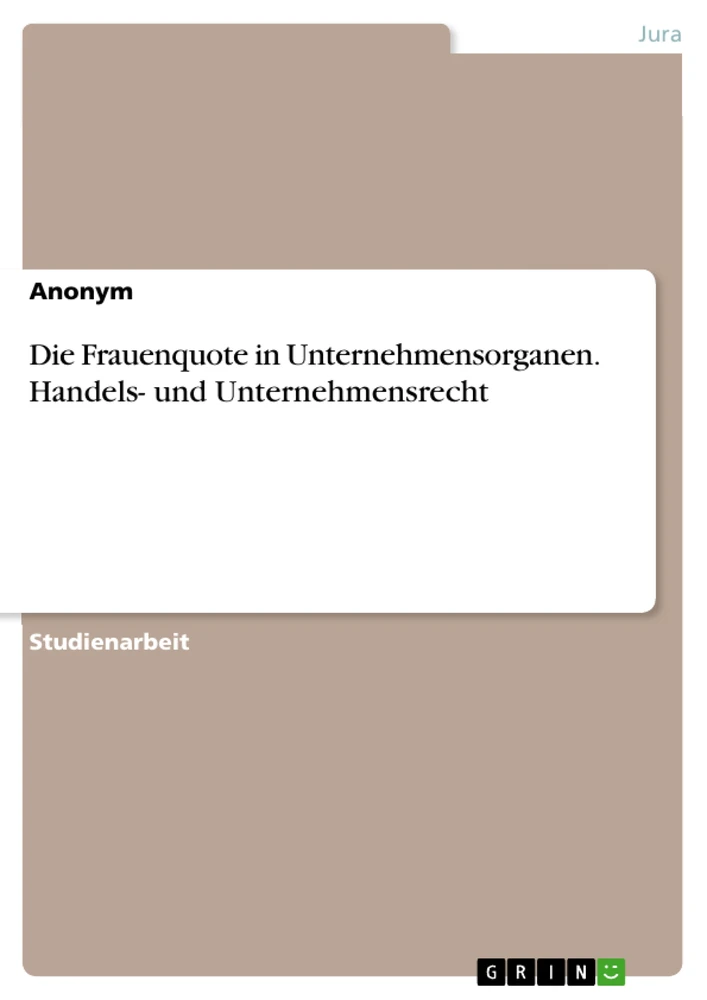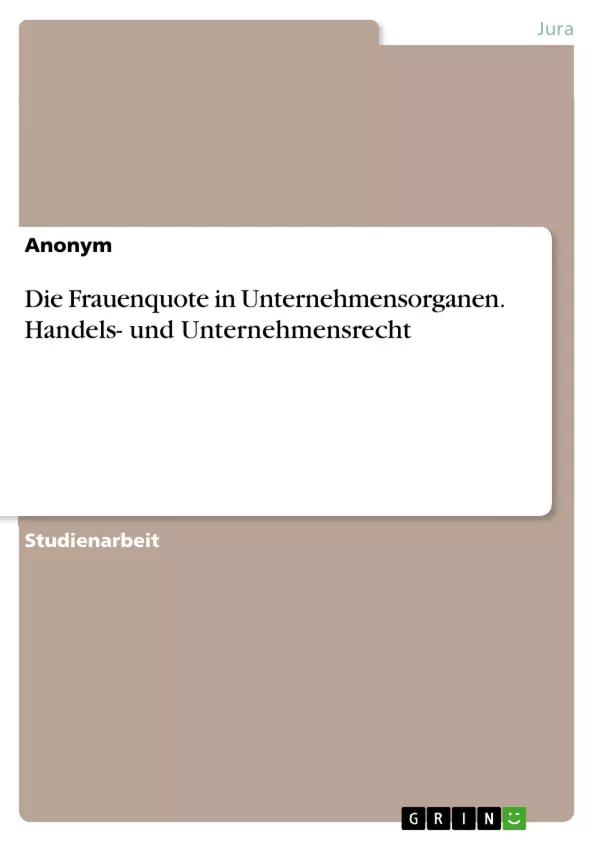Die Regelungen zur gesetzlich eingeführten Geschlechterquote und zur Frauenanteilhabe werden im Folgenden herausgearbeitet und auf die Folgen bei Nichteinhaltung des Gesetzes eingegangen. Außerdem werden die Berichts- und Veröffentlichungspflichten erläutert und die bisherige Wirksamkeit sowie ein Praxisbezug beleuchtet. Als Abschluss wird ein Fazit aufgeführt.
Zu den Themen Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen und Männern im Berufsleben, vor allem in Bezug auf die Besetzung von Führungs- und Leitungspositionen, gehen die Meinungen auseinander. Viele Unternehmen haben es sich zur Aufgabe gemacht und/oder in ihre Philosophien aufgenommen: gelebte "Diversity“ – mittlerweile sollen hier ökonomische Vorteile und der Unternehmenserfolg festgestellt worden sein, dennoch wird sie nicht in dem gewünschten Umfang gelebt.
Die Ungleichbehandlung zwischen Männern und Frauen widerspricht dem Gleichberechtigungsgebot gemäß des Art. 3 Abs. 2 GG, wonach der Staat die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern fördern und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinwirken soll und dem Art. 3 Abs. 3 GG, welcher besagt, dass niemand wegen seines Geschlechts benachteiligt oder bevorzugt werden darf. Ob eine Frauenquote ebenfalls dem Grundsatz der Gleichberechtigung widersprechen würde, wurde schließlich auch gesellschaftlich, rechtlich und politisch diskutiert.
Da die freiwilligen Maßnahmen und Selbstverpflichtungen sowie die Empfehlung im Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) zur Einführung eines Frauenanteils in Führungsgremien nicht den gewünschten Erfolg erzielten, hat der Bundestag am 01.05.2015 das unionskonforme "Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst" (FührposGleichberG) beschlossen. Dieses soll für eine repräsentative Teilhabe von Frauen an der Unternehmensführung sorgen.
Das eingeführte Gesetz beinhaltet sowohl die vorgegebene Geschlechterquote von mindestens 30% für Aufsichtsräte von voll mitbestimmungspflichtigen und börsennotierten Unternehmen, von der ca. 110 Unternehmen betroffen sind4, als auch die Verpflichtung für börsennotierte oder mitbestimmte Unternehmen Zielgrößen für den Frauenanteil festzulegen. Dies betrifft ca. 3.500 Unternehmen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Mindestquote von 30 Prozent für Aufsichtsräte
- 1. Regelungsinhalt und betroffene Gesellschaften
- 1.1 Grundsatz der Gesamt- und Getrennterfüllung
- 1.2 Ermittlung des Mindestanteils
- 2. Rechtsfolgen bei Nichteinhaltung der Mindestquote
- 2.1 "Leere Stuhl" der Anteilseigner
- 2.2 Sanktionen bei Getrennterfüllung für Arbeitnehmerseite
- 2.3 Ersatzbestellung
- 2.4 Auswirkungen für den Aufsichtsrat insgesamt
- 2.5 Berichterstattungspflicht
- 3. Abweichende Regelungen für aus grenzüberschreitender Verschmelzung hervorgegangener Gesellschaften und die SE
- III. Pflichten zur Festlegung von Zielgrößen und Umsetzungsfristen
- 1. Erfasste Organe
- 1.1 Definition der beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstandes
- 1.2 Gesetzliche Anforderungen an die Zielgröße
- 2. Veröffentlichungs- und Berichtspflichten
- 3. Sanktionen und Rechtsfolgen
- IV. Bisherige Wirksamkeit
- V. Praxisbezug
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beleuchtet die gesetzlich eingeführte Frauenquote in Unternehmensorganen, insbesondere die 30%-Quote für Aufsichtsräte, sowie die Verpflichtung zur Festlegung von Zielgrößen für den Frauenanteil in Führungsebenen. Ziel ist es, die rechtlichen Regelungen, die Folgen bei Nichteinhaltung, die Berichts- und Veröffentlichungspflichten sowie die bisherige Wirksamkeit zu analysieren.
- Rechtliche Grundlagen der Frauenquote
- Anforderungen an die Zusammensetzung von Aufsichtsräten
- Rechtsfolgen bei Nichteinhaltung der Quote
- Veröffentlichungspflichten und Zielgrößen für Frauenanteil
- Wirksamkeit und Praxisbezug der Frauenquote
Zusammenfassung der Kapitel
II. Mindestquote von 30 Prozent für Aufsichtsräte: Dieses Kapitel behandelt die konkrete Regelung der 30%-Quote für Aufsichtsräte, ihre Gültigkeit für verschiedene Unternehmensformen und die Rechtsfolgen bei Nichteinhaltung.
III. Pflichten zur Festlegung von Zielgrößen und Umsetzungsfristen: Dieser Abschnitt beleuchtet die Anforderungen an Unternehmen, Zielgrößen für den Frauenanteil in Führungsebenen festzulegen und deren Umsetzung zu planen. Zudem werden die damit verbundenen Veröffentlichungspflichten und Sanktionen erläutert.
IV. Bisherige Wirksamkeit: Dieses Kapitel untersucht die bisherige Wirksamkeit der Frauenquote und analysiert, inwieweit sie die Repräsentation von Frauen in Führungspositionen beeinflusst hat.
V. Praxisbezug: Dieser Teil betrachtet die praktische Umsetzung der Frauenquote und analysiert konkrete Beispiele aus der Unternehmenspraxis.
Schlüsselwörter
Frauenquote, Aufsichtsrat, Führungspositionen, Geschlechtergleichstellung, Gleichberechtigung, Zielgrößen, Unternehmen, Rechtsfolgen, Sanktionen, Wirksamkeit, Praxisbezug.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2022, Die Frauenquote in Unternehmensorganen. Handels- und Unternehmensrecht, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1501018