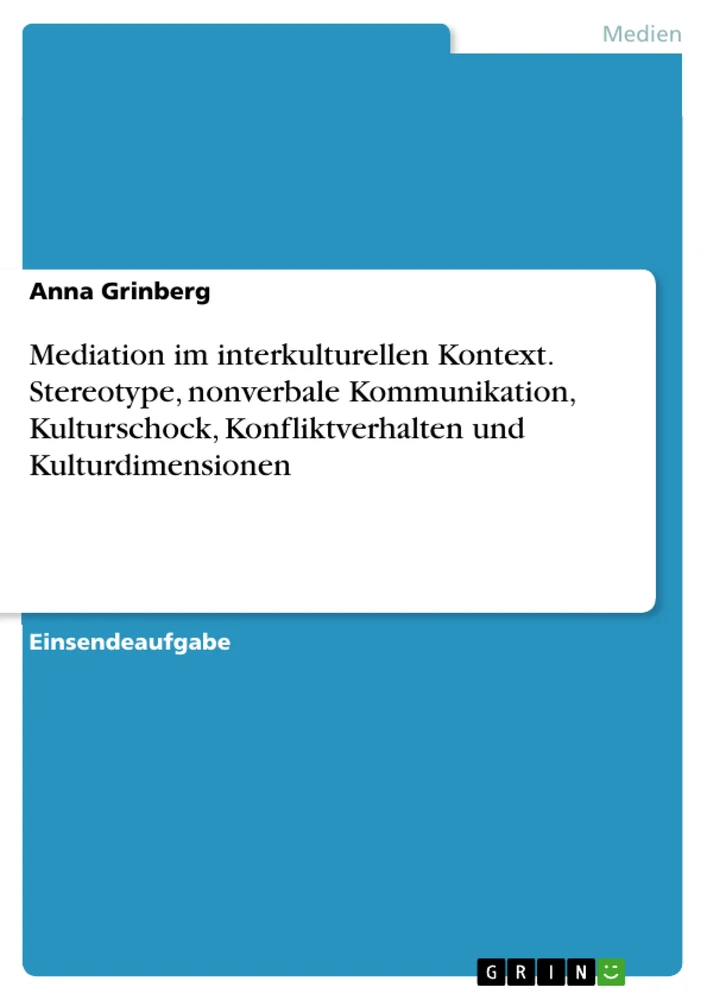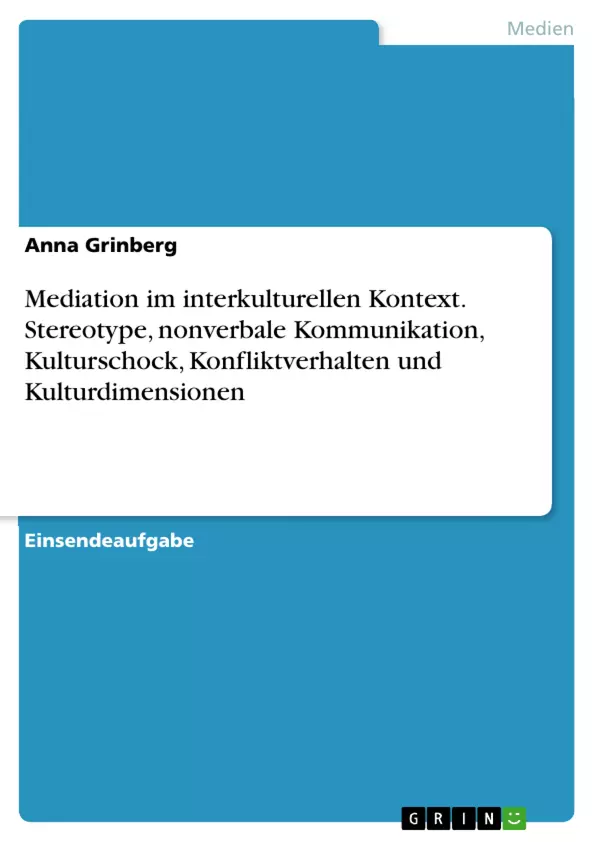Diese Arbeit untersucht verschiedene Aspekte der interkulturellen Kommunikation. Zunächst werden die Unterschiede zwischen Vorurteilen und Stereotypen beleuchtet, gefolgt von einer Analyse des nonverbalen Kommunikationsverhaltens mit kulturspezifischen Besonderheiten. Der Begriff des Kulturschocks wird erklärt und Strategien zur Vermeidung oder Linderung dieses Phänomens werden diskutiert. Weiterhin werden die Unterschiede im Konfliktverhalten zwischen deutschen und asiatischen/arabischen Kulturen analysiert, wobei Vor- und Nachteile der jeweiligen Ansätze betrachtet werden. Abschließend wird untersucht, wie die Konzepte der High- und Low-Kontext-Kulturen nach Hall die Mediation beeinflussen können und welche Kulturform sich möglicherweise besser für Mediationsprozesse eignet.
Inhaltsverzeichnis
- Aufgabe 1: Unterschiede zwischen Vorurteilen und Stereotypen
- Aufgabe 2: Besonderheiten nonverbaler Kommunikationsformen
- Aufgabe 3: Kulturschock und wie er abgemildert werden kann
- Aufgabe 4: Deutsche und asiatische/arabische Konfliktkultur im Vergleich unter Bezugnahme auf Prinzipien und Ziele der Mediation
- Aufgabe 5: High- und Low-Kontext-Kulturen nach Hall im Hinblick auf die Voraussetzungen für die Durchführung einer Mediation
- Aufgabe 6: Motive und Inhalte der US-amerikanischen und asiatischen Gastgeberverhaltensweisen in ihrem kulturellen (kontextuellen) Bezug
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht verschiedene Aspekte der interkulturellen Kommunikation und Mediation. Ziel ist es, ein Verständnis für die Herausforderungen und Möglichkeiten der Mediation im interkulturellen Kontext zu entwickeln.
- Unterschiede zwischen Vorurteilen und Stereotypen
- Nonverbale Kommunikation und kulturspezifische Besonderheiten
- Kulturschock: Ursachen, Prävention und Minderung
- Konfliktverhalten in verschiedenen Kulturen (Deutschland im Vergleich zu asiatischen/arabischen Kulturen)
- High- und Low-Kontext-Kulturen nach Hall und deren Relevanz für die Mediation
Zusammenfassung der Kapitel
Aufgabe 1: Dieses Kapitel differenziert zwischen Stereotypen und Vorurteilen, wobei die kognitiven, affektiven und konativen Ebenen der Einstellungen beleuchtet werden. Die Abgrenzung zwischen diesen Begriffen wird im Kontext des Sozialisierungsprozesses und der Entstehung von Diskriminierung diskutiert.
Aufgabe 2: Hier wird nonverbales Kommunikationsverhalten anhand konkreter Beispiele analysiert. Der Fokus liegt auf kulturspezifischen Unterschieden und deren Bedeutung für die interkulturelle Kommunikation.
Aufgabe 3: Dieses Kapitel behandelt das Phänomen des Kulturschocks. Es werden Ursachen, mögliche Präventionsmaßnahmen und Strategien zur Abmilderung des Kulturschocks erörtert.
Aufgabe 4: Der Vergleich des Konfliktverhaltens in der deutschen und der asiatischen/arabischen Welt bildet den Schwerpunkt dieses Kapitels. Die jeweiligen Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Konfliktstrategien werden im Kontext der Mediationsprinzipien beleuchtet.
Aufgabe 5: Das Kapitel beschreibt das Konzept der High- und Low-Kontext-Kulturen nach Hall und untersucht, welche Kulturform sich für die Mediation besser eignet und warum.
Aufgabe 6: Abschließend wird der unterschiedliche Umgang mit Gästen in den USA und in asiatischen Ländern analysiert. Die Motive und Inhalte der jeweiligen Verhaltensweisen werden im kulturellen Kontext erläutert.
Schlüsselwörter
Interkulturelle Kommunikation, Mediation, Vorurteile, Stereotype, Nonverbale Kommunikation, Kulturschock, Konfliktverhalten, High-Kontext-Kulturen, Low-Kontext-Kulturen, Kulturvergleich, Deutschland, Asien, Arabische Welt, Sozialisation.
- Quote paper
- Anna Grinberg (Author), 2024, Mediation im interkulturellen Kontext. Stereotype, nonverbale Kommunikation, Kulturschock, Konfliktverhalten und Kulturdimensionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1499327