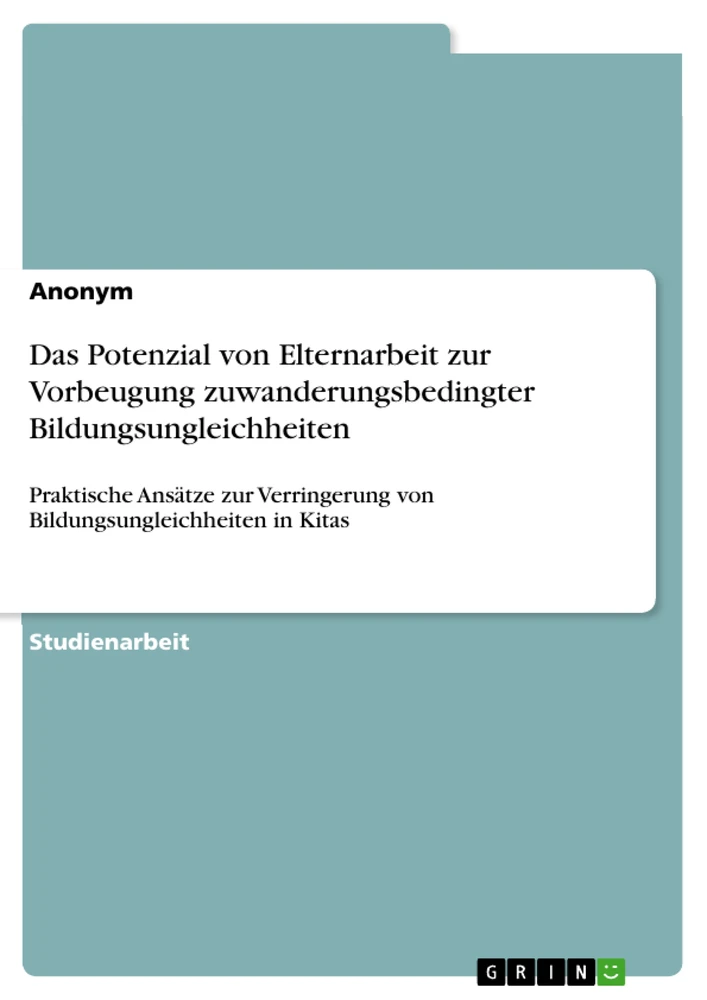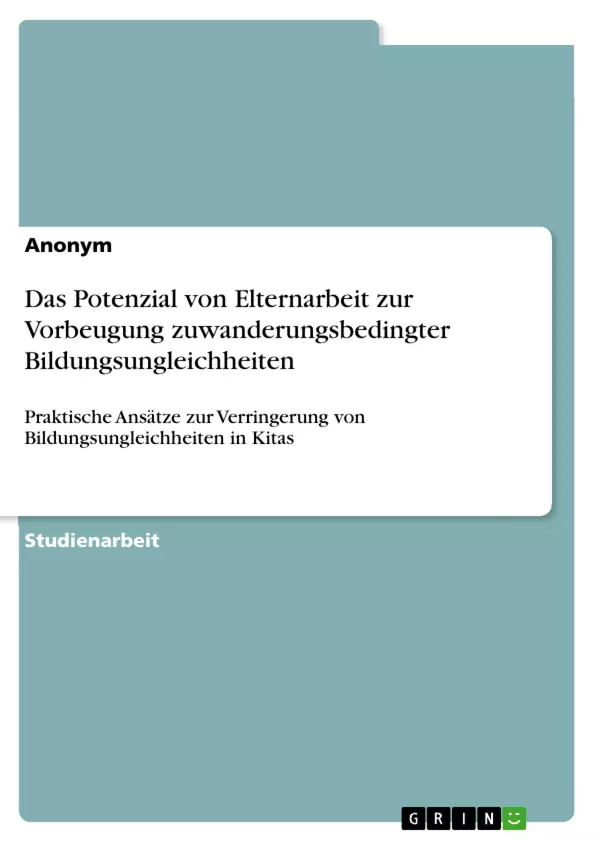Kinder mit zwei im Ausland geborenen Eltern weisen gegenüber Kindern ohne Migrationshintergrund (MGH) einen Kompetenznachteil in Mathematik von 68 Punkten auf, was mehr als einem dreiviertel Schuljahr entspricht. Das ist das Ergebnis einer Studie des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) im Jahr 2021, die im Auftrag der Kultusministerkonferenz alle fünf Jahre das Erreichen festgelegter Bildungsstandards im Primarbereich überprüft. Zuwanderungsbedingte Disparitäten sind zudem das Ergebnis aller PISA-Studien im Sekundärbereich: Gemäß PISA 2022 betrug der Kompetenzunterschied in Mathematik zwischen Jugendlichen der ersten Generation und Jugendlichen ohne MGH 90 Punkte. Dass Bildungsungleichheiten eng mit dem sozioökonomischen und soziokulturellen Status korrelieren, ist nicht neu, sondern vielfach empirisch belegt. Ein Erkenntnisgewinn ergab sich jedoch aus dem häuslichen Sprachgebrauch, der im Rahmen der letzten fünf PISA-Studien erhoben wurde, um deren Einfluss auf die Kompetenz der Jugendlichen besser zu verstehen. Mithilfe entsprechender Regressionsmodelle konnte veranschaulicht werden, dass sich die mathematische Kompetenz der Jugendlichen automatisch um 25 Punkte reduziert, sofern zu Hause kein Deutsch gesprochen wird.
Der eklatante Zusammenhang zwischen Sprache und Schulerfolg verdeutlicht nicht nur, wie wichtig die Förderung der deutschen Sprache ist, um zuwanderungsbedingten Bildungsungleichheiten vorzubeugen, sondern auch, dass die Sprachförderung weit früher als in der Sekundarstufe ansetzen und Bestandteil frühkindlicher Bildung sein muss. Auch wenn der Kindertageseinrichtung (KiTa) im Rahmen der zunehmend institutionalisierten Kindheit neben der Familie wichtige Bildungsaufgaben zukommen, ist eine optimale Sprachentwicklung von Kindern nur möglich, wenn pädagogische Fachkräfte und Eltern an einem Strang ziehen. Vor diesem Hintergrund geht diese Arbeit der Fragestellung nach, welche Strategien pädagogische Fachkräfte anwenden können, um mit Eltern mit MGH, die nur begrenzt Deutsch sprechen, erfolgreich zusammenzuarbeiten und so die Sprachentwicklung ihrer Kinder zu fördern. Ziel ist es, praktische Ansätze aufzuzeigen, die das Engagement und die Kommunikation der Eltern verbessern, um somit zur Verringerung von Bildungsungleichheiten beizutragen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Elternarbeit in Kindertageseinrichtungen
- Begriffsbestimmung und Zieldimension der Elternarbeit
- Vielfalt als Herausforderung in der Elternarbeit
- Voraussetzungen zur Gestaltung einer inklusiven und unterstützenden Lernumgebung
- Aneignung von Wissen über Kulturmodelle
- Entwicklung einer kultursensitiven Haltung
- Gestaltung einer sichtbaren Willkommenskultur
- Praktische Ansätze, um Eltern in die Sprachförderung ihrer Kinder einzubeziehen
- Aufnahme- und Entwicklungsgespräch
- Sprachcafé
- Eltern-Kind-Gruppen
- Virtuelle Reiseprojekte
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anhangsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Herausforderungen und Chancen von Elternarbeit im Kontext zuwanderungsbedingter Bildungsungleichheiten. Sie untersucht Strategien, die pädagogische Fachkräfte in Kindertagesstätten anwenden können, um erfolgreich mit Eltern mit Migrationshintergrund zusammenzuarbeiten, die nur begrenzt Deutsch sprechen, und so die Sprachentwicklung ihrer Kinder zu fördern.
- Bedeutung von Elternarbeit zur Vorbeugung zuwanderungsbedingter Bildungsungleichheiten
- Herausforderungen und Chancen der Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund
- Entwicklung einer kultursensitiven Haltung und Schaffung einer inklusiven Lernumgebung
- Praktische Ansätze zur Einbeziehung von Eltern in die Sprachförderung
- Potenzial von Elternarbeit zur Förderung der Sprachentwicklung und Verbesserung der Bildungsergebnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die Problematik zuwanderungsbedingter Bildungsungleichheiten und die Bedeutung der Sprachförderung für Kinder mit Migrationshintergrund. Sie stellt die Relevanz der Elternarbeit in Kindertagesstätten für die Sprachentwicklung und den Bildungserfolg von Kindern heraus und führt in die Fragestellung der Arbeit ein.
Elternarbeit in Kindertageseinrichtungen
Dieses Kapitel definiert den Begriff der Elternarbeit und betrachtet den Wandel von einer einseitigen Expertenrolle der Pädagogen hin zu einer gleichberechtigten Erziehungs- und Bildungspartnerschaft. Es betont die Notwendigkeit einer kultursensitiven und inklusiven Herangehensweise, die die Heterogenität der Elternschaft berücksichtigt und die Bedürfnisse von Eltern mit Migrationshintergrund und Sprachbarrieren in den Vordergrund stellt.
Voraussetzungen zur Gestaltung einer inklusiven und unterstützenden Lernumgebung
Dieses Kapitel beleuchtet die Notwendigkeit der Aneignung von Wissen über Kulturmodelle und die Entwicklung einer kultursensitiven Haltung bei pädagogischen Fachkräften. Es werden Konzepte wie die Pädagogik der Vielfalt und die Schaffung einer sichtbaren Willkommenskultur im Kontext der Elternarbeit diskutiert.
Praktische Ansätze, um Eltern in die Sprachförderung ihrer Kinder einzubeziehen
Dieses Kapitel stellt verschiedene praktische Ansätze zur Einbeziehung von Eltern in die Sprachförderung ihrer Kinder vor. Es werden Beispiele wie Aufnahme- und Entwicklungsgespräche, Sprachcafés, Eltern-Kind-Gruppen und virtuelle Reiseprojekte vorgestellt und deren Potenzial zur Sprachentwicklung und zur Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Elternarbeit, Sprachförderung, Bildungsungleichheit, Migrationshintergrund, kultursensible Pädagogik, Inklusion, Sprachentwicklung, Kindertageseinrichtung, Erziehungs- und Bildungspartnerschaft.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2024, Das Potenzial von Elternarbeit zur Vorbeugung zuwanderungsbedingter Bildungsungleichheiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1499261