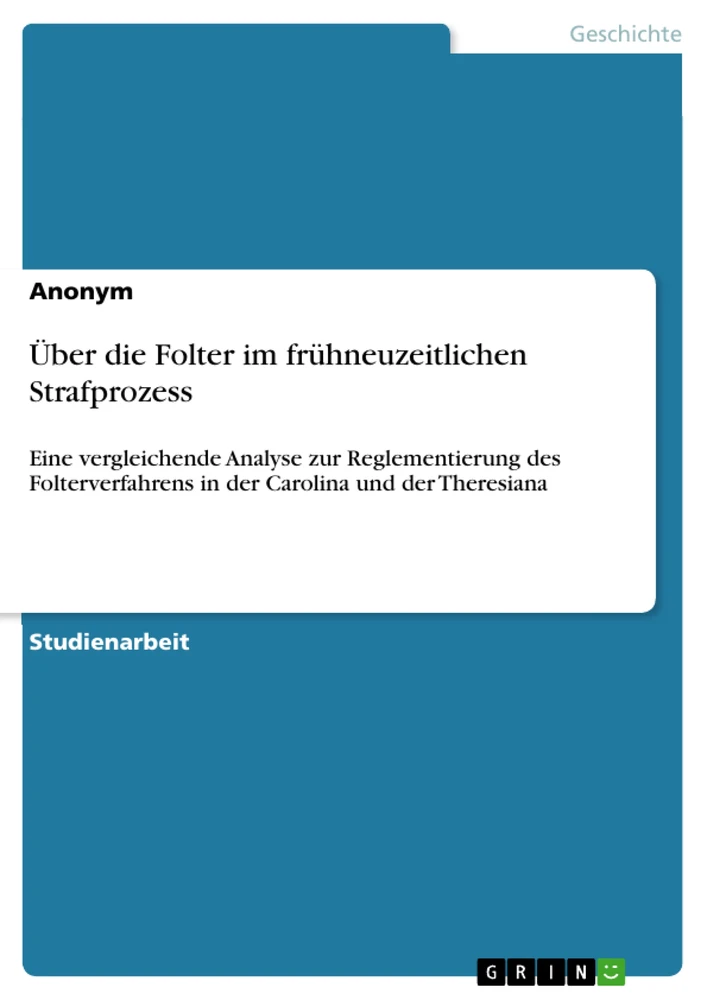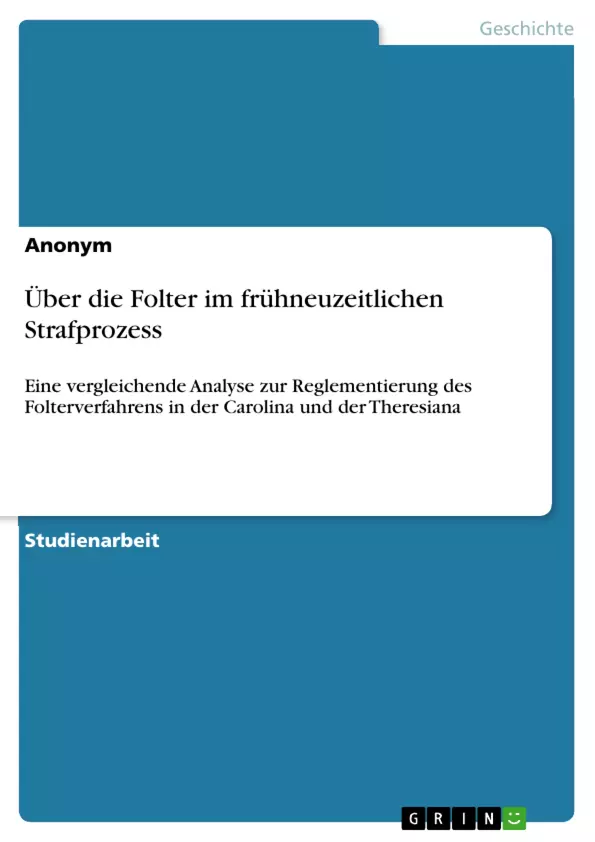Das Verbot der Folter ist eines der Menschenrechte, die universell und ausnahmslos gelten. Heutzutage werden alle Formen von körperlicher und psychischer Misshandlung auf der Grundlage internationaler Menschenrechtsabkommen weltweit geächtet. Trotzdem ist die Folter noch immer eine weitverbreitete Praxis.
Im rechtshistorischen Sinne war die Folter als „peinliche Frage“ jedoch ein ab dem 14 Jahrhundert rechtlich geregelter und protokollierter Verfahrensschritt des frühneuzeitlichen Strafprozesses. Wurde sie zuvor noch weitgehend willkürlich angewendet, so lässt sich in der herrschaftlichen Gesetzgebung der Frühen Neuzeit eine Tendenz zur stärkeren Reglementierung erkennen. Als zentraler Baustein für die Neugestaltung der Rechtsverhältnisse in Europa hat vor allem die Constitutio Criminalis Carolina dazu beigetragen, das Strafrecht zu vereinheitlichen. In Österreich wurde unter Maria Theresia ebenso der Versuch unternommen, die zahlreichen Halsgerichtsordnungen zusammenzubringen und in ein allgemeingültiges Strafgesetzbuch zu transformieren. Die Constitutio Criminalis Theresiana sollte die damals üblichen Foltermethoden verbindlich regeln und beschränken, um einen Missbrauch durch richterliche Willkür zu verhindern.
Beide Strafprozessordnungen werden in der vorliegenden Arbeit hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Regulierung der frühneuzeitlichen Folterpraxis miteinander verglichen. Es wird die Frage beantwortet, in welchem Ausmaß das Folterverfahren bereits in der Carolina durch entsprechende Vorschriften restringiert wurde und inwieweit diese Bestimmungen dann in der Theresiana eine weitere Ausdifferenzierung und Modifizierung erfahren haben. Das Hauptaugenmerk liegt insbesondere darauf, ob und wie der Folteransatz durch die Theresiana problematisiert wird. Im Rahmen dieser Analyse werden Parallelen und Unterschiede zwischen beiden Gesetzbüchern entlang drei konkreter Vergleichsdimensionen herausgearbeitet: Wie wird die Notwendigkeit der Folter innerhalb des strafrechtlichen Rahmens legitimiert, welche Bedingungen mussten für die Folterung erfüllt sein und welche Klauseln weisen auf eine Reglementierung der Folterpraxis hin?
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Die Rechtsgeschichte der Folter bis zur Frühen Neuzeit
- Die „peinliche Befragung“ als frühneuzeitliches Beweisverfahren
- Die Constitutio Criminalis Carolina von 1532
- Die Constitutio Criminalis Theresiana von 1768
- Das Folterverfahren der Carolina und der Theresiana im Vergleich
- Strafrechtliche Prinzipien und Notwendigkeit der Folter
- Voraussetzungen für die Folteranwendung
- Reglementierung der Folterpraxis
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Regulierung der Folterpraxis in der Constitutio Criminalis Carolina und der Constitutio Criminalis Theresiana. Sie untersucht, inwieweit die Folter durch diese beiden Strafprozessordnungen des 16. und 18. Jahrhunderts restringiert und reguliert wurde. Dabei wird die Frage untersucht, ob und wie der Folteransatz durch die Theresiana problematisiert wurde.
- Vergleich der Carolina und der Theresiana hinsichtlich ihrer Regulierung der Folterpraxis
- Legitimation der Notwendigkeit von Folter im strafrechtlichen Kontext
- Voraussetzungen für die Anwendung von Folter
- Reglementierung der Folterpraxis
- Analyse von Parallelen und Unterschieden zwischen den beiden Gesetzbüchern
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung
Die Arbeit beleuchtet die Geschichte der Folter, beginnend mit dem 14. Jahrhundert, und beleuchtet die Rolle der Folter im Strafprozess der frühen Neuzeit. Die Arbeit konzentriert sich auf die beiden wichtigsten Strafprozessordnungen der Zeit: die Carolina und die Theresiana.
Die Rechtsgeschichte der Folter bis zur Frühen Neuzeit
Dieser Abschnitt beschreibt den Wandel von archaischen Rechtssystemen hin zu komplexeren Strafprozessordnungen in der Antike. Er erläutert die Entwicklung der Folter als Mittel der Beweisführung, insbesondere im römischen Recht, und die Rolle der „peinlichen Befragung“ im mittelalterlichen Strafprozess.
Die „peinliche Befragung“ als frühneuzeitliches Beweisverfahren
Dieser Abschnitt stellt die beiden wichtigsten Strafprozessordnungen des 16. und 18. Jahrhunderts vor: die Carolina und die Theresiana. Er geht auf die Entstehung und die Inhalte der beiden Gesetzbücher ein und beleuchtet deren Rolle in der Regulierung der Folterpraxis.
Das Folterverfahren der Carolina und der Theresiana im Vergleich
Dieser Abschnitt analysiert die Carolina und die Theresiana anhand dreier Vergleichsdimensionen: Die Legitimation der Folter, die Voraussetzungen für deren Anwendung und die Reglementierung der Folterpraxis.
Schlüsselwörter
Folter, peinliche Befragung, Strafprozessordnung, Carolina, Theresiana, Strafrecht, Rechtsgeschichte, Frühneuzeit, Beweisführung, Geständnis, Reglementierung, menschliche Rechte, Antifolterkonvention
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2022, Über die Folter im frühneuzeitlichen Strafprozess, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1499006