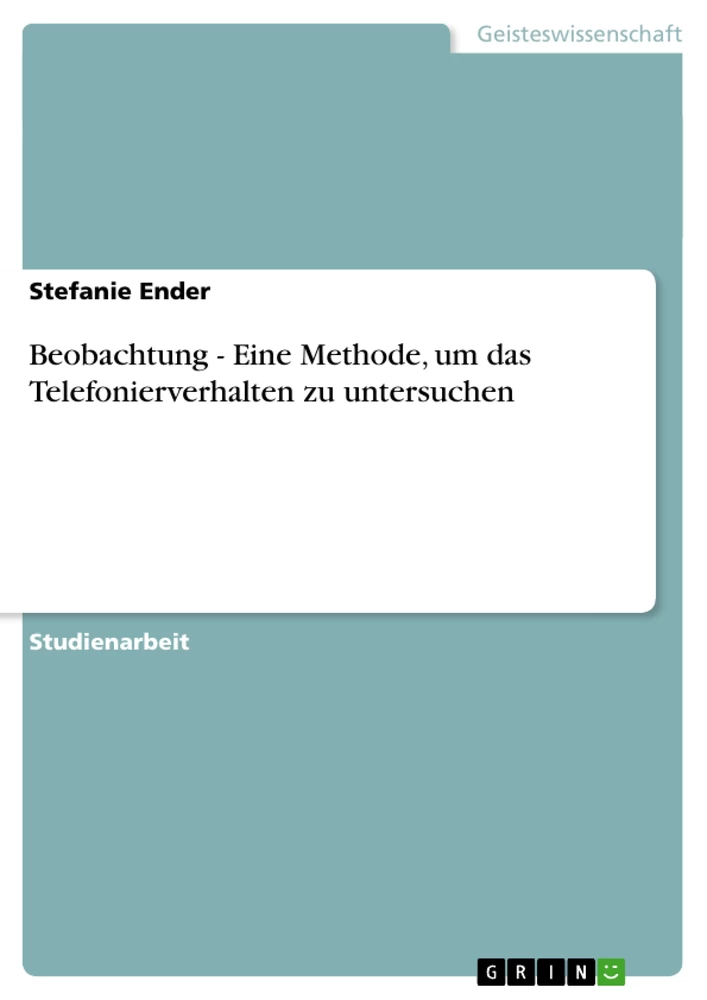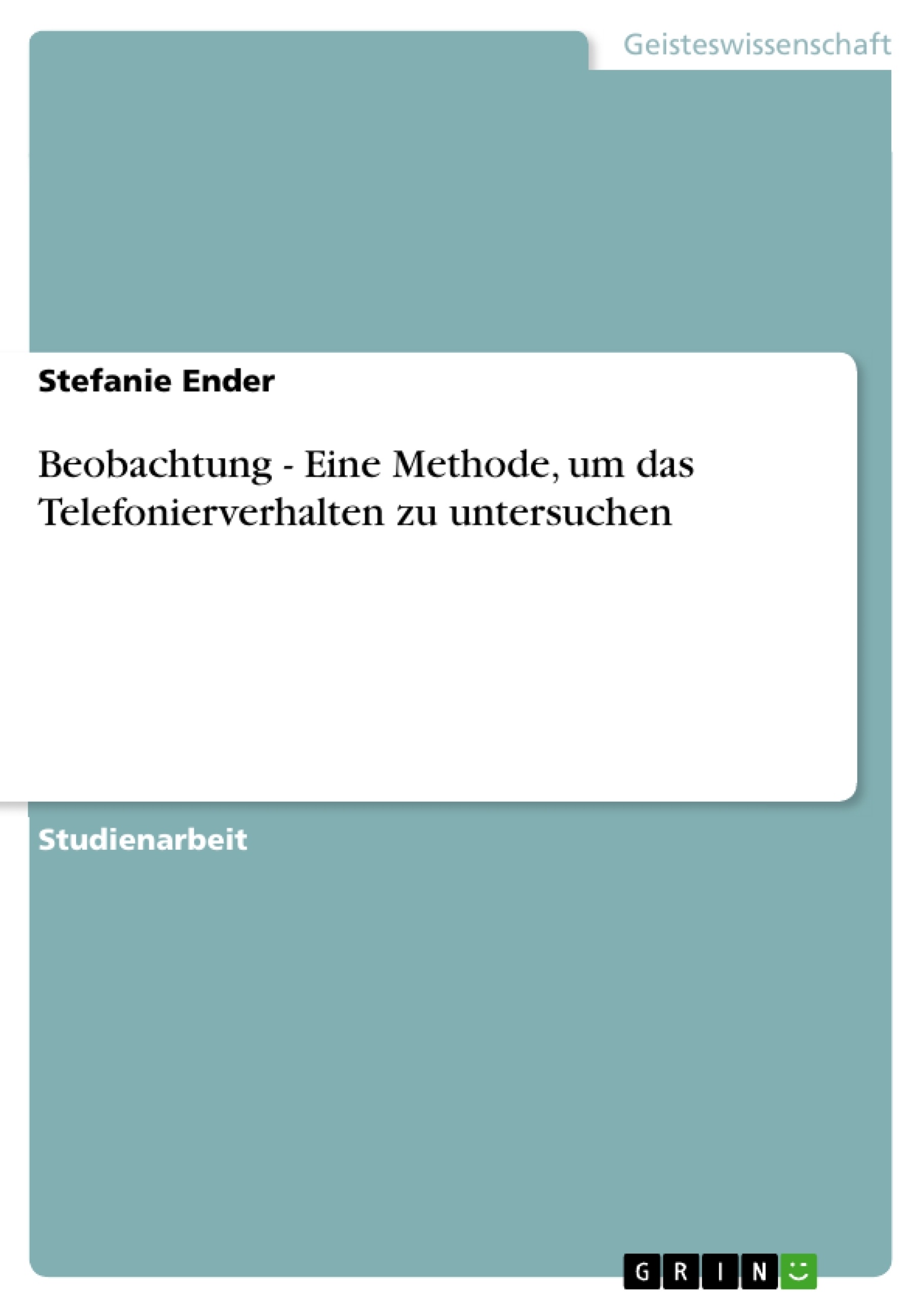Die Beobachtung ist eine Methode der Sozialwissenschaften. In einem Seminar an der Technischen Universität führten Studenten eine Beobachtung durch. Die vorliegende Hausarbeit wird sich mit dieser Methode im Allgemeinen und dem Vorgehen in besagtem Seminar befassen. Zuerst wird kurz darauf eingegangen, welche Erkenntnismöglichkeiten für die Methode der Beobachtung im Allgemeinen bestehen. Anschließend wird in Kapitel Drei die Studie des Seminars der Technischen Universität kurz vorgestellt und die Forschungsfrage genannt. In Kapitel Vier wird ausführlich darauf eingegangen, welche Beobachtungsräume für die Untersuchung der Seminar-Studie ausgewählt wurden. Diese Auswahl wird kritisch hinterfragt werden. In Kapitel Fünf wird die Methode der Beobachtung noch einmal im Allgemeinen betrachtet.
Es werden die Fehler erläutert, die mit der Beobachtungsmethode einhergehen.
Abschließend wird ein Fazit gezogen, in dem die Verwendung der Beobachtungsmethode für die Studie des Universitätsseminars trotz der kritischen Einwände gegen diese Methode verteidigt wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Allgemeine Erkenntnismöglichkeiten von Beobachtungen
- 3. Die Studie „Inszenierung oder Rückzug beim Telefonieren“
- 4. Beobachtung des Telefonierverhaltens in Raum und Zeit
- 5. Fehler beim Beobachten
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Methode der wissenschaftlichen Beobachtung am Beispiel einer Studie zum Telefonierverhalten in öffentlichen Räumen. Ziel ist es, die Anwendung und die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen dieser Methode darzulegen. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte der Beobachtung, von der Erhebungsmethode bis hin zur Auswertung und Interpretation der Ergebnisse.
- Erkenntnismöglichkeiten der wissenschaftlichen Beobachtung
- Methodisches Vorgehen bei der Untersuchung des Telefonierverhaltens
- Auswahl und Kritik der Beobachtungsräume und -zeiten
- Fehlerquellen bei der Beobachtungsmethode
- Bewertung der Beobachtungsmethode im Kontext der Studie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der wissenschaftlichen Beobachtung ein und beschreibt den Kontext der Arbeit: eine Seminarstudie an der Technischen Universität Dresden, die das Telefonierverhalten in öffentlichen Räumen untersucht. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und die behandelten Kapitel, die sich mit den Erkenntnismöglichkeiten der Beobachtung, der konkreten Studie, der Auswahl der Beobachtungsräume und -zeiten, den Fehlern beim Beobachten und schließlich einem Fazit befassen.
2. Allgemeine Erkenntnismöglichkeiten von Beobachtungen: Dieses Kapitel unterscheidet zwischen alltäglicher und wissenschaftlicher Beobachtung. Es erläutert, dass wissenschaftliche Beobachtung planvoller, selektiver und auf Auswertung ausgerichtet ist. Anhand der fünf W-Fragen (Was? Wo? Wann? Warum? Was sagt die Beobachtung aus?) werden die Anwendungsmöglichkeiten der Methode in den Sozialwissenschaften dargestellt. Es werden soziale Merkmale, Sprache, nonverbales Verhalten und geronnenes Verhalten als Beobachtungsobjekte genannt, sowie die Bedeutung der Auswahl von Beobachtungsräumen und -zeiten für die Ergebnisse betont. Der Erkenntnisgewinn durch die unmittelbare Erhebung von Verhalten wird hervorgehoben, gleichzeitig aber auch die Problematik von Interpretationsfehlern angesprochen.
3. Die Studie „Inszenierung oder Rückzug beim Telefonieren“: Dieses Kapitel beschreibt die Seminarstudie an der TU Dresden, die die Forschungsfrage untersucht, ob sich Menschen beim Telefonieren in der Öffentlichkeit inszenieren oder zurückziehen. Es werden die ausgewählten Beobachtungsräume (McDonalds, UFA-Palast, Centrum Galerie, Flughafen, Straßenbahn, Arbeitsagentur) und die festgelegten Beobachtungszeiten detailliert dargestellt. Die Organisation der Beobachtung (Anzahl der Beobachter pro Raum, Beobachtungszeit pro Person) wird beschrieben, ebenso der Ablauf von Pretest und Datenerhebung.
4. Beobachtung des Telefonierverhaltens in Raum und Zeit: Dieses Kapitel analysiert kritisch die Auswahl der Beobachtungsräume und -zeiten der Studie. Es beleuchtet, wie die spezifischen Orte und Zeiten die Ergebnisse beeinflussen können und wie die Auswahl der "falschen" Orte und Zeiten die Beobachtung nachhaltig verzerren kann. Es handelt sich um eine kritische Reflexion der methodischen Vorgehensweise, die die Grenzen und Schwächen der gewählten Methode aufzeigt.
Schlüsselwörter
Wissenschaftliche Beobachtung, Telefonierverhalten, öffentliche Räume, Methoden der empirischen Sozialforschung, Beobachtungsräume, Beobachtungszeit, Fehlerquellen, Qualitative Sozialforschung, Inszenierung, Rückzug.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Inszenierung oder Rückzug beim Telefonieren
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Methode der wissenschaftlichen Beobachtung anhand einer Studie zum Telefonierverhalten in öffentlichen Räumen. Sie analysiert die Anwendungsmöglichkeiten, aber auch die Grenzen dieser Methode.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Erkenntnismöglichkeiten der wissenschaftlichen Beobachtung, methodisches Vorgehen bei der Untersuchung des Telefonierverhaltens, Auswahl und Kritik der Beobachtungsräume und -zeiten, Fehlerquellen bei der Beobachtungsmethode und die Bewertung der Beobachtungsmethode im Kontext der Studie. Es wird zwischen alltäglicher und wissenschaftlicher Beobachtung unterschieden und die fünf W-Fragen (Was? Wo? Wann? Warum? Was sagt die Beobachtung aus?) zur Anwendung der Methode in den Sozialwissenschaften herangezogen.
Welche Studie wird im Detail analysiert?
Im Mittelpunkt steht eine Seminarstudie an der TU Dresden, die die Forschungsfrage untersucht, ob sich Menschen beim Telefonieren in der Öffentlichkeit inszenieren oder zurückziehen. Die Studie analysiert das Telefonierverhalten an verschiedenen Orten wie McDonalds, UFA-Palast, Centrum Galerie, Flughafen, Straßenbahn und Arbeitsagentur zu verschiedenen Zeiten.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu den allgemeinen Erkenntnismöglichkeiten von Beobachtungen, der Beschreibung der Studie „Inszenierung oder Rückzug beim Telefonieren“, der Analyse der Beobachtung des Telefonierverhaltens in Raum und Zeit, einem Kapitel zu Fehlern beim Beobachten und einem Fazit. Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit und den Aufbau. Die Kapitelzusammenfassungen bieten einen detaillierten Überblick über den Inhalt jedes Kapitels.
Welche Beobachtungsräume und -zeiten wurden in der Studie ausgewählt?
Die Studie untersuchte das Telefonierverhalten in verschiedenen öffentlichen Räumen (McDonalds, UFA-Palast, Centrum Galerie, Flughafen, Straßenbahn, Arbeitsagentur) zu verschiedenen Zeiten. Die Arbeit analysiert kritisch die Auswahl dieser Räume und Zeiten und deren Einfluss auf die Ergebnisse.
Welche Fehlerquellen werden in der Arbeit diskutiert?
Die Arbeit beleuchtet kritisch die Fehlerquellen, die bei der Beobachtungsmethode auftreten können und wie die Auswahl der "falschen" Orte und Zeiten die Beobachtung verzerren kann. Es handelt sich um eine kritische Reflexion der methodischen Vorgehensweise, die die Grenzen und Schwächen der gewählten Methode aufzeigt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wissenschaftliche Beobachtung, Telefonierverhalten, öffentliche Räume, Methoden der empirischen Sozialforschung, Beobachtungsräume, Beobachtungszeit, Fehlerquellen, Qualitative Sozialforschung, Inszenierung, Rückzug.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Anwendung und die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen der wissenschaftlichen Beobachtungsmethode darzulegen, anhand einer konkreten Fallstudie zum Telefonierverhalten in öffentlichen Räumen.
- Arbeit zitieren
- Stefanie Ender (Autor:in), 2010, Beobachtung - Eine Methode, um das Telefonierverhalten zu untersuchen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/149825