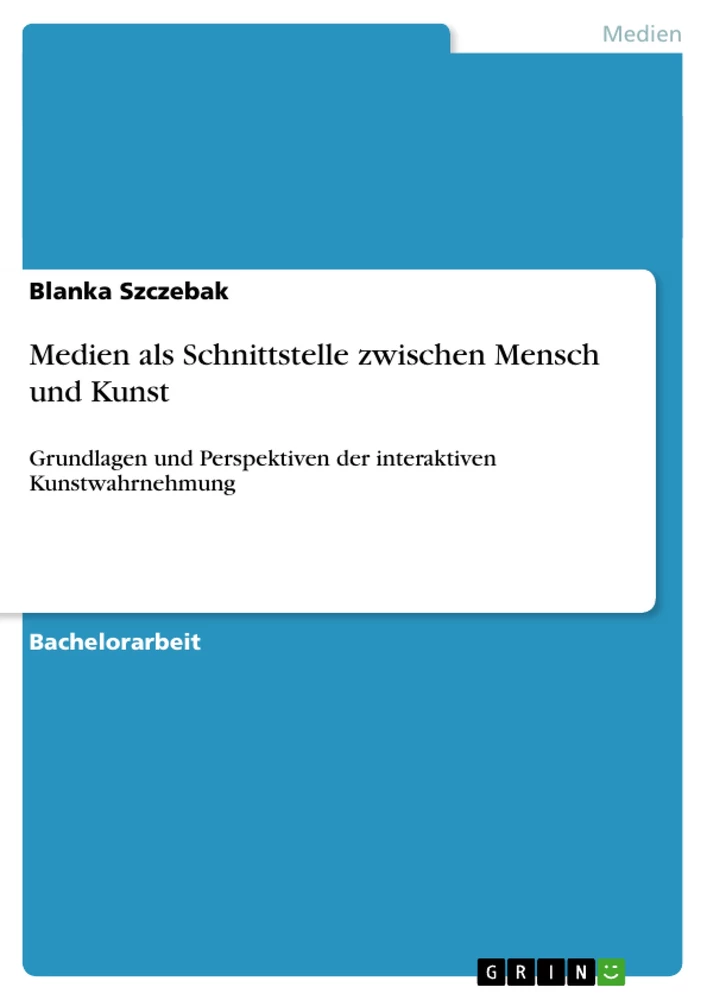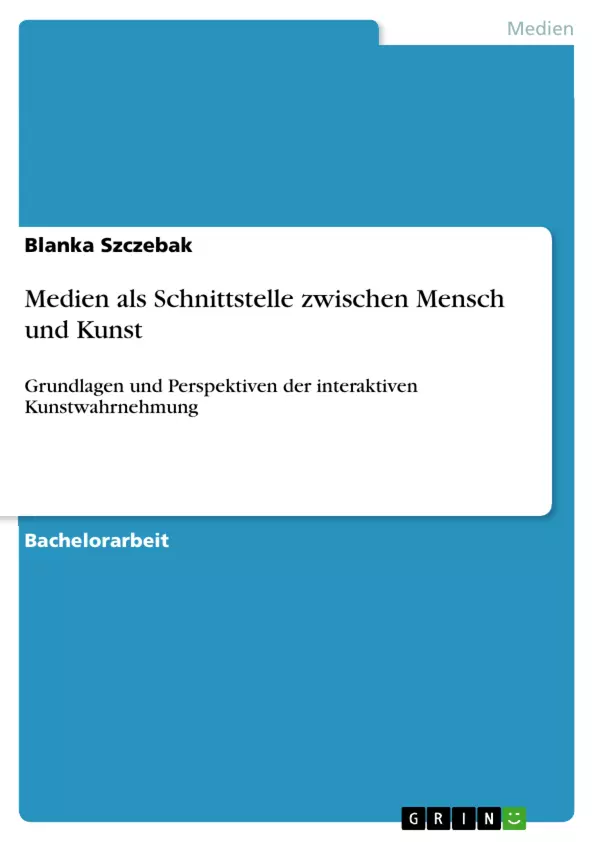Im Rahmen einer Vorlesung zum Thema "Medienkunst" ist mein Interesse auf die weitreichenden Möglichkeiten gelenkt worden, die sich durch den Einsatz von Medien im künstlerischen Kontext ergeben. Medien nehmen in unserer Gesellschaft einen immer wichtigeren Standpunkt ein. Sie dienen als vermittelnde Instanz zwischen dem Menschen und dessen Umwelt. Gleichzeitig ist es mit ihrem Einsatz auch möglich diese Wahrnehmungsvorgänge zu überprüfen und sie somit selbstreflexiv einzusetzen. Laut Petra Missomelius, beinhaltet in der historischen Perspektive der vergangenen 100 Jahre jede technische Neuerung das Versprechen gesteigerter individueller Entfaltungsmöglichkeiten und erhöhter Selbstbestimmung des Subjekts innerhalb der Medien- und Kulturstrukturen.1 Diese Eigenschaften macht es sehr reizvoll sich ihrer in der künstlerischen Praxis zu bedienen. Da wir Menschen nur etwas wahrnehmen können, mit dem wir auch in Kontakt treten, d.h. Informationen mit Hilfe unserer Sinne aufnehmen, ist es interessant diesen Ablauf näher zu betrachten.
Meine Fragestellung in diesem Zusammenhang ist, wie es möglich ist, diesen Vorgang dem Rezipienten durch den künstlerischen Einsatz von Medien tatsächlich bewusst zu machen und welche Rolle darin die Partizipation und Interaktion des Kunstbetrachters spielt.
Im Folgenden werde ich zunächst die beiden Begriffe Partizipation und Interkation definieren und voneinander abgrenzen. Darauf aufbauend möchte ich anhand der geschichtlichen Entwicklung, von den theoretischen Vorläufern der Medienkunst bis zur globalen Vernetzung in den 90er Jahren, einen Überblick ausarbeiten. Anhand dieser einzelnen Entwicklungsschritte möchte ich herausfinden, wie aktive Rezeption in der Kunst an sich und vor allem in der Medienkunst genutzt und verwirklicht wurde. Abschließend werde ich zusammenfassen, welchen Nutzen die medial vermittelte interaktive Wahrnehmung von Kunstwerken für den Rezipienten hat und wie sich dessen Ungang mit künstlerischen Inhalten verändert hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Begriffliche Grundlagen
- Interaktivität
- Interface
- Theoretische Vorläufer
- Entwicklung der interaktiven Kunst
- 60er Jahre
- 70er Jahre
- 80er Jahre
- 90er Jahre
- Auswirkungen auf die Rezeption
- Begriffliche Grundlagen
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Möglichkeiten des Einsatzes von Medien in der Kunst, insbesondere im Hinblick auf interaktive Kunstwahrnehmung. Die Arbeit beleuchtet, wie Medien als Schnittstelle zwischen Mensch und Kunst wirken und die Wahrnehmungsprozesse des Rezipienten beeinflussen. Die Rolle der Partizipation und Interaktion des Kunstbetrachters steht im Mittelpunkt der Analyse.
- Definition und Abgrenzung von Partizipation und Interaktion
- Historische Entwicklung der interaktiven Kunst von den theoretischen Vorläufern bis zur globalen Vernetzung der 90er Jahre
- Analyse der aktiven Rezeption in der Kunst und in der Medienkunst
- Der Nutzen medial vermittelter interaktiver Wahrnehmung von Kunstwerken für den Rezipienten
- Veränderung des Umgangs mit künstlerischen Inhalten durch interaktive Medien
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Medienkunst und ihrer weitreichenden Möglichkeiten ein. Sie beschreibt die zunehmende Bedeutung von Medien in unserer Gesellschaft als vermittelnde Instanz zwischen Mensch und Umwelt und betont das Potenzial der Selbstreflexion durch den Einsatz von Medien in der Kunst. Die zentrale Forschungsfrage lautet, wie die bewusste Wahrnehmung des Rezeptionsprozesses durch den künstlerischen Einsatz von Medien erreicht werden kann und welche Rolle die Partizipation und Interaktion des Betrachters dabei spielt. Die Arbeit skizziert den Aufbau und die Vorgehensweise, die auf einer Definition und Abgrenzung von Partizipation und Interaktion basieren und eine historische Entwicklung der Medienkunst nachzeichnen.
Hauptteil - Begriffliche Grundlagen - Interaktivität: Dieser Abschnitt definiert den Begriff Interaktivität im Kontext technischer Medien und kognitiver Psychologie. Er unterscheidet zwischen verschiedenen Ebenen der Interaktion nach Weibel (synästhetisch, synergetisch, kinetisch, kommunikativ) und betont die Rolle der Interaktion in der Kunst als Reflexion gesellschaftlicher Problemfelder. Die Arbeit diskutiert die Auswirkungen der Interaktion auf die Rolle des Künstlers und den Rezipienten, indem sie die aktive Teilnahme an der Kunstproduktion und -rezeption hervorhebt. Der Katalog von Roy Ascott zur Systematisierung interaktiver Kunstwerke wird vorgestellt und analysiert.
Hauptteil - Theoretische Vorläufer: Dieser Teil der Arbeit untersucht die theoretischen Vorläufer der interaktiven Medienkunst. Er analysiert die Verbindung von Kunst und Leben in der klassischen Avantgarde, die gesellschaftlichen Auswirkungen von Brechts Rundfunktheorie und die technologischen Grundlagen in Turings Theorie einer universellen Maschine. Durch die Analyse dieser Vorläufer wird der Kontext für die Entwicklung der interaktiven Kunst geschaffen und die Entwicklungsschritte der medialen Kunst bis in die 1990er Jahre vorbereitet.
Hauptteil - Entwicklung der interaktiven Kunst (60er-90er Jahre): Dieser Abschnitt bietet einen historischen Überblick über die Entwicklung der interaktiven Kunst von den 1960er bis zu den 1990er Jahren. Er behandelt die Bewegung "Intermedia", die Werke von John Cage und Alan Kaprow ("Happening"), die Konditionierung des Rezipienten in den 1970er Jahren und die "Closed-Circuit-Installationen" von Bruce Nauman. Die technischen Entwicklungen der 1980er und 1990er Jahre werden ebenso betrachtet, einschließlich des Einflusses des Internets, von Datenräumen, Virtual Reality, Videodiscs und Videostories. Beispiele von Knowbotic Research und Lynn Hershman veranschaulichen die Entwicklung der Selbstwahrnehmung des Künstlers und deren Auswirkungen auf die Rezeption.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Interaktive Kunst und Medien
Was ist der Inhalt dieser Bachelorarbeit?
Diese Bachelorarbeit untersucht die interaktive Kunst und ihre Entwicklung, insbesondere die Rolle von Medien in der Kunstwahrnehmung. Sie analysiert die Interaktion zwischen Mensch und Kunstwerk durch Medien, die Auswirkungen auf die Rezeption und die historische Entwicklung der interaktiven Kunst von den theoretischen Vorläufern bis in die 1990er Jahre. Die Arbeit beinhaltet eine Definition von Interaktivität und Partizipation, die Analyse verschiedener künstlerischer Ansätze und die Betrachtung der technischen Entwicklungen, die die interaktive Kunst geprägt haben.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung von Partizipation und Interaktion; historische Entwicklung der interaktiven Kunst (inkl. 60er bis 90er Jahre); Analyse der aktiven Rezeption in Kunst und Medienkunst; Nutzen medial vermittelter interaktiver Wahrnehmung für den Rezipienten; Veränderung des Umgangs mit künstlerischen Inhalten durch interaktive Medien; theoretische Vorläufer der interaktiven Medienkunst (z.B. Brecht, Turing); wichtige Künstler und Kunstbewegungen (z.B. John Cage, Alan Kaprow, Bruce Nauman, Knowbotic Research, Lynn Hershman); und die Rolle der Interaktion in der Kunst als Reflexion gesellschaftlicher Problemfelder.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil und Schlussbemerkungen. Der Hauptteil behandelt die Begrifflichen Grundlagen (Interaktivität, Interface), die Theoretischen Vorläufer, die Entwicklung der interaktiven Kunst (60er-90er Jahre) und die Auswirkungen auf die Rezeption. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit vor. Die Schlussbemerkungen fassen die Ergebnisse zusammen.
Welche Künstler und Kunstbewegungen werden erwähnt?
Die Arbeit erwähnt unter anderem John Cage, Alan Kaprow ("Happening"), Bruce Nauman ("Closed-Circuit-Installationen"), Knowbotic Research und Lynn Hershman. Sie behandelt außerdem die Bewegung "Intermedia" und bezieht sich auf die Theorien von Bertolt Brecht und Alan Turing.
Welche Zeiträume werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Entwicklung der interaktiven Kunst von ihren theoretischen Vorläufern bis in die 1990er Jahre, mit einem Fokus auf die 60er, 70er, 80er und 90er Jahre.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie kann die bewusste Wahrnehmung des Rezeptionsprozesses durch den künstlerischen Einsatz von Medien erreicht werden und welche Rolle spielen dabei Partizipation und Interaktion des Betrachters?
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit folgt einem strukturierten Aufbau mit Einleitung, Hauptteil und Schlussbemerkungen. Der Hauptteil ist weiter unterteilt in Abschnitte zu den Begrifflichen Grundlagen, den Theoretischen Vorläufern und der Entwicklung der interaktiven Kunst. Kapitelzusammenfassungen bieten einen Überblick über den Inhalt der einzelnen Kapitel.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum gedacht und dient der Analyse von Themen im Bereich der interaktiven Kunst und Medien.
- Arbeit zitieren
- Blanka Szczebak (Autor:in), 2008, Medien als Schnittstelle zwischen Mensch und Kunst, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/149819